Sony Classical 19439888252; EAN 0194398882529
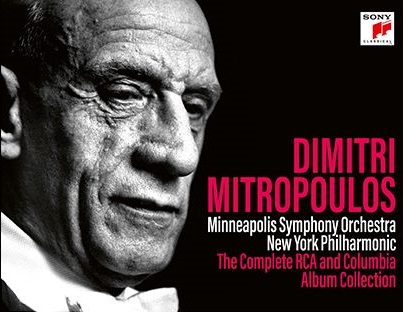
Das Jahr 2022 war hinsichtlich der Veröffentlichung von Tonträgern nicht weniger interessant und ergiebig als die vorangegangenen Jahre. Wenn nun also das große Fest des Verschenkens und Beschenktwerdens vor der Tür steht, dann gibt es so einiges, was in Frage kommt: die sensationellen Ersteinspielungen der Streichquartett-Symphonie von Gavriil Popov (Quartet Berlin Tokyo auf eigenem Label) und der Quartette Nr. 3 und 5 von Conrado del Campo (Quatuor Diotima im Vertrieb von outheremusic); Celibidache und die Münchner Philharmoniker mit Sibelius’ 5. Symphonie und Stravinskys Feuervogel-Suite von 1919 (Eigenlabel der Philharmoniker) oder Karel Ančerl mit einer großen Vermächtnis-Box mit vielen wunderbaren Raritäten (Supraphon); einiges weitere fällt mir noch ein, doch editorisch steht der Höhepunkt des Jahres fest, und dies nicht nur, weil vieles bisher nicht Greifbare erstmals zu bekommen ist, sondern überhaupt, weil es sich um eines der ganz großen Vermächtnisse des vergangenen Jahrhunderts handelt: sämtliche kommerziellen Aufnahmen von Dimitri Mitropoulos, dem überragenden Genie der griechischen Musik.
Nicht nur seit Beginn der Digital-Ära, nein: seit mehr als 60 Jahren warten die Verehrer von Dimitri Mitropoulos auf eine Anthologie seiner durchweg US-amerikanischen Studio-Aufnahmen, die er zwischen Dezember 1938 und Februar 1958 fast ausschließlich in New York und Minneapolis machte: in den 1940er Jahren als Chefdirigent des Minneapolis Symphony Orchestra (des heutigen Minnesota Symphony), in den 1950er Jahren als Chefdirigent des Philharmonic Symphony Orchestra von New York (des heutigen New York Philharmonic) und als erster Gastdirigent an der Metropolitan Opera. Warum hat das so lange gedauert – während die meisten anderen legendären Chefdirigenten der großen US-Orchester wie Arturo Toscanini, Fritz Reiner, Pierre Monteux, George Szell, Charles Munch, John Barbirolli, Eugene Ormandy, Jean Martinon oder Leonard Bernstein längst mehrfach abgefeiert und auch Serge Koussevitzky oder der unglaublich vielseitige Leopold Stokowski mit einer unüberschaubaren Zahl von Editionen bedacht wurden?
Manchmal sind es die Nachwehen einer großen Tragödie, die auch dann noch ihre Echos aussenden, wenn die Nachgeborenen die einstigen Ereignisse längst nicht einmal mehr vom Hörensagen kennen. Und in diesem Fall ist es auch noch eine griechische Tragödie…
Geboren 1896 in Athen, wuchs Dimitri Mitropoulos in einer Familie auf, deren hochbegabte junge Männer meist Priester wurden. Zugleich war seine musikalische Begabung früh offensichtlich, und der belgische Komponist Armand Marsick – einst Schüler von Ropartz und d’Indy sowie Freund von Saint-Saëns und Ysaÿe, bis zum Ausbruch des griechisch-türkischen Krieges Direktor des Athener Konservatoriums – nahm ihn unter seine Fittiche. Mitropoulos wollte seine beiden Lebensadern unter einen Hut bringen und erbat die Aufnahme ins orthodoxe Klosterleben unter Beibehaltung seines Musikerstatus. Die Absicht scheiterte am Verbot des instrumentalen Musizierens, sonst wäre aus ihm vielleicht eine Art griechischer Parallelerscheinung des piemontesischen Priester-Komponisten Lorenzo Perosi geworden. Also begleitete er Marsick nach Rom und wurde zu einem lebenslangen Anhänger der Lehren des San Francesco d’Assisi. Dessen Ideal einer nicht-hierarchischen, jedem Mitglied gleichen Rang gewährenden Gemeinschaft wollte er als Musiker verwirklichen, und als sich herausstellte, dass er vor allem Dirigent sein würde, übertrug er diese Haltung auf seine Orchester, wofür ihn seine Musiker liebten, was ihm aber letzten Endes auch zum Verhängnis werden sollte.
Doch zunächst verstand er sich noch primär als tiefschürfender Komponist und brillanter Pianist. Er ging nach Berlin zu Ferruccio Busoni, der ihm auf einen Schlag das austrieb, was man damals in fortschrittlichen Kreisen als romantische Flausen ansah. Mitropoulos, der von seiner Grundveranlagung her immer rückhaltlos aus tiefster Seele schöpfen musste, war als Komponist auf sich selbst zurückgeworfen. Schnell zeigte sich seine immense dirigentische Begabung, 1921–25 wirkte er als Assistent unter Erich Kleiber an der Berliner Staatsoper, also bei genau dem richtigen Mann, um den Pionier der Moderne in ihm heranreifen zu lassen. Dann folgte er einem Ruf zurück nach Athen, wo er sich in der muffigen, von Eifersucht vergifteten musikalischen Provinz unter widrigsten Bedingungen als begnadeter Orchestererzieher emporarbeitete. Eine gigantische Sensation war dann sein Debüt 1930 bei den Berliner Philharmonikern: Egon Petri, der allseits beglaubigte Statthalter der Busoni-Schule, sagte im letzten Moment als Solist in Prokofieffs 3. Klavierkonzert ab, und Mitropoulos fragte zuerst bescheiden nach, ob das akzeptabel sei, um dann in diesem horrend herausfordernden Werk am Klavier einzuspringen. Er dirigierte vom Instrument aus, lieferte eine fulminante Vorstellung ab und frappierte die etablierte musikalische Welt. Fortan stand seiner internationalen Karriere nichts Wesentliches mehr im Wege, und überall wurde er mit seinem eine Sensation garantierenden Prokofieff-Wunderkonzert eingeladen.
1936 debütierte er beim Boston Symphony Orchestra, wo er sofort als Kronprinz von Serge Koussevitzky gehandelt wurde, und als er im folgenden Jahr wiederkehrte, lud man ihn auch nach Minnesota ein, wo das Orchester gerade – nach dem Weggang Eugene Ormandys nach Philadelphia – nach einem neuen Leiter Ausschau hielt. Ormandy hatte übrigens 1934–35 in Minneapolis für RCA als Recording Pioneer erstaunliche Einspielungen gemacht, darunter Mahlers Zweite und Bruckners Siebte, die auf unzählige Schellacks verteilt wurden und soeben sämtlich in einer 11-CD-Box bei Sony Classical verfügbar gemacht worden sind. Man kann, wenn man beispielsweise die damals so populäre Hary-János-Suite von Kodály hört, sehr eindrücklich den Unterschied zwischen dem frischen, charmant entspannten Musikanten Ormandy in seiner wohl besten Zeit und dem Existenzialisten Mitropoulos hören. (Auch Schönbergs Verklärte Nacht und Jaromír Weinbergers robust zündende Polka und Fuge aus Schwanda der Dudelsackpfeifer laden zum direkten Vergleich ein.)
Jedenfalls nahm Mitropoulos die Herausforderung in Minneapolis im Sturm, und auch die Fortführung der RCA-Aufnahmen übernahm er, nachdem er seine Musiker zu nie dagewesenem Glanz geführt hatte. Er leitete die Geschicke dieses Orchesters, das plötzlich von einem provinziellen Klangkörper zu einem der angesehensten der USA wurde, durch die schweren Jahre des II. Weltkriegs und machte Minneapolis zu einer musikalischen Bastion des Unerhörten und Modernen. Ab 1946 US-amerikanischer Staatsbürger, war er auf die Musikszene in seiner Heimat kaum besser zu sprechen als später sein Kollege Sergiu Celibidache auf das Musikleben im kommunistischen Rumänien unter Ceaușescu. 1950 wurde er, nach mehreren umjubelten Arbeitsphasen am Big Apple, von den New Yorker Philharmonikern abgeworben. Im ersten Jahr teilte er sich die Leitung mit Leopold Stokowski, der zu jener Zeit durch eine schwere persönliche Krise ging, und im darauffolgenden Jahr war er alleiniger Chefdirigent des prestigeträchtigsten Orchesters jenseits des Atlantiks.
Diese Position klingt nach künstlerischer Allmacht, wird jedoch in ihrer Autorität überschätzt. Vom Management wurde ihm schnell signalisiert, dass er sich in der Repertoireauswahl mehr am etablierten Werkkanon und den berühmten Solisten – also am immer noch lebendigen Vorbild Toscaninis – zu orientieren habe, und so focht er bis zum Ende einen leidenschaftlichen Kampf für alles Neue und Unbekannte. In seiner Auswahl findet sich kein Anzeichen ideologischer Scheuklappen, jedoch natürlich ein Schwerpunkt US-amerikanischer Musik, worunter ihm Zeitgenossen wie Morton Gould, Peter Mennin, Roger Sessions, Howard Swanson oder auch David Diamond besonders am Herzen lagen. Im Laufe der Jahre wurde er allerdings zur Zielscheibe der New Yorker Kritik, die auf die zunehmenden Unruhen und Beschwerden aus dem Orchester reagierte und ihn letztlich – in Person des neuen Chefkritikers der New York Times, Howard Taubman – abschoss. Er wollte Gleicher unter Gleichen sein, was er – nicht bereit, offenkundig sich gegen ihn verhaltende Musiker abzustrafen – mit dem Messer im Rücken bezahlte. Zu jenem Zeitpunkt, 1957, hatte er schon seinen ersten Herzinfarkt hinter sich, doch dachte er nicht an Schonung und verausgabte sich weiterhin komplett im Dienst an der Kunst. Mittlerweile war er zudem zum Favoriten der MET avanciert, wo auch die Kritik nicht anders konnte, als seine umwerfend dramatischen, vom ersten bis zum letzten Ton fesselnden Aufführungen zu bejubeln. Und als Orchesterdirigent wandte er sich nun zurück nach Europa, wo er nach dem Tode des in vielem geistesverwandten Wilhelm Furtwängler schnell der Lieblingsdirigent der Wiener Philharmoniker wurde. Vor allem seine Aufführungen der Symphonien Gustav Mahlers und von Werken von Richard Strauss und Franz Schmidt machten ihn zum Gegenstand einer kultischen Verehrung, die aufgrund der vielen erhaltenen Live-Aufnahmen unverändert anhält. Mitropoulos starb – wie es sich gehört, kann man in seinem Fall sagen – am 2. November 1960 während einer Probe für Mahlers Dritte in der Mailänder Scala an seinem dritten Herzinfarkt. Das Bergsteigen, das er so sehr liebte, hatte er längst aufgeben müssen, doch Kettenraucher war er nach wie vor. Er hat alles, auch die komplexesten neuen Werke, auswendig dirigiert und kannte die Musik bis ins kleinste Detail besser als die versiertesten unter den Komponisten, die das Glück hatten, von ihm aufgeführt zu werden. Leider gibt es von ihm nur ganz wenige Aufnahmen von Werken der Klassiker, und da hat viel Neid und üble Nachrede dazu geführt, seine Leistungen zu marginalisieren. Mitropoulos war im Leben ein Asket, manche haben ihn sogar als Masochisten bezeichnet, in der Musik hingegen von unwiderstehlicher Strahlkraft mit seinem alles und jeden in Bann ziehenden Lebenswillen, seiner unaufhaltsam pulsierenden Entdeckungsfreude und einer Intensität ohnegleichen.
Nun also wird die weltweite Mitropoulos-Gemeinde für ihr 60jähriges Warten entschädigt, indem Sony Classical sämtliche RCA- und Columbia-Aufnahmen des bedeutendsten griechischen Musikers des 20. Jahrhunderts in einer luxuriös ausgestatteten 69-CD-Box veröffentlicht. Das hat so lange gedauert, da die Plattenfirma in diesem Unternehmen vom New York Philharmonic – wo Mitropoulos seit Bernsteins Zeiten bis heute ein ähnlicher Interimsstatus zugeschrieben wird, wie ihn die Berliner Philharmoniker unter Karajan gegenüber Celibidache als Image etablierten – kaum nennenswerte Unterstützung erfuhr. Und in Minneapolis hatte man einfach nicht die Ressourcen, um dies ambitionierte Vorhaben entsprechend mit voranzutreiben. Dass Mitropoulos ein Genie – dies nicht nur als Dirigent, sondern auch als Pianist und (was man erst heute allgemein anzuerkennen beginnt) als Komponist – war, stand stets außer Zweifel, und mit genau dieser Etikettierung warb die Columbia schon damals für seine New Yorker Aufnahmen. Doch zugleich war es seine kompromisslos auf die Angelegenheiten der Musik konzentrierte Hingabe, die ihn für Fragen des Prestiges und der Macht blind sein ließ. Er agierte selbstlos als Dirigent, bezahlte oft Projekte, die nicht die nötige Unterstützung erhielten, aus der eigenen Tasche, half auch jedem anderen Bedürftigen großzügig mit seinem Geld aus, bis er selbst keines mehr hatte; und diese Selbstlosigkeit erwartete er zugleich von seinen Mitstreitern, was dazu führte, dass er von der Columbia keine besseren Bedingungen forderte und daher schlechter behandelt wurde als beispielsweise die Kollegen aus Philadelphia unter ihrem viel oberflächlicheren, jedoch sehr auf gute Politur bedachten Chefdirigenten Eugene Ormandy. Nicht nur hatte Ormandy wie auch Bruno Walter und George Szell bei der Auswahl des Repertoires überwiegend freie Hand, es wurde dort auch weitaus großzügiger mit den zur Verfügung gestellten Aufnahme-Sessions verfahren. In New York unter Mitropoulos hingegen wurden alle Beteiligten auslaugende Mammut-Sessions anberaumt, die heute schlicht absurd überfordernd wirken, und man kann sich nur wundern, wie es unter derart desaströsen Bedingungen überhaupt zu solchen Leistungen kommen konnte. So wurden am 2. November 1952 Borodins 2. Symphonie (eine der großartigsten Mitropoulos-Einspielungen), 4 Tänze von de Falla und von Mendelssohn drei Ouvertüren und die Symphonien Nr. 3 und 5 aufgenommen. Und am 11. November 1957, als das gemeinsame Schiff schon im Sinken begriffen war, brachte man nach Star Spangled Banner Mussorgskys Nacht auf dem kahlen Berge, eine umfangreiche Suite aus Prokofieffs Romeo und Julia sowie Tschaikowskys Slawischen Marsch und – zum Schluss – die Pathétique unter Dach und Fach. Wie sollte der Tschaikowsky da noch so passioniert gespielt werden können wie der Prokofieff? Und wie hätten die Mendelssohn-Symphonien noch jene Frische haben können, die sie im Konzert hatten? Ganz abgesehen davon, dass es auch kaum Zeit für Nachkorrekturen gab und möglichst alles sofort reibungslos zu klappen hatte. Es ist also ein schlichtes Wunder, dass die meisten dieser Einspielungen trotzdem zum Fesselndsten und Mitreißendsten gehören, was je auf Schallplatte gebannt wurde. Die Mendelssohn-Symphonien beispielsweise genießen bis heute Referenzstatus. Und die legendäre Aufnahme des Schönberg-Violinkonzerts mit Mitropoulos’ Freund Louis Krasner wurde – wie Krasner ausführlich geschildert hat – in der letzten halben Stunde eines ganztägigen Aufnahmeprojekts spontan eingeschoben, ohne die Gelegenheit zu auch nur einer minimalen Nachkorrektur.
Wir können daran sehen, wie widrigste Bedingungen die Menschen über sich selbst hinaus wachsen lassen, wie sie aber auch der langfristigen Stabilität einer Beziehung im Wege stehen und die Strahlkraft und Begeisterung auch großartigster künstlerischer Erlebnisse allmählich aushöhlen. Mitropoulos und sein Orchester haben sozusagen Übermenschliches geleistet, und am Ende hat man ihn dafür verflucht und sich seinem Zögling Leonard Bernstein, der ihn letztlich auch verriet, an die Brust geworfen. Zumal Bernstein das damals so gefährliche Thema seiner Homosexualität mit einer glanzvollen Heirat kaschierte, wogegen Mitropoulos, der stets lebte wie ein Mönch, wegen seiner homosexuellen Veranlagung ins Gerede geriet. Insofern ist die nun vorliegende CD-Anthologie nicht nur ein später Triumph seiner unnachahmlichen Kunst, sondern auch ein Akt dessen, was man Wiedergutmachung nennt.

Es ist nicht einfach, Highlights aus dieser Sammlung zu benennen. Viele, darunter die Opernaufnahmen wie Bergs Wozzeck, Barbers Vanessa, Mussorgskys Boris Godunov oder Verdis Maskenball – allesamt mit Traumbesetzungen –, wie seine Berlioz-, Scriabin-, Prokofieff- oder Schostakowitsch-Einspielungen, Schönbergs Erwartung mit Dorothy Dow oder das 5. Beethoven-Konzert mit Robert Casadesus galten sofort als maßstabsetzend und sind es bis heute geblieben. Andere sind weniger bekannt geworden, und unter diesen möchte ich besonders die hinreißende Aufnahme von Tschaikowskys 1. Orchestersuite erwähnen, mit ihrem frappierend fugierenden Kopfsatz, der zu seinen symphonischen Gipfelleistungen zählt und hier mit maximaler Differenzierung, Spannkraft und bezwingend organischer Geschlossenheit dargeboten wird; eine feine, in ihrer erfüllten Unschuld besonders berührende Aufnahme des 3. Beethoven-Konzerts mit dem jungen Jean Casadesus; Dukas’ Zauberlehrling und die Schumann-Symphonien. Oder die nur mit Hilfe unabhängiger Funds eingespielten Symphonien Nr. 2 von Roger Sessions und Nr. 3 von Peter Mennin sowie das Symphonic Allegro des jungen Roy Travis. Besonders Mennins Dritte – vom meines Erachtens bedeutendsten Symphoniker, den die USA hervorgebracht haben – ist auf die Fähigkeiten Mitropoulos’ geradezu ideal zugeschnitten: unaufhaltsames Momentum in den Ecksätzen, dabei ständig in vollem Auskosten der Sensitivität der Tonbeziehungen, von flammendem Leben erfüllt. Und verinnerlichter Fluss, Palestrina-artiges Verständnis des kontrapunktischen Gewebes in modernem Harmoniegewand im lyrischen Mittelsatz. Da findet man auch die Verbindung zum Komponisten Mitropoulos, wie sie in der lyrischen Ekstase des 19jährigen im Orchesterstück Taphé (Begräbnis) mitzuerleben ist, von welchem bei YouTube eine wunderbar einfühlsam disponierte Aufführung unter Ioannis Protopapas vorhanden ist. Oder in seinem letzten Orchesterwerk, dem gnadenlos über Stock und Stein jagenden, quasi den mittleren Bartók vorwegnehmenden Concerto grosso von 1928, welches unlängst in einer Neuaufnahme bei Bridge Records veröffentlicht wurde. Wie sehr bedaure ich, dass Mitropoulos selbst sich nicht mehr um seine eigenen Kompositionen kümmerte, wie dies Furtwängler und de Sabata gelegentlich und selbst Celibidache bei einer Gelegenheit getan haben. Doch das Vermächtnis Mitropoulos’ ist – auch wenn er kaum Skalkottas dirigiert hat und seine Aufführungen großer Werke seiner Landsmänner Perpessas und Petrides nicht ins Aufnahmestudio mitbrachte – eine gigantische Lebensleistung, und was in dieser Anthologie von den von ihm so geliebten Meistern Mahler, Strauss, Schönberg, Krenek oder Schnabel fehlt, kann man großenteils in seinen Live-Aufnahmen nacherleben. Und es steht außer Zweifel, dass – wenn man die Entstehungsbedingungen der Columbia-Aufnahmen in Betracht zieht – der Unterschied zwischen Konzert- und Studioaufnahmen bei ihm nicht größer war als etwa bei Celibidache die Differenz zwischen Konzerten und Aufnahmen in den Rundfunkstudios. Es ist eigentlich immer live, wie es die Musik ihrem Wesen nach seit jeher ist.
[Christoph Schlüren, Dezember 2022]
