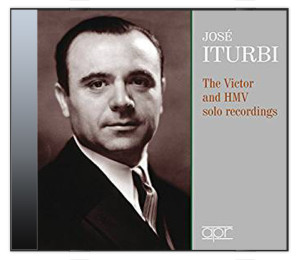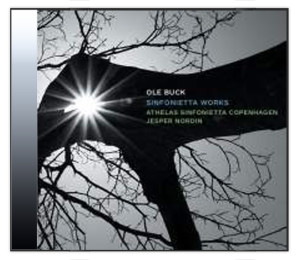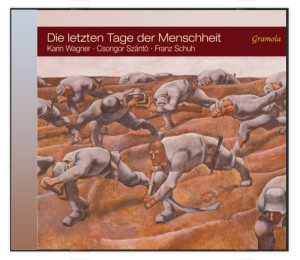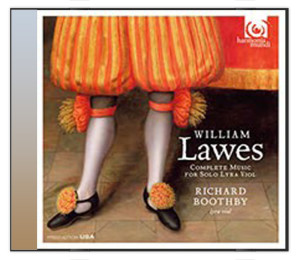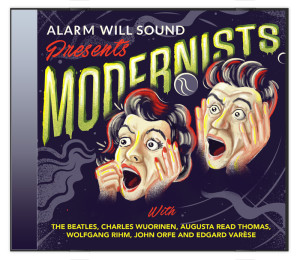Benjamin Brittens Oper „A Midsummer Night’s Dream“ erlebte in einer neuen Inszenierung von Sam Brown ihre Première im Theater Trier (Teatrier) am 24. September 2016, weitere Vorstellungen gibt es bis zum 30. Oktober. Es wirken das Philharmonische Orchester der Stadt Trier sowie der Kinder- und Jugendchor (geleitet von Martin Folz) und Statisterie (einstudiert von Christian Niegl) des Theater Trier unter Leitung von Generalmusikdirektor Victor Puhl mit.
Die Bühne machte Simon Lima Holdsworth, Loren Elstein war für Kostüme verantwortlich, Choreograph war Hannes Langolf. Die Rollen waren folgendermaßen besetzt: Benjamin Britten (Prolog): Benjamin Popson, Indischer Junge: Luis Grammatikou, Oberon: Fritz Spengler, Titania: Frauke Burg, Puck: Paul Hess, Theseus: László Lukács, Hippolyta: Bernadette Flaitz, Lysander: Benjamin Popson, Demetrius: Bonko Karadjov, Hermia: Clare Presland (singend) / Ulrike Malotta (spielend), Helena: Eva Maria Amann, Zettel/Pyramus: Don Lee, Quenz/Prolog: Lukas Schmid, Flaut/Thisbe: Rouwen Huther, Schnock/Löwe: Eui-Hyun Park, Schnauz/Wand: Wolfram Winter, Schlucker/Mond: Carsten Emmerich, Spinnweb: Emilia Scharf, Bohnenblüte: Lina Schankweiler, Senfsamen: Zoë Salm, Motte: Laetitia King, Flötenelfe: Clara Folz.
Welch ein großes Ereignis ist eine solche Première für die Stadt Trier! Ein Theater mittlerer Größe führt nicht alle Tage eine groß besetzte, abendfüllende und nur mit größtem Aufwand überhaupt zu realisierende Oper des 20. Jahrhunderts auf wie „A Midsummer Night’s Dream“ von Benjamin Britten nach William Shakespeare auf Libretto eigener Feder unter Mithilfe von Brittens Lebensgefährten und Gesangspartner Peter Pears (mit welchem wundervolle Aufnahmen entstanden, gerade die Liederzyklen Schuberts mit Britten und Pears gehören zu den besten Einspielungen überhaupt). Und Trier machte ein wahres Spektakel daraus, hat tatsächlich alle erdenklichen Mittel aufgefahren, den Abend zum ‚Ereignis’ avancieren zu lassen.
Nach einem stimmungsvollen Prolog, dem eigentlich nicht zur Oper gehörigen, sondern durch die Inszenierung Sam Browns hinzugefügten Lied „The Wanderings of Cain“ (Gedicht: Samuel Taylor Coleridge; aus Brittens Nocturne für Solotenor, sieben obligate Instrumente und Streichorchester Op. 60), öffnet sich der Vorhang und gibt eine bezaubernde Bühnengestaltung preis. Bäume schmücken eine von Simon Lima Holdsworth gestaltete Drehbühne, die durch einen mittig platzierten Hügel zwei Einzelbühnen realisiert, um organische Szenenübergänge ohne Umbau zu ermöglichen. Hinreißende Details wie Klappen im Hügel, aus dem Elfen zum Tanz kommen, oder ein phänomenal blendender Sonnenaufgang (sehr hell für die Zuschauer!) ziehen in ihren Bann. Die Inszenierung ist herrlich, wie ein Traum, abwechslungsreich und farbig schillernd, ebenso die elegant eingebetteten Choreographien von Hannes Langolf.
Stiller Star des Abends ist und bleibt unangefochten Paul Hess als Puck. Zwar hat er nicht eine Note zu singen, doch in seiner Sprechrolle überzeugt er vollkommen. Und noch weitaus mehr mit seinen choreographischen Fähigkeiten: Schon schwingt er sich auf einen Baum, dann fliegt er an Seilen befestigt über die Bühne, unerwartet springt er vom Hügel und rollt sich mit federnder Leichtigkeit ab, dann umschmeichelt er wieder zart seinen Herren Oberon. Puck ist omnipräsent in Browns Inszenierung und verleiht ihr das Phantastische, Märchenhafte, das wesentlich zum Gesamteindruck beiträgt.
Leider indisponiert ist an diesem Abend Fritz Spengler als Oberon. So filigran und übernatürlich könnte die Rolle sein, wäre sie nicht wie hier ohne jeden Glanz, ohne Farbigkeit oder Klangfülle gesungen. Oberon ist die Rolle eines lupenreinen und doch bestimmten, herrschaftlichen (teils überraschend tief gesetzten) Countertenors und nicht die einer heißeren Kopfstimme mit Intonationsschwierigkeiten. Umso mehr fällt dies auf, wenn neben ihm seine Elfenpartnerin Frauke Burg als Titania steht, die mit ihrem brillanten Koloratursopran die Halle zum Schwingen bringt, dass man meinen möchte, alles Glas würde bald zerspringen. Eine vielversprechende Begabung, von der wir noch einiges hören könnten. Überzeugend sind auch die Liebespaare Lysander (Benjamin Popson) und Hermia (Clare Presland, Ulrike Malotta) sowie Demetrius (Bonko Karadjov) und Helena (Eva Maria Amann). Hervorstechen konnte hierunter zumal Clare Presland, welche erst am Premierentag aus London eingeflogen wurde, um der erkrankten Ulrike Malotta ihr Stimme zu leihen. Diese übernahm die gespielte Rolle und bewegte ihren Mund, von der Seite synchronisierte Presland mit so elegantem wie stimmgewaltigem Mezzo-Sopran von atemberaubender Schönheit.
Die Handwerker (Don Lee, Lukas Schmid, Rouwen Huther, Eui-Hyun Park, Wolfram Winter, Carsten Emmerich) waren es, die sich am meisten in die Herzen der Zuschauer sangen. Ihre Rollen sind so herrlich komödiantisch und vielseitig, so charmant tollpatschig und liebenswert geschrieben, dass man sie einfach mögen muss. Vielleicht sind diese Sänger stimmlich nicht die sonorsten, textverständlichsten oder sinnlich überwältigendsten, doch passen sie sich allesamt bestens in ihre Rollen ein und spielen aus voller Überzeugung und mit Herzblut. Stimmlich beeindruckt hat von ihnen am meisten Don Lee als Zettel und Pyramus, der gerade in seiner Eselsgestalt so wunderbar seine Stimme überschlagen lassen kann und sogleich wieder lupenrein weiterzusingen vermag. Auch Flaut beziehungsweise Thisbe, gesungen von Rouwen Huther, überrascht mit seiner wandelbaren Stimme, die er so schön falsch klingen lassen kann, wenn es auf diese Art von Britten vorgesehen ist (der erste Einsatz von Thisbe, die nervös auftritt und deshalb in einer falschen Tonart beginnt). Allgemein charakterisiert die Handwerker, dass sie – sofern angebracht – ihre Passagen mit übermäßiger Unkultiviertheit und überzogener Laienhaftigkeit würzen, wie es die Rollen eben auch verlangen, was für etliche Lacher sorgt.
Bezaubernd sind auch die Jüngsten auf der Bühne, der Kinder- und Jugendchor des Theater Trier, und die daraus hervortretenden Gesangssolisten. Schon die Kleinsten beherrschen die teils aufwändige Choreographie und singen komplett auswendig, eine beachtliche Leistung!
Doch warum ist die Klangbasis teils so farblos, matt, uninspiriert oder gar ängstlich? Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier bietet nicht den facettenreichen Boden, auf dem sich die Sänger ungezwungen entfalten können – dabei bleibt doch nicht zu überhören, dass die Musiker ihre teils äußerst heiklen Passagen gut bewältigen und musikalisch wesentlich mehr herausholen könnten als geschehen. Generalmusikdirektor Victor Puhl scheint seinen Musikern nicht das Feuer überreicht zu haben, die Musik lebendig zu entfalten und aus sich herauszugehen, frei und mutig zu agieren. Statt dessen gibt es nur Notenleserei, die gerade bei den pikanten Glissando-Passagen recht zittrig wird. Puhl könnte so leicht seine graue Routine ablegen, könnte aus dem mittelmäßigen Alltags-Geschäft emporsteigen – es wäre so einfach! Wenn Victor Puhl mit innerer, zerreißender Leidenschaft an die Proben gehen würde, seine Musiker mitzureißen und zu überzeugen vermöchte, wenn er sie vielleicht noch mit herausgemeißelten Details in den Unterstimmen und mit einer lebendigen Musikvorstellung zu überraschen wüsste, dann könnte aus dem teils recht faden und eintönig-introvertierten Orchester in kurzer Zeit ein wirkliches Orchester von Rang werden, Fortschritte wären sicher schon bis zur letzten Vorstellung Ende Oktober sichtbar! Das musikalische Erwachen lohnt sich! (Ebenso wie die große Passage des Erwachens der Liebenden, in einem Eulenspiegel’schen Scherz unterlegt mit einer verzerrten und doch unverkennbaren Reverenz an Strawinskys Sacre!)
Es ist beachtlich, was die Trierer an diesem Abend auf die Beine gestellt haben, diese riesenhafte Oper inklusive informativer Einführung vor dem Konzert durch Peter Fröhlich und ausgedehnter Premierenfeier hinterher, wo alle Beteiligten noch einmal auf die kleine Foyer-Bühne durften. Gerade die ungezwungene Musikalität und Freude mancher Sänger wird mir im Gedächtnis bleiben, fernab von der überkünstelten, makellos polierten Art der heutigen Starsänger, dafür mit wesentlich mehr Esprit.
[Oliver Fraenzke, September 2016]