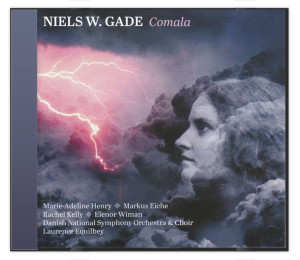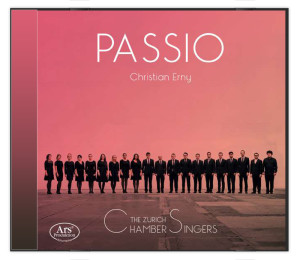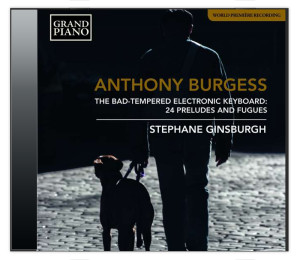Zala Kravos kann das Wort Wunderkind nicht wirklich verstehen. Eigentlich sei doch jedes Kind ein Wunder, das über riesige Anlagen verfügt. Und sie selbst ist dankbar, dass sie Menschen hat, die ihre eigenen Gaben auf denkbar beste Weise entdeckt und gefördert haben. So sehr, dass die gebürtige Slowenin bereits im zarten Alter von 15 Jahren ein gewichtiges CD-Debut vorliegt. Nicht nur mit Brahms, Liszt und Chopin, sondern auch mit Neuer Musik.
Das Interview führte Stefan Pieper
Ich bin sehr überrascht, mit welcher Reife Sie diese vielschichtigen, anspruchsvollen Werke musizieren! Ich bin neugierig auf die Vorgeschichte dazu!
Das alles ist natürlich eine große Herausforderung für mich. Aber das einzige Stück, das ich jetzt neu erarbeitet habe, ist die Ballade von Franz Liszt. Die anderen Stücke begleiten mich schon viele Jahre lang. Mit der Brahms-Ballade habe ich im Alter von 11 Jahren begonnen,
Chopin habe ich sogar schon mit 10 gestartet, ich habe sie also schon im ganz jungen Alter gespielt. Die Ballade Nr. 2 von Franz Listz ist noch sehr neu. Ich denken, man kann einen Unterschied hören.
Ich muss zugeben, dass dieser Unterschied nicht sofort ins Ohr springt. Warum haben Sie gerade diese Werke ausgewählt? Balladen wollen ja immer eine Geschichte erzählen.
Diese Werkauswahl kommt meinem künstlerischen Anliegen sehr nah. Als Musiker sollte man eine Geschichte zu erzählen haben, das ist doch das wichtigste. Es geht darum, etwas zu sagen zu haben, dass jemand versteht. Ich bin glücklich,wenn das Publikum hört, dass ich etwas zu sagen habe.
Die Balladen von Brahms und Liszt sind ja von literarischen, also außermusikalischen Quellen beeinflusst. Haben Sie die Texte, die allem zugrunde liegen, gelesen?
Das habe ich mit großer Begeisterung getan. Vor allem Gottfried Herders Ballade „Edvard“ hat mich sehr fasziniert. Ich versuche in meinem Spiel, die Musik und die Aussage der Texte zu verbinden. Liszt war sehr stark von Dante inspiriert. Solche Hintergründe sind sehr wichtig für mich. Ich versetze mich gerne in die Psychologie des Komponisten hinein.
Ich gehe mal davon aus, dass Ihnen das Lesen viel bedeutet. Haben Sie genug Zeit dafür neben dem Üben?
Es ist gut, dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann. Ich kann für mich entscheiden, wann der beste Zeitpunkt zum Üben ist und kann tun, was ich will. Ich versuche bewusst, die Zeit-Killer zu vermeiden und achte drauf, nicht zu viel Zeit am Telefon oder vor Bildschirmgeräten zu vergeuden. Dadurch habe ich Zeit zum Lesen, was ich auch regelmäßig in verschiedenen Sprachen tue, auf französisch, slowenisch, englisch.
Sprachen sind also eine weitere Leidenschaft von Ihnen?
Ja, Sprachen sind für mich wie Musik. Wenn man zweisprachig aufgewachsen ist, kommt so was ganz von selbst. Mein Vater ist Slowene, meine Mutter Chinesin . Die Sprachen, die sie sprechen, können nicht unterschiedlicher sein. Ich möchte am liebsten alle Sprachen lernen.
Wie sieht es eigentlich mit der Schule aus?
Ich besuche keine allgemeine Schule mehr. Ich lerne über ein französisches Home-Schooling -Programm, wo ich online lernen und auch die Prüfungen absolvieren kann.
Sind Ihre Eltern auch Musiker? Diese Vermutung liegt ja nahe bei dieser extrem frühen Begeisterung, diesem Engagement und dieser hervorragenden Förderung?
Ich habe völlig ohne Druck und mit großer spielerischer Leichtigkeit in die Musik hinein gefunden. Meine Eltern sind keine Musiker. Meine Mutter kommt aus der Naturwissenschaft, aber mein Vater war früher ein begeisterter Liebhaber-Musiker, der vor allem Gitarre spielte. Er verbreitete dabei eine Begeisterung, die auf mich über gegangen ist. Aber er hat mir nie von sich aus gesagt, ich soll ein Instrument spielen. Ich muss ein oder zwei Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal ein Konzert erlebte. Ich war fünf, als mein Vater mich fragte, ob ich ein Instrument spielen möchte. Ich habe dann das Klavier gewählt. Alles war so einfach. Allerdings konnte ich mich ganz zu Anfang nicht zwischen Klavier und Harfe entscheiden.
Was ist für Sie der wichtigste Aspekt beim Musikmachen?
Klavierspielen sehe ich nicht absolut. Es ist vielmehr ein Teil eines großen Ganzen. Ich möchte immer auch die Geschichte und den Hintergrund von den Dingen, die ich tue, erfahren. Vor allem ist es mir wichtig, möglichst viel mit Menschen zu kommunizieren. Das Leben bietet doch so eine große Vielfalt. Es ist schön, dass man nie aufhört, neues zu erfahren und zu lernen. Das macht das Leben doch erst interessant. Und es ist wichtig, ein Leben für sich zu haben und nicht nur immer zu arbeiten und zu üben. Nur dadurch kann man sich einen offenen Geist erhalten.
Wie gehen Sie mit den ständigen Titulierungen als „Wunderkind“ um?
Ich bin doch nicht wirklich etwas besonderes. Ich treffe mich gerne mit Freunden und führe ein ganz normales soziales Leben. Wer nur übt und nichts anderes tut, engt sich ein und kann sich nicht weiter entwickeln. Gerade als Musikerin ist es ungemein wichtig, kommunikativ aufgeschlossen zu sein. Ich denke, jeder Mensch ist ein Wunder für sich!
Sie stellen dem balladesken romantischen Bogen von Brahms, Liszt und Chopin das Stück „Crystal Dream“ von Albena Petrovich-Vratchanska gegenüber. Was bedeutet Ihnen diese Komponistin? Ich rate mal, dass Sie sich auch schon persönlich begegnet sind in Luxemburg?
Albena ist eine sehr wichtige Person für mich. Sie zeigte mir so viel Neues auf, was zeitgenössische Musik ist und sie half mir, meine Karriere zu entwickeln. Sie ist eine gute Freundin, die mir so viel gab. Ich bin ihr sehr dankbar.
Also ist Crystal Dream exklusiv für Sie geschrieben worden?
Wir kennen uns nun schon seit zehn Jahren, also seit meiner frühen Kindheit. Sie hat mich so oft spielen gehört und sie erkannte meine Leidenschaft für Musik, was sie wiederum sehr für ihr eigenes Komponieren inspirierte. Deswegen hat Albena das Stück Crystal Dream auch exklusiv für mich geschrieben. Sie wollte mir damit etwas aufzeigen. Nämlich, dass Musik eben viel mehr ist als nur der eng definierte Begriff in der klassischen oder romantischen Musik. Sie wollte mir neue Wege auf den eigenen Weg mitgeben. Überhaupt gibt es in der zeitgenössischen Musik so unendlich viel zu entdecken – sowohl für den Hörer, als auch für den Spieler! Aber viele Menschen haben erst mal Angst der Musiker der Gegenwart und denken, dass man hochspezialisiert sein muss, um sie zu verstehen. Als Musikerin bin ich bei einem modernen Stück wie Crystal Dream herausgefordert, Musikmachen wieder ganz neu zu lernen. Dieses Stücke soll die Kreativität herausfordern. Die Partitur forderte mich dazu auf, meine eigene Halskette auf die Klaviersaiten zu legen, was einen ganz besonderen Klangeffekt produziert. Ich habe so etwas noch nie vorher gemacht. Das war schon eine Art Schlüsselerlebnis für mich, um mich der Neuen Musik zu öffnen. Von da an habe ich mir viele weitere zeitgenössische Stücke erschlossen.
Ich denke, gerade junge Menschen können sie spielen und auch besonders gut hören, weil es hier noch nicht so viele eingefahrene Hörgewohnheiten gibt.
So sehe ich das auch. In diesem Alter ist noch eine große Offenheit da. Der Zugang ist viel leichter als später. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig, in möglichst jedem Programm ein Stück aus der Gegenwart zu interpretieren. Ich möchte einfach mithelfen, jene Hemmschwelle abzubauen, die nach wie vor der zeitgenössischen Musik anhaftet.
Wie sind Sie nach Luxemburg gekommen und was gefällt Ihnen hier?
Luxemburg ist ein so kleines Land, da kennt jeder jeden. Die Konzentration von Musikern ist sehr hoch und wir helfen uns untereinander. Hinzu kommt die hervorragende öffentliche Förderung, die junge Musiker hier genießen. Ich glaube, das ist in kaum einem anderen Land so.
Haben Sie auch bei Jean Muller studiert?
Ich studiere bei Jean Muller in Luxemburg, und Jean Muller ist auch als Mensch sehr wichtig für mich mich. Es war seine Idee, jetzt mein erstes CD-Album aufzunehmen. Er hat mich außerdem eingeladen, ein Solokonzert mit dem Luxemburger Philharomischen Orchester zu spielen. Auch das war eine großartige Erfahrung.
Was reizt Sie an Ihrem Musikerberuf, in dem Sie ja schon längst angekommen sind?
Was ich ganz besonders liebe, ist das Reisen. Ich bin schon so viel gereist und kann nicht genug davon bekommen. Ich habe in 14 verschiedenen Ländern Konzerte gegeben. Profimusiker müssen ständig reisen. Es gibt manche Musiker, die das nicht mögen, was ich gar nicht verstehen kann. Zu dieser Sorte gehöre ich um Glück nicht!
Was für einen Bezug haben Sie zu Ihrer slowenischen Heimat?
Ich reise sehr oft dahin, weil viele unserer Familienmitglieder dort leben. Ich gebe dort auch manchmal Konzerte. Ich liebe dieses Land – vor allem die warme Freundlichkeit der Menschen dort.
Es gibt ja diesen etwas mystischen Brauch, dass jede Slowenin und jeder Slowene einmal im Leben den Triglav, Sloweniens höchsten Berg bestiegen haben muss.
Das stimmt. Der Brauch sagt sogar, dass kein echter Slowene ist, wer nicht auf dem Triglav war.
Haben Sie das schon absolviert?
Nein, bislang habe ich es noch nicht getan, aber ich möchte es auf jeden Fall gerne. Man sollte sehr gut durchtrainiert sein. Vielleicht werde ich es mit meiner Familie in den kommenden Sommerferien tun.
Gibt es auch musikalische Berge, die Sie als nächstes besteigen wollen?
Ja, durchaus! Ich möchte mir gerne das weite Feld der Kammermusik erschließen, was noch weitgehend Neuland für mich ist. Ich habe bereits im letzten Jahr einige Kammermusik gespielt und werde bald damit auf Tour gehen – und zwar in Luxemburg, Spanien und Deutschland. Organisiert wird die Tour von der EMCY (European Union of Music Competitions for Youth), ich werde hier mit vielen anderen Musikern aus verschiedenen Ländern zusammen spielen.
[Stefan Pieper, März 2018]