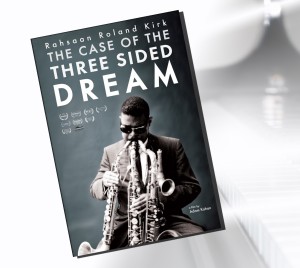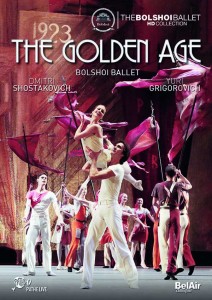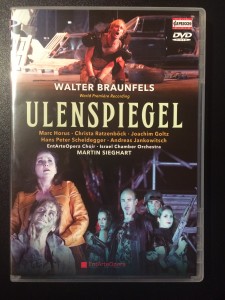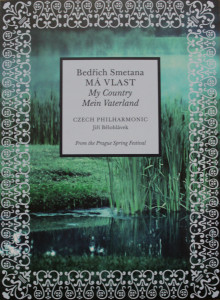Über YouTube entdeckte ich das Stück „Prosperos Beschwörungen“ op. 53 von Egon Wellesz nach Shakespeares „Der Sturm“ mit Jörg Birhance als Dirigent des Orquesta Sinfónica de Xalapa.
Eines der wahrlich bedeutenden Stücke der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts taucht wieder auf. Auch wenn aufgrund mangelnder finanzieller Förderung an ein CD-Projekt noch lange nicht zu denken ist, so kann man es nun wenigstens über YouTube hören.
Die Rede ist von den fünf symphonischen Stücken mit dem Titel „Prosperos Beschwörungen“ op. 53 nach Zitaten aus Shakespeares „Der Sturm“ aus der Feder des Komponisten und Musikwissenschaftlers Egon Wellesz. Heute vollkommen in Vergessenheit geraten, zählte Wellesz vor Ausbruch des 2. Weltkriegs als einflussreicher Tonsetzer und Musikschriftsteller. Er promovierte bei Guido Adler und entzifferte als erster die byzantinische Notenschrift des Mittelalters, zudem schrieb er die früheste Biographie über Schönberg, bei dem er zwei Jahre lang Kontrapunkt studierte. Als Wellesz „Prosperos Beschwörungen“ komponierte, wirkte er gerade als außerplanmäßiger Professor an der Universität Wien und wurde als erster Komponist aus Österreich nach Haydn zum Ehrendoktor in Oxford ernannt. Als die Nationalsozialisten Österreich übernahmen, emigrierte der jüdischstämmige Wellesz als „entarteter“ Komponist nach England, wo er nach dem Krieg begann, sich der Symphonik zuzuwenden und neun maßstabgebende Gattungsbeiträge vollendete.
„Prosperos Beschwörungen“ wurden zwischen 1934 und 1936 komponiert, die Uraufführung fand am 19. Februar 1938 im Wiener Musikverein statt, wo Bruno Walter die Wiener Philharmoniker dirigierte. Walter nahm die Stücke sogleich auch für sein kommendes Konzertprogramm in Amsterdam auf, wo sie Strauss‘ „Tod und Verklärung“ ersetzten. Wellesz konnte nach der Aufführung nicht mehr nach Österreich zurückkehren, da die Nationalsozialisten die Herrschaft bereits an sich gerissen hatten.
Dass dieses Stück dank des immensen Einsatzes von Jörg Birhance (den ich vor einigen Jahren bereits mit Wellesz‘ Erster Symphonie erleben durfte) nun wieder erklingt und das Konzert sogar mit Video aufgenommen wurde, gibt Grund zur Hoffnung, den Namen Wellesz bald öfter wieder zu lesen.
Die fünf Sätze beruhen auf Zitaten aus Shakespeares „Der Sturm“ und heißen „Prosperos Beschwörung“, „Ariel und der Sturm“, „Ariels Gesang“, „Caliban“ sowie „Ferdinand und Miranda“ mit Epilog. Bei einem Blick in die Partitur sticht unmittelbar die enorme Detailvielfalt ins Auge, mit der Wellesz seine Noten versehen hat. Die Tempi sind minutiös ausgearbeitet, über große Strecken ist sogar in Sechzehntelnoten zu schlagen und die einzelnen Stimmen differenzierte er bis in die Vierundsechzigstelebene aus. Dabei gibt sich die Musik dicht und intensiv, die brillante Instrumentation mit geschickten Dopplungen und Klangkombinationen besticht. Die durchchromatisierten Linien sowie die dissonanzengeschwängerten Harmonien evozieren eine unwirkliche bis magische Sphäre, die schwer greif- oder durchdringbar ist, dafür aber umso direkter wirkt. Fast durchgehend laufen verschiedene Ebenen in der Musik zeitgleich ab, die zueinander in Beziehung stehen, ohne auf Anhieb passen zu wollen – eine Art Ausgangspunkt für eine „neue“ Kontrapunktik.
Jörg Birhance beweist nicht nur den Mut, solch ein gewaltiges und enorm komplexes Werk aufs Programm zu setzen, sondern auch, die extremen Tempi einzuhalten – weshalb das Stück auch zehn Minuten länger dauert als in der Partitur ausgeschrieben. Doch diese Zeit füllt Birhance auch aus, mit hinreißender Spannung, die einen alles um sich herum vergessen machen. Er fügt die auseinanderklaffenden Stimmen in ihrer Verschiedenheit zusammen, setzt feine Akzente und entlockt dem Orchester einen plastisch-mehrdimensionalen Klang. Zwar mag das Orquesta Sinfónica de Xalapa nicht die mechanisch-technischen Voraussetzungen der großen europäischen Orchester haben, was sich bei der Synchronizität gerade der Bläser abzeichnet, dafür besitzen sie die Offenheit, diese fünf Stücke auf sich wirken und sich auf ihre Eigentümlichkeit einzulassen. Sie setzen den Perfektionismus Birhances um bis in die ausdifferenziertesten Artikulationen, Dynamiken und Rhythmen. Spätestens im Epilog fügt sich dann alles zusammen, wenn die Rückbezüge auf die vorherigen Sätze zu einer formalen Geschlossenheit führen.
[Oliver Fraenzke, August 2019]