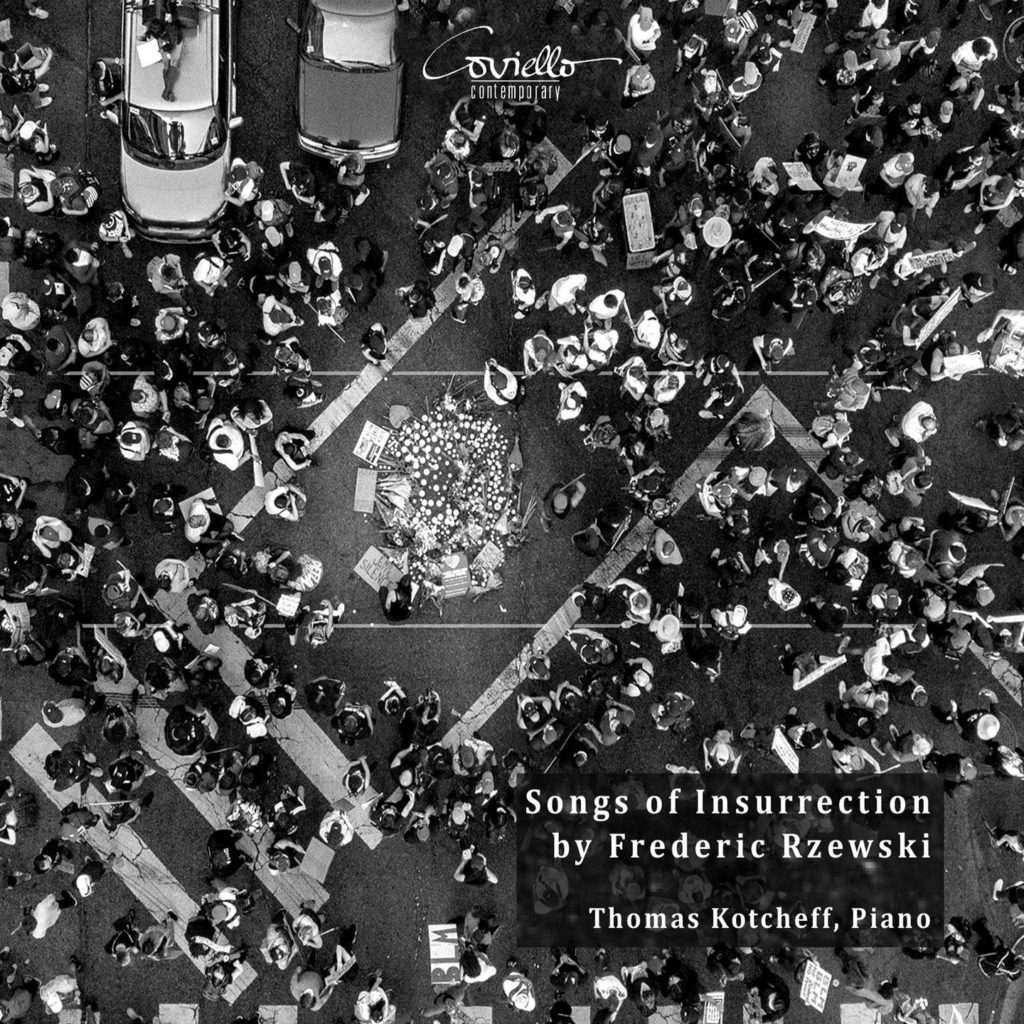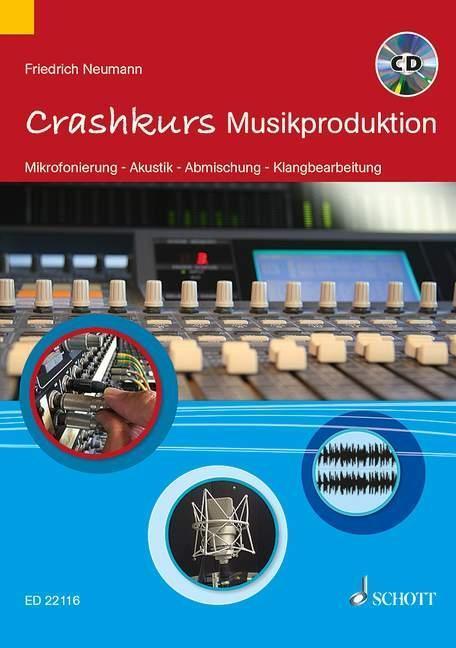70 Jahre sind seit dem Tode des Historikers und Bibliothekars Wilhelm Altmann (1862–1951) vergangen. Als leidenschaftlicher Kammermusiker unternahm er es, die Literatur für Kammerensembles zu sichten und in mehreren Handbüchern den Streichquartett-, Klaviertrio-, Klavierquartett- und Klavierquintettspielern vorzustellen. Es ist an der Zeit, an diesen verdienten Mann zu erinnern, dessen Bücher einen Springquell musikalischer Anregungen darstellen.
Wilhelm Altmann wurde als Sohn eines Pfarrers am 4. April 1862 in der Kleinstadt Adelnau geboren, die damals zur preußischen Provinz Posen gehörte und heute unter dem Namen Odolanów Teil der Woiwodschaft Großpolen ist. Seine Eltern waren musikliebende Menschen, denen es selbstverständlich war, ihren Sohn von klein auf mit der Tonkunst in Berührung zu bringen. Der Junge erlernte Bratsche und Violine, spielte frühzeitig Kammermusik und wirkte während seiner Primanerzeit in Breslau als Orchestergeiger an Opernaufführungen mit. Nach dem Schulabschluss entschied er sich für eine Laufbahn als Historiker und studierte in Marburg und Berlin Geschichte, Philologie und Staatswissenschaften. An der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität, wurde er 1885 Assistent des greisen Leopold von Ranke und promovierte im selben Jahr über Die Wahl Albrechts II. zum römischen Könige. Anschließend war er an den Universitätsbibliotheken in Breslau und Greifswald tätig. In Greifswald habilitierte er sich 1893 und arbeitete als Privatdozent. Er genoss bald den Ruf eines Spezialisten für die Geschichte des späten Mittelalters und wurde mit der Herausgabe der Urkunden Kaiser Sigmunds betraut, die 1896–1900 in der renommierten Reihe Regesta Imperii erschienen.
Während all dieser Jahre hatte Altmann die Musik keinesfalls zurückgestellt. Im Gegenteil: Jede sich in seiner Freizeit bietende Gelegenheit zu musikalischer Betätigung wusste er am Schopfe zu packen. Dies beschränkte sich nicht nur auf das Kammermusikspiel. So gründete er 1890 in Greifswald ein Liebhaber-Orchester und dirigierte es bis 1895. Um die Jahrhundertwende schließlich begann der musizierende Bibliothekar sich zu dem Musikbibliothekar und Musikschriftsteller zu entwickeln, als der er in bleibender Erinnerung geblieben ist. Regelmäßig veröffentlichte er nun Rezensionen neu erschienener Kammermusikwerke, die er zuvor gemeinsam mit befreundeten Amateur-, aber auch Berufsmusikern, aus eigener Praxis kennen gelernt hatte. Im Jahr 1900 wurde Altmann zum Oberbibliothekar der Königlichen Bibliothek in Berlin ernannt, seit 1905 durfte er sich Professor nennen. In dieser Position begann er, ein Projekt ins Werk zu setzen, für das er mit seinem 1903 in der Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft veröffentlichten Vortrag „Öffentliche Musikbibliotheken – Ein frommer Wunsch“ warb. Altmanns Ziel war die Einrichtung einer „Reichs-Musikbibliothek“, die „zum mindesten alle in Deutschland erschienenen musikalischen Werke in ihrer Urgestalt enthält, damit es endlich einen Ort gibt, wo man die Werke wenigstens jedes deutschen Komponisten, hoffentlich auch der meisten außerdeutschen, einsehen kann“. Die Musikverleger kamen seinem Aufruf, freiwillig Exemplare der bei ihnen erschienenen Musikwerke nach Berlin zu schicken, in solchem Maße nach, dass Altmann neue bibliothekarische Ordnungssysteme entwickeln musste, um das eingesandte Material effektiver einarbeiten zu können. 1906 konnte er die Gründung der „Deutschen Musiksammlung bei der Königlichen Bibliothek“ am Schinkelplatz verkünden. Als die Sammlung 1915 offiziell zur Musikabteilung der Bibliothek wurde, ernannte man Altmann zu ihrem Direktor. Dies blieb er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1927.
Seiner Dienstpflichten ledig, konnte er sich nun ganz auf die Musik konzentrieren und gab noch 1927 in Max Hesses Verlag, Berlin, sein Handbuch für Streichquartettspieler heraus. Den beiden Bänden, die die Quartettliteratur von Johann Sebastian Bach bis zu Günter Raphael und Kurt Thomas abdecken, folgte im Februar 1929 ein dritter Band über Streichtrios, -quintette, -sextette, und -oktette, Ende 1930 ein vierter zur Literatur für Streicher und Bläser. Zum Teil trug Altmann für diese Bücher Kritiken aus früherer Zeit zusammen, zum Teil sind sie die Frucht des intensivierten Musizierens, das dem Pensionär nun möglich war. „Daß ich schon jetzt diesen [dritten] Band vorlegen kann“, schreibt er 1929, „kommt nicht bloß daher, daß ich seit dem 1. Januar 1928 von allen Amtsgeschäften frei bin, sondern daß ich schon früher manche Vorarbeiten erledigt und in der glücklichen Lage mich befunden habe, selbst für die Oktette ohne weiteres geeignete Kräfte heranziehen zu können.“ Dem vierten Band schließlich gingen eineinhalb Jahre praktische Beschäftigung ausschließlich mit Musik für Streicher und Bläser voran.
Im Vorwort des Handbuchs legt Altmann ausführlich dar, was ihn zu dieser Arbeit bewog, und blickt zugleich auf sein Leben als nicht-berufsmäßiger Musiker zurück. Diese Ausführungen geben einen solch lebendigen Eindruck von der Persönlichkeit ihres Autors, daß im Folgenden ein längerer Auszug daraus wiedergegeben werden soll:
„Schon als ich in der Untertertia des Elisabeth-Gymnasiums in Breslau saß, hatte ich im väterlichen Hause als Bratschist u. a. sämtliche Haydnsche Quartette mitgespielt und mit besonderer Aufmerksamkeit damals und auch die nächsten Jahre den Quartettaufführungen gelauscht, die der leider später eingegangene Verein für klassische Musik vom 1. Oktober bis Ostern regelmäßig alle Wochen einmal durch tüchtige Künstler veranstaltete. Wenn ich in der Studentenzeit auch nicht ganz regelmäßig zum Quartettspielen gekommen bin, so habe ich es doch nie unterlassen; mitunter, da ich auch allmählich für die erste Geige herangereift war, habe ich das regelmäßige Wochenquartett möglichst durchgeführt, auch als ich 1900 nach Berlin übergesiedelt war und mich mehr und mehr als Musikkritiker und Musikschriftsteller betätigte; wenn ich Zeit hatte, habe ich auch gern in anderen Quartetten ausgeholfen. So mancher liebe Quartettgenosse und auch eine Künstlerin, die mit größter Hingebung bei mir zweite Geige jahrelang gespielt hat, ruht schon im Grabe. Allen aber, die mit mir durch „dick und dünn“, durch die Klassiker selbst bis zu den Atonalikern gegangen sind, kann ich gar nicht genug dankbar sein. Wir haben auch sehr viele in Vergessenheit geratene Werke gespielt und sind wohl an keinem, das irgendwelche Bedeutung hatte, vorbeigegangen.
Der Wunsch, den zahllosen Dilettanten-Quartettvereinigungen meine Erfahrungen mitzuteilen, ebenso auch Künstlerquartette, die oft von der einschlägigen Literatur viel weniger Kenntnis als Musikfreunde haben, auf beachtenswerte vergessene Werke hinzuweisen, trieb mich zur Abfassung des vorliegenden Werkes, das keinesfalls als eine wissenschaftliche Leistung angesehen und beurteilt werden darf. Es soll nur ein praktischer Führer sein, nicht etwa eine Geschichte des Streichquartetts, wenngleich ich es chronologisch nach dem Geburtsjahr der einzelnen Komponisten geordnet habe. […]
Meine zum Teil aus ganz verschiedener Zeit stammenden Urteile über die einzelnen Werke sollen durchaus als subjektive bewertet werden. Ich bin mir bewußt, daß manches Quartett, das ich als besonders wertvoll empfehle, von andern als belanglos beiseite geschoben wird. Trotzdem ich daran festhalte, daß die Klassiker, zu denen ich auch Brahms rechne, nach wie vor den größten Schatz des Quartettspielers bilden, habe ich doch stets den Quartetten wie überhaupt den Schöpfungen der lebenden Tonkünstler größtes Interesse gewidmet, den Auswüchsen der sogenannten Atonalitätsapostel gegenüber mich freilich ablehnend verhalten. Mag man mich deshalb als senil ansehen! Ich will und kann’s ertragen, umso mehr, als ich andererseits glaube, manchen lebenden Tonsetzer doch gefördert zu haben. […]
Vollständigkeit zu erstreben lag mir fern, ist auch kaum zu erreichen. Werke, die ich nicht gehört oder selbst gespielt habe, habe ich nur ausnahmsweise nach der Partitur besprochen, obwohl für mich ein bloßes Lesen, ohne den Klang zu hören, kein richtiges Bild abgibt.“
Dem Streichquartettspieler-Handbuch schlossen sich in den nächsten Jahren gleichartige Handbücher für Klaviertriospieler (1934), Klavierquartettspieler (1936) und Klavierquintettspieler (1937) an. 1935 gab Altmann zudem Albert Tottmanns in letzter Auflage 1902 erschienenen Führer durch den Violin-Unterricht, den er im Handbuch für Streichquartettspieler gelegentlich zitiert, in einer erweiterten Fassung, die auch die seit 1901 neu erschienenen Werke berücksichtigt, als Führer durch die Violin-Literatur neu heraus.
Altmann stand im 71. Lebensjahr, als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht gelangten. Seine publizistische Tätigkeit blieb von den veränderten politischen Umständen zunächst unberührt. So würdigte er nach wie vor in seinen Büchern die Leistungen von Komponisten jüdischer Abstammung wie Felix und Arnold Mendelssohn, Friedrich Gernsheim, Robert Kahn, Erich Wolfgang Korngold, wobei er Anton Rubinstein vorsichtigerweise im Handbuch für Klaviertriospieler als „arischen Sibirier“ etikettierte. 1940 allerdings machten die nationalsozialistischen Autoren Herbert Gerigk und Theophil Stengel in ihrem Lexikon der Juden in der Musik publik, dass Altmann jüdische Vorfahren hatte und nach NS-Terminologie als „Halbjude“ zu gelten habe. Infolge dessen wurde ihm Publikationsverbot erteilt. Altmann gelang es jedoch zu erreichen, dass der Präsident der Reichskulturkammer, Propagandaminister Goebbels, ihm eine Sondererlaubnis zur weiteren schriftstellerischen Betätigung erteilte, die ihn bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft vor weiteren Repressalien schützte. 1945 siedelte Wilhelm Altmann aus dem zerstörten Berlin in das niedersächsische Dorf Wesseln über. Er starb am 25. März 1951, kurz vor seinem 89. Geburtstag, in Hildesheim.
Die Musik war die lebensspendende Ader in Wilhelm Altmanns Dasein. Über Jahre mag sie verdeckt im Untergrund geschlagen haben, doch trat sie nach und nach immer stärker hervor, bis sie zuletzt sein Leben voll und ganz bestimmte. So sind auch seine Bücher Zeugnisse innigster Liebe zur Musik und zum Musizieren. Bereits vom Umfang her beeindruckt dieses Textkorpus, und noch größer wird die Achtung vor seinem Verfasser, bedenkt man, dass er den allergrößten Teil der Werke, die er darin bespricht, aus eigener praktischer Erfahrung kannte. Die Kammermusik-Handbücher sind somit auch Zeugnis einer lebenslang nie versiegenden Wissbegier. Altmann wollte möglichst viel Musik kennen und möglichst viel guter Musik helfen, zum Erklingen zu kommen. Die Besprechungen zeigen ihn als grundehrlichen Charakter, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält und deutlich ausspricht, was ihm zusagt und was nicht. Oft legt er dabei auch ein gutes Wort für solche Werke ein, die ihm nicht der öffentlichen Aufführung wert erscheinen, die er jedoch zum häuslichen Musizieren durchaus für geeignet hält – und mehrfach kann man sein Bedauern spüren, wenn er feststellen muss, dass sich ein Meisterwerk neuerer Zeit aufgrund zu hoher spieltechnischer Herausforderungen Dilettantenkreisen nicht mehr empfehlen lässt.
Altmanns Interesse erstreckte sich immer auch auf die Musik seiner Zeitgenossen. Der jüngste im Handbuch für Streichquartettspieler besprochene Komponist, Erwin Dressel, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des entsprechenden Bandes 20 Jahre alt, 47 Jahre jünger als Altmann selbst. In der Beurteilung zeitgenössischer Werke zeigt sich freilich, dass Altmann keineswegs einem radikalen Avantgardismus das Wort redete. Modernes Empfinden war für ihn unlösbar mit der Tradition verbunden, und Musik, in der er diese Verbindung nicht finden konnte, fand vor seinen Ohren keine Gnade. War es ihm allerdings möglich, sich in den Stil eines zeitgenössischen Werkes hineinzuversetzen, bejahte er es ausdrücklich. So gestand er etwa Artur Schnabel zu, in seinem Ersten Streichquartett „harmonische Wege ein[zuschlagen], die möglicherweise die Musik und ihre Ausdrucksmöglichkeiten weiterbringen“. Angesichts des „polytonalen, von Intonationsschwierigkeiten strotzenden“ Dritten Quartetts von Frank Bridge fragte er sich zwar: „Was würde wohl Meister Joseph Joachim über dieses Quartett zu Bridge gesagt haben, der in seinem Londoner Quartett eine Zeit Bratsche gespielt hat?“, erblickte jedoch „seelische Werte“ in dem Stück und empfahl Künstlervereinigungen, nicht daran vorüberzugehen. Auch über Bartók, Wellesz, Toch, Milhaud, Jarnach und Hindemith äußerte er sich anerkennend, wenngleich nicht in jedem Fall völlig zustimmend. Arnold Schönberg, Anton von Webern und Ernst Krenek dagegen blieben ihm fremd.
Altmann hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er über die Kompositionen, die er in seinen Büchern vorstellt, ganz subjektiv urteilt. Weder bei den „modernen“, noch bei den älteren Werken braucht man immer mit ihm einer Meinung zu sein. Aber man nehme seine Bücher als Anregungen, die Werkbesprechungen als Empfehlungen eines ungemein erfahrenen Musikers, der in seinem Leben viel gehört und viel gespielt hat! Darin besteht der immense Wert des Lebenswerkes, das uns Wilhelm Altmann hinterlassen hat.
Zur Zeit sind das Handbuch für Klaviertriospieler, das Handbuch für Klavierquartettspieler und das Handbuch für Klavierquintettspieler nur antiquarisch oder über Bibliotheken verfügbar. Keines dieser Bücher wurde bislang neu aufgelegt. Die vier Bände des Handbuchs für Streichquartettspieler wurden 1972, 45 Jahre nach der Erstausgabe der beiden ersten Bände, von Heinrichhofen’s Verlag, Wilhelmshaven, in zweiter Auflage herausgebracht, und sind heute über den Verlag Florian Noetzel GmbH zu beziehen.
[Nobert Florian Schuck, März 2021]