Das Reisen in andere Länder ist immer auch eine kulturelle Bereicherung, wenn man sich nur darauf einlässt. So war es für mich ein großer Gewinn, eine Rundreise durch eines der für mich schönsten und vielfältigsten Länder zu starten und dort alles nur Mögliche an musikalischen Impressionen in mich aufzunehmen, was sich einem als einfachem Touristen so bietet – in diesem Fall in Norwegen.
Die Musikgeschichte in diesem Land unterscheidet sich grundlegend von der aller anderen Länder. Norwegen ist ein absoluter Sonderfall. Zentraler Grund dafür ist die lange Unterdrückung des heutigen eigenständigen Königreichs zuerst unter dänischer Herrschaft von 1380, als der dänische König Olav Håkonsson Norwegen erbte, bis 1814, und anschließend bis 1905 in Personalunion mit Schweden. Dies hatte zur Folge, dass sich keine höfische Kunstmusik entwickeln konnte, dafür aber die Volksmusik sich wie an kaum einem anderen Ort ausprägen konnte. Natürlich gab es auch Kunstmusik vor der Besatzungszeit; die norwegische Musikgeschichte beginnt nachweisbar ca. 1500 vor Christus, wie Funde von Bronzehörnern zeigen, und auch Lieder aus der Wikingerzeit sind uns heute bekannt, doch herrschte ebenso hier in jüngerer Zeit ausländischer Einfluss vor: 1030 wurde Norwegen christianisiert und der gregorianische Choral eingeführt, der jedoch sehr bald ein nordisches Sonderleben zu führen begann, was im Choralsatz in parallel geführten Terzen ersichtlich ist statt wie auf dem Kontinent in Quint- und Quartparallelen. Während der Personalunion mit Dänemark war der Musikerberuf hauptsächlich ausländischen Stadtmusikanten vorbehalten, die selbstverständlicherweise ihre Musik importierten. So verwundert auch nicht, dass Norwegens frühestes Stück eines namentlich bekannten Komponisten, des Caspar Ecchienus (ca. 1550 – ca. 1600), im niederländisch-polyphonen Stil verfasst ist. Die Volksmusik beschritt einen gänzlich anderen Weg; seit dem Mittelalter finden sich aus sämtlichen Epochen Stoff und Gattungen, von Kæmpeviser – Kampfweisen (heroischen Balladen) – bis zu religiösen Liedern, von Hirtengesängen bis zu ersten dichterischen Formen in etwas späterer Zeit, findet sich alles in den Wurzeln der Volksmusik. Ausländischer kontinentaler Volksliedtanz wurde recht bald verdrängt von noch heute existierenden Tänzen, unter denen die wohl berühmtesten Springar oder Springdans genannt, Halling und Gangar sind. Besonders für den Solotanz der Männer, den Halling, gibt es heute etliche Wettbewerbe und sogar nordische Meisterschaften, in denen die Tänzer ihre akrobatischen Künste inklusive den so genannten Hallingkast, das Herunterschlagen eines Huts von einer hochgehaltenen Holzstange mit dem Fuß, unter Beweis stellen müssen. Begleitet werden sie dabei von dem urtypischen Instrument Hardingfele (Hardangerfiedel) – einer geigenartigen Fiedel, die neben den vier zu spielenden Saiten auch Resonanzsaiten besitzt, die ihr einen kernigen und bordunhaften Ton verleihen. Ein weiteres typisch norwegisches Instrument ist die Langeleik, übersetzt in etwa Langes Spiel, eine Brettzither mit einer Melodieseite mit Bünden auf dem Griffbrett, sowie mehreren Bordunsaiten, die nur leer angespielt werden können.
 Troldhaugen, Wohnstätte von Edvard Grieg, dahinter rechts der Konzertsaal
Troldhaugen, Wohnstätte von Edvard Grieg, dahinter rechts der Konzertsaal
Und in diese unvergleichliche Musiktradition verschlägt es mich nun! Die Reise beginnt in Bergen, der zweitgrößten Stadt des Landes und zentralen Hochburg der norwegischen Kunstmusik. Als Geburtsstadt von Norwegens herausragenden Komponisten Edvard Grieg (1843-1907), Ole Bull (1810-1880), Harald Sæverud (1897-1992) und dessen Sohn Ketil Hvoslef (geb. 1939) ist Bergen singulär. Ole Bull war der Revolutionär der Transkription norwegischer Volksmusik – die bereits Ende des siebzehnten Jahrhunderts durch Hinrich Meyer begann – und der „gute Engel“ Edvard Griegs: dem damals fünfzehnjährigen empfahl er als eine der größten musikalischen Autoritäten des Landes das Studium in Leipzig. Edvard Grieg ist seither international berühmt durch sein Klavierkonzert a-Moll, seine Suite aus Holbergs Zeit, seine Peer-Gynt-Suiten und einige seiner Lyrischen Stücke für Klavier, ist aber auch Autor hervorragender Kompositionen wie einer Klavier-Ballade und eines Streichquartetts (beide in g-Moll), von drei Violinsonaten, einer Cello- und einer Klaviersonate, und etlicher Bearbeitungen nordischer Weisen, die somit kunstmusikalisch geadelt im Konzertsaal ihren Platz finden. Bedauerlicherweise hat im letzten Jahrhundert Harald Sæverud noch nicht die Bekanntheit seines weltweit beliebten Vorgängers erreicht, doch hat auch er eine Peer-Gynt-Bühnenmusik geschaffen und gilt durch seine insgesamt neun höchst eigentümlichen Symphonien als größter Symphoniker Norwegens. Sæveruds Sohn Ketil Hvoslef schließlich beschritt ganz andere Wege und etablierte sich als Komponist einer großen Zahl vor allem von Solokonzerten und Kammermusikwerken im Grenzbereich von fast improvisatorisch wirkender, kontrollierter Spontaneität. Die Wohnhäuser der ersten drei genannten Komponisten sind heute als Museen zugänglich, doch leider erlaubte die Zeit nur einen Besuch in Troldhaugen, der Villa von Edvard Grieg. Unter Leitung seiner Witwe Nina wurde ein Teil des Mobiliars 1928 an die richtigen Plätze zurückgestellt und der Besucher kann einige fast unverfälscht wiederhergestellten Räume besichtigen und sich zurückversetzt fühlen in Griegs Lebzeiten. Der für den nur gut 1,50 Meter großen Edvard Grieg extra tiefgelegte Flügel, die dicken Bände mit Beethovensonaten, auf die er sich zum „Heraufreichen“ an die Tasten eines normalen Klaviers oft setzte, sowie seine Komponierhütte mit idealem Blick auf den Fjord bleiben hier besonders eindrücklich in Erinnerung. Auch die Grabstätte des Ehepaars unterhalb des Hauses ist einen Besuch wert, und hier scheint die Zeit stillgestanden zu haben. Neben dem Haus findet sich ein kleiner Konzertsaal, der zwar von außen mit seinen Betonmauern nicht gerade in die Idylle passt, aber von innen wahrlich eindrucksvoll erscheint und hinter dem Flügel durch eine Glasfassade den Blick auf das kleine rote Komponierhäuschen des Nationalromantikers freigibt. In dieser kleinen Halle werden immer wieder lange Abendkonzerte und halbstündige Lunsjkonserter (Mittagskonzerte) angeboten. Hier wurde auch ich erstmals mit norwegischer Pianistenpraxis vor Ort konfrontiert, Signe Bakke spielte Werke vom Meister. Als erstes Stück war der Kopfsatz seiner e-Moll-Sonate Op. 7 angekündigt, so kam die in Tracht fast ein bisschen an Nina Grieg erinnernde Pianistin auf die Bühne und spielte – den ersten Satz der Suite aus Holbergs Zeit Op. 40! Nun könnte man meinen, Signe Bakke habe einfach nicht genug Zeit gehabt, um die technisch delikate Sonate aufzupolieren, und genau diese Vermutung bestätigte sich auch anhand der oft verstolperten Perpetuum-Mobile-Sechzehntel im Prelude der Suite, die den gesamten Satz durchziehen. Glücklicherweise besserte sich die Ausführung in den folgenden Volksweisen aus Op. 17 und 52 sowie den Lyrischen Stücken aus Op. 43 und 71. Insgesamt war die Tendenz zu beobachten, dass das romantische Element bei Grieg viel zu sehr ins willkürliche Extrem gezogen wurde, zusammenhangslose Rubati und unbedachte sowie auch unsangliche Phrasierung war der Regelfall – ein Phänomen, dass mir mehrfach bei norwegischen Pianisten ins Auge stach! Doch plötzlich tat sich eine neue Welt auf, als Signe Bakke eine Stelle im Volksmusikcharakter authentisch wiedergab: Kurzzeitig machte sich der Eindruck breit, es spiele eine Hardingfele und kein Klavier mehr; so wurde jedes Volkslied und jeder Volkstanz zu einem einmaligen Erlebnis und der Springdans im berühmten Det var en gang (Es war einmal) avancierte zu einem hinreißenden Tanzcharakter von vollendeter Klangschönheit, wenn auch leider umgeben von einem überemotionalen und somit aufgesetzt wirkenden Andante-Rahmen, bei dem jede Auflösung, als sollte es absichtlich genau gegen die Natur sein, einen besonders starken Akzent erhielt. Nichts desto Trotz kann man hier lernen, wie die nordische Fiedelmusik auch auf dem Klavier einen stattlichen Charakter und Fülle entfalten kann.
 Das Instrumentenmuseum Ringve von außen
Das Instrumentenmuseum Ringve von außen
Trondheim hieß die nächste Station musikalischer Erfahrung, Heimatstadt von Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887), der jahrelang durch Norwegen reiste und Volksmelodien sammelte, welcher er fürs Klavier gesetzt in den Ældre og nyere norske Fjeldmelodier publizierte, die als wichtigste Volksmusikquelle auch für Edvard Grieg dienten. Etwas außerhalb der Stadt befindet sich das Ringve Museum, eine ehemalige Landvilla, die von den kinderlosen Besitzern, leidenschaftlichen Instrumentensammlern, als Erbe für die Gemeinschaft zum Musikinstrumentenmuseum umfunktioniert wurde. Hier steht alles auf Musik, schon bei der Ankunft wurden wir begrüßt von schwedischen Volksweisen auf der Geige, und auch zu Beginn der Führung im Herrenwohnsitz genossen wir zu Ehren der russischstämmigen früheren Besitzerin gespielten Rachmaninoff auf dem historischen Flügel. Im Museum selbst befindet sich ein kleiner Konzertsaal, in dem die Entwicklung des modernen Klaviers vom Clavichord bis zum Konzertflügel anhand jeweils zeitgenössischer Stücke wirkungsvoll demonstriert wurde. Auch eine Kostprobe von Hardingfele und Langeleik wurden gegeben, was immer wieder aufs Neue verzaubert. Hier gibt es die nordische Musikkultur noch zum Anfassen! Weiter geht die Führung in die faszinierende Sammlung unzähliger teils noch nie gesehener Instrumente. Der erste Raum ist bestückt mit paneuropäischen Instrumenten, einheimische Sammlerstücke stehen neben kontinentalen Raritäten, so zum Beispiel wunderschön erhaltene Klavierinstrumente und sogar ein Harfenklavier. Ein Zimmer weiter wird es interkontinental, afrikanische Rhythmusinstrumente und amerikanische elektronische Gerätschaften locken den Besucher an, sie einmal auszuprobieren: Highlight hierbei unbestritten das spielbereite Theremin, bei dem durch Annäherung an zwei Antennen Tonhöhe und Dynamik bestimmt werden können, allerdings entgegen der unmittelbar instinktiven Assoziation derart, dass die Lautstärke mit wachsender Entfernung zunimmt und das Gerät bei der Berührung verstummt. Eine kleine zweite Ausstellung widmet sich hauptsächlich der norwegischen Musik, hier sind besonders rare Sammlerstücke und auch Trachtenkleidung ausgestellt. Die Führer im Ringve, überwiegend ausgebildete oder in Ausbildung befindliche Musiker, sind sehr kompetent und gerade im direkten Gespräch sehr offen für Hintergrundinformationen zu einzelnen Ausstellungsstücken. Alle können sie ihr Instrument spielen und lassen aus einem normalen Museumsbesuch ein akustisches Erlebnis werden mit einer solchen Vielzahl an unerhörten Klängen, wie man sie sonst wohl nirgends so hautnah und live zu hören bekommen dürfte.

 Die Eismeerkathedrale und Tromsø nach Mitternacht
Die Eismeerkathedrale und Tromsø nach Mitternacht
Nicht vergessen werden darf auch ein Konzert in der zum Wahrzeichen gewordenen Eismeerkathedrale in Tromsø. Touristen wird hier ein Mitternachtskonzert geboten. Mitternacht auf der anderen Seite des Polarkreises ist allerdings etwas vollkommen anderes als in Deutschland: Während es im Winter grundsätzlich dunkel ist, geht nun im Spätsommer die Sonne erst gegen Mitternacht unter, ein heller Schimmer am Horizont verschwindet die ganze Nacht lang jedoch nicht. Zwischen prachtvollen gläsernen Front- und Rückwänden bieten die Sopranistin Berit Norbakken Solset, der Cellist Georgy Ildeykin und der Pianist Robert Frantzen ein gemischtes Programm nordischer Musik, darunter teilweise Folklore, dar, wobei auch zentraleuropäische und sogar samisch-einheimische Elemente Einzug finden. Neben eher selten gehörten Werken des Grieg-Vorgängers Halfdan Kjerulf und des Zeitgenossen Johan Mahtte Skum stehen auch Klassiker wir Griegs Lied Jeg elsker dig (Ich liebe dich) und erneut Det var en gang auf dem Programm. Auch hier geraten gerade die volksnahen Stücke zu einem besonders stimmungsvollen Ereignis, Solset bezaubert durch glänzendes Einfühlungsvermögen in die bäuerliche Tradition und lässt ihre fast etwas chansonartig wirkende Stimme in der Höhe brillieren. Ihre Mitstreiter können sich angemessen einfügen und unterlegen die dominierende Stimme mit stets passender Begleitung. Robert Frantzen präsentiert auch ein eigenes Duo-Stück für seine kleine Tochter mit dem Cellisten, ein gelungenes Werk mit neoromantischem Gestus. Ein wenig enttäuschend sind auch hier wieder die bekannten Programmpunkte: Bachs Prélude aus der Suite für Violoncello Nr. 1 in G-Dur BWV 1007 gerät strukturlos, wobei routinemäßig stets auf der Takteins ritardiert wird, Jeg Elsker Dig erfährt auch standardisierte Verzögerungen und extreme mechanische Betonungen der Spitzentöne, und Det var en gang ist hier ein formloses Stück überschäumender und offensichtlich äußerlich prätendierter Emotion. Doch will man Unbekanntes entdecken, so sei dieses Konzert trotzdem nachdrücklich empfohlen, denn gerade erst bei den fast vergessenen Werken blühten die Musiker richtig auf, und derart werden Volksweisen, samische Joiks und Lieder vergessener Komponisten zu kleinen, brillanten Meisterwerken, die in ungewohnt guter Qualität und optisch atemberaubendem Umfeld noch mehr an Wirkung gewinnen.
 Die malerische Landschaft im Trollfjord
Die malerische Landschaft im Trollfjord
Schon sehr lange Zeit hat besonders die norwegische Musik mein Herz gewonnen; diese im positiven Sinne naive Haltung, die Naturverbundenheit, dieses Gefühl von Freiheit, aber auch von Melancholie und archaischen Uremotionen der Menschen, die diese Musik enthält wie sonst nichts mir Bekanntes, hat mich von Anfang an nicht unberührt lassen können. Dies alles zum Ausdruck zu bringen ist eine ungeahnt diffizile Aufgabe für jeden Musiker, und viele scheitern an der idiomatisch angemessenen Ausführung selbst der leichtesten Werke von Edvard Grieg und anderen nordischen Komponisten. Oft habe ich den Eindruck, als flösse zu viel Künstelei und Falschheit in diese so schlichte und natürliche Quelle unbelassener Energie ein, anstatt dass der Künstler sich öffnet für die subtile Unmittelbarkeit und grundlegende Natürlichkeit, die alles durchströmt. Vieles ist mir klar geworden alleine durch den Anblick der Fjordlandschaften: Welch ein unbeschreibliches Gefühl es ist, mit dem Schiff in den Trollfjord hineinzufahren und zu spüren, wie hoch sich um einen herum die Berge auftun, zu erfahren, wie märchenhaft und fast unwirklich diese Landschaften wirken und wie sehr man sich zuhause fühlen kann in dieser Fantasielandschaft, die eine mysteriöse Art von Geborgenheit vermittelt. Jeder Augenblick gibt etwas Neues, nie kann man ermüden: Einfach nur zu schauen und zu spüren, wie sich Landschaften verändern, unzählige Erhebungen und Inseln vorüberziehen oder plötzlich Tiere vorbeihuschen. Genau das ist das Gefühl, was auch in nordischer Musik in Töne gebannt ist und welches es heraufzubeschwören gilt – nicht mit Professionalität alleine ist dies zu machen, sondern nur mit einem offenen, neugierigen Geist.
[Oliver Fraenzke, September 2015]
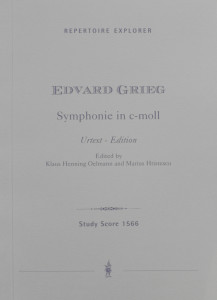




 Das Instrumentenmuseum Ringve von außen
Das Instrumentenmuseum Ringve von außen
 Die Eismeerkathedrale und Tromsø nach Mitternacht
Die Eismeerkathedrale und Tromsø nach Mitternacht

