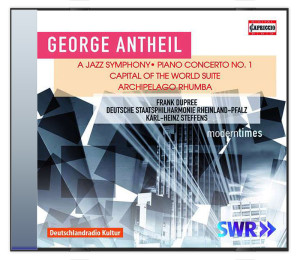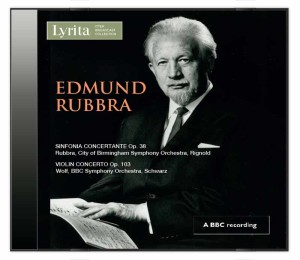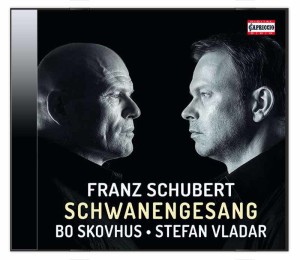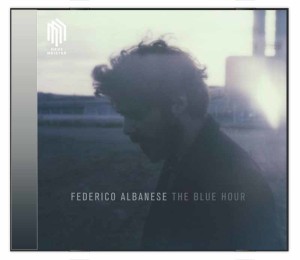Capriccio, C5309; EAN: 8 45221 05309 7
Musik von George Antheil ist auf vorliegender CD mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Karl-Heinz Steffens zu hören. Neben der Erstfassung von A Jazz Symphony (1925) und dem Ersten Klavierkonzert, jeweils mit dem Solisten Frank Dupree, erklingt die Orchestersuite zu Capital of The World und Archipelago „Rhumba“.
George Antheil wusste, wie man sich selbst darstellen kann: Mit schockierenden Klavierauftritten, bei welchen nicht selten ein Revolver auf dem Klavier lag, mit eigenwilligen Ensemblebesetzungen, die auch mal 16 selbstspielende Klaviere und Flugzeugsirenen vorsehen, und mit verbaler Propaganda, welche ihn sich selbst in seiner Autobiographie als „Bad Boy of Music“ präsentieren ließ.
Neben einer Handvoll solch ohrenbetäubender Werke wie dem berühmten Ballet mécanique oder der Airplane Sonata schrieb Antheil allerdings auch eine überraschend große Menge Musik, die sein selbstgeschaffenes Image so überhaupt nicht bestätigen will. Vor allem der Jazz, welcher damals mehr als heute als reine Populärmusik galt, reizte ihn, so dass er ihn immer wieder in seine Musik einband, subtil wie in späteren Jahren in seiner Fünften Symphonie (Joyous) oder offenkundig wie in der „A Jazz Symphony“ oder in der auf gleichem Material beruhenden „Jazz Sonata“. Aber auch die Operette und der Wiener Walzer zogen Antheil an, in Wien wollte er neben Alban Berg unbedingt die Bekanntschaft von Franz Lehár und Emmerich Kálmán machen – was auch in seine Musik einging!
Beide dieser unorthodoxen Einflüsse der – im damaligen Denken – „leichten Muse“ schlagen sich in der Erstfassung der Jazz Symphony von 1925 nieder. Das Paul Whiteman (Dirigent der Uraufführung von Gershwins Rhapsody in Blue) gewidmete und im Übrigen ausdrücklich nicht in die Nummerierung der großen Symphonien aufgenommene einsätzige Orchesterwerk kombiniert futuristische Techniken wie Clusters mit möglichst originalgetreu nachzustellenden Jazzeffekten – über dem Trompetensolo steht gar geschrieben: „Use all the tricks of the trade“, und im Vorwort zur Zweitfassung von 1955 hob der Komponist hervor, dass die Uraufführung von einem „all-negro orchestra assembled by Handy“ (William C. Handy, 1873-1958, Komponist, Trompeter und Bandleader, der oft als „Vater des Blues“ bezeichnet wurde) gespielt wurde. Die Orchestration weist ebenfalls „native american“-Züge auf, zwei Banjos und eine Steamboat Whistle werden zum Einsatz gebracht. Zugleich ist die Symphonie ein Rundumschlag gegen andere dem Jazz nahestehende Werke wie Milhauds La création du monde, Gershwins Rhapsody in Blue oder Joplins Entertainer, die alle aufgegriffen – wenngleich nie wörtlich zitiert – und pfiffig persifliert werden. Als Finale erklingt ein Walzer, der beinahe von Lehár herrühren könnte, endete er und damit das ganze Werk nicht in einem übermäßigen Dreiklang, was den Hörer etwas verdutzt zurücklässt.
Angedeutete Zitate, die offensichtlich scheinen und doch nicht wörtlich erklingen, finden sich ebenfalls im Klavierkonzert von 1922, das anmutet, als würde es unter dem Einfluss Strawinskys stehen. Tatsächlich machte Antheil kurz zuvor Bekanntschaft mit dem Russen, und so erklären sich Anlehnungen an Le sacre du printemps und noch mehr an Petruschka, was ja ursprünglich ein Klavierkonzert hätte werden sollen und den Orchesterpianisten vor horrende solistische Anforderungen stellt.
Russische Idole sind auch in der Suite aus dem Ballett Capital of the World erkennbar, die Klangwelt von Prokofieff ist nicht fern, und der letzte Satz, Knife Dance and Farruca, erinnert nicht nur durch den Titel an Chatschaturjans Säbeltanz. Noch mehr als bei den vorherigen Werken sticht der Kontrast zwischen Bad Boy und Komponist leichter Musik ins Auge, Antheil komponierte tatsächlich neben dem Ballett auch ca. dreißig Filmmusiken. Etwas Exotisches schwingt in dieser Musik – gerade auch im abschließenden Archipelago „Rhumba“ – mit: farbenfroh, beschwingt, parlierend. Antheil war eben nicht nur der Schock-Pianist und Komponist einer Hand voll wilder Ausnahmewerke, sondern auch begabter Schöpfer unbeschwerter, exotischer und farbenprächtiger Musik für leichteren Hörgenuss.
Sichtlich Spaß haben die Musiker der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Karl-Heinz Steffens. Das Orchester trägt nicht zu dick auf in all den üppigen Passagen, bleibt transparent und luminös, und lässt sich dabei nicht die dankbaren Effekte entgehen, die Antheil in seinen Partituren offeriert. Zumal die Tiefen sind präsent und schmettern bei Bedarf voluminös hervor. Unerwartete Umschwünge kommen so unvermittelt zum Zug, dass der Hörer geradezu ins Stocken gerät, und allgemein erhält die Musik ihre unverbrauchte Frische.
Feinfühlig im Anschlag und subtil in der Klangwahrnehmung ist der junge Pianist Frank Dupree als Solist in A Jazz Symphony (gut abgestimmt mit den anderen zwei Pianisten Adrian Brendel und Uram Kim) sowie im Klavierkonzert. Er kennt seine Funktion im Orchester und kann sich auch bei Bedarf zurückhalten, selbst zur Begleitung werden oder gleichberechtigt in ein Wechselspiel einstimmen. Flächig Komponiertes lädt er nicht expressiv auf, was der Musik allerdings auch entgegenkommt, und gestaltet dafür umso individueller in den sanfteren Passagen. Er realisiert den klaren Kontrast zwischen den harten non-legato-Stellen und den unentschieden zärtlichen Ruhepunkten.
Den rundum informativen und auf mir bislang nicht bewusste Aspekte hinweisenden Booklettext verfasste der Wiener Musikforscher Christian Heindl.
[Oliver Fraenzke, August 2017]