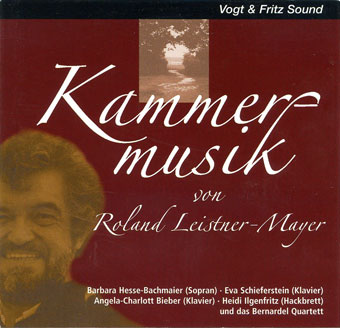An Fronleichnam (19. Juni 2025) erklang in der Isarphilharmonie erstmals Ferruccio Busonis gewaltiges Klavierkonzert von 1904. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, im fünften Satz verstärkt durch die Herren des Chors des Bayerischen Rundfunks, wurde von Sir Antonio Pappano geleitet, der für Esa-Pekka Salonen eingesprungen war. An den höllisch anstrengenden Klavierpart wagte sich Igor Levit.

Das Klavierkonzert op. 39 des italienisch-deutschen Komponisten Ferruccio Busoni (1866–1924) ist ein Unikum, nicht nur wegen seiner abendfüllenden Länge von ca. 75 Minuten. Ebenso die Fünfsätzigkeit und der Männerchor am Schluss – eine Hymne an Allah aus dem Versdrama Aladdin des dänischen Goethe-Zeitgenossen Adam Oehlenschläger – sind jeweils für sich genommen fast schon Alleinstellungsmerkmale. Die Uraufführung 1904 in Berlin war ein veritabler Konzertskandal. Obwohl Busoni seinerzeit unangefochten als einer der besten Pianisten weltweit galt, warnte er in seinem Einführungstext das Publikum, in dem er die Funktion des Orchesters im bisherigen Solokonzert als mehr oder weniger bloßen Begleiters eines auf Selbstdarstellung bedachten Pianisten verurteilte: „Das Virtuosenthum ist im Sinken begriffen und damit verliert die Caricatur der Symphonie, Concert benannt, das letzte bisschen von Daseinsberechtigung.“ Der Solopart seines Konzerts übertrifft an technischer Vertracktheit, Kraftaufwand und differenzierter Klanglichkeit zwar sämtliche zeitgenössischen Gattungsbeiträge nochmals deutlich, gilt jedoch als höchst undankbar, da Busoni gewissermaßen eine Art „Rollentausch“ vollzieht: Fast immer präsentiert das Orchester die zahlreichen, durchaus prägnanten melodischen Einfälle; das Klavier darf diese allenfalls paraphrasieren bzw. kommentieren und wirkt über weite Strecken wie ein überdimensionales „obligates“ Instrument. Mit John Adams könnte man fragen: „Must the Orchestra Have All the Good Tunes?“. Dass sich etwa das Thema des Chores – welches dieser erst eine gute Stunde später singen wird – bereits in den allerersten Akkordkaskaden des Solisten verbirgt, dürfte kaum ein Hörer auf Anhieb erkennen. Selbst ein erfahrener Kritiker wie Joachim Kaiser hat das Busoni-Konzert noch 1966 – die Aufführung mit Scarpini unter Kubelik – anscheinend gründlich missverstanden und mit einigermaßen dümmlichen Prädikaten belegt.
Nicht nur deswegen verlangt dieses monumentale Werk – das dicke Buch, das Igor Levit auf den Flügel hievte, war nur der Klavierauszug – denn auch insbesondere vom Dirigenten eine völlige intellektuelle Durchdringung der symmetrischen Gesamtstruktur und absolute Klarheit bei der Disposition der oft komplexen Schichtungen des überbordenden motivischen Materials. Levit hat das Busoni-Konzert – nachdem 2021 eine geplante Aufführung mit dem Bayerischen Staatsorchester corona- und krankheitsbedingt ausfiel – später überhaupt erstmals unter Sir Antonio Pappano gespielt: schon mal ein vertrautes Team. Die letzte Beschäftigung des BRSO mit dem herausfordernden Stück reicht wohl bis 1986 zurück: mit Volker Banfield unter Lutz Herbig (nur für eine CD-Produktion?); also für fast alle Musiker eher komplettes Neuland.
Pappano merkte man bereits während der Einführung an, wieviel Lust er auf dieses Event hatte und wie genau er sich mit dieser weit unterschätzten Musik auskennt. So realisierte er vor allem den melodischen Schmelz und den Schwung des Italieners Busoni kongenial, bis hin zur aberwitzigen Tarantella des 4. Satzes von gut 950 Takten (!), die in einem fröhlichen „Vulkanausbruch“ (Busoni) kulminiert und deren Sog man sich kaum entziehen kann. Diese war vom Tempo her freilich selbst für den sich im akustisch hierfür suboptimalen HP8 tapfer schlagenden Levit schon grenzwertig. So waren einige Fehlgriffe beim unglaublichen Akkordwerk, das Busoni nicht nur dort fordert, unvermeidlich, schlugen aber nicht ins Gewicht. Levit – hochkonzentriert und ebenso auf den rein körperlichen Kraftakt voll eingestellt – verblüffte gerade beim schnellen Umschalten zu delikaten Arabesken, die er an den entsprechenden Stellen unerhört leise und enorm klangschön zelebrierte. Der sechsstimmige Herrenchor des Bayerischen Rundfunks, von Howard Arman exzellent einstudiert, war stets textverständlich und ebenso engagiert wie das neugierige Orchester. Hier überzeugten gerade auch die dunklen Farben – etwa der Klarinette beim zitierten „Fenesta ca lucive“ im 2. Satz: sensationell. Dort agierte Levit wie eine unzähmbare, mal verspielte, mal bedrohliche Raubkatze. Klassisch strenge Kontrapunktik à la Bach – Busonis größtes Vorbild – gibt es in diesem Stück zwar nicht. Dennoch könnte man Pappano vorwerfen, dass er die Melodielinien fast durchgehend zu sehr in den Vordergrund stellte – damit zeitweise sogar den Flügel völlig überdeckte – und den raffinierten Nebenstimmen dieser für ein Klavierkonzert um 1900 ungewöhnlich farbig orchestrierten Partitur nicht genügend Bedeutung beimaß.
Die größte Leistung an diesem Abend war allerdings der mit 25 Minuten sperrige Mittelsatz (Pezzo serioso): Dieses architektonische Meisterstück mit zahlreichen Themen – darunter ein gregorianisches Ave Maria – droht regelmäßig schnell zu langweilen. Es dramaturgisch schlüssig und spannend zusammenzuhalten, gelingt selten so bewegend. Wie Levit nach dem dynamischen Höhepunkt mit seinem brutalen, wörtlich zu nehmenden Gedonnere (tempestuoso, tuonando) – im Orchester ähnlich kompromisslos wie Strauss‘ gewagteste Passagen im Heldenleben oder Don Quixote – die Stimmung wieder herunterkühlte, so dass für den Hörer das folgende improvvisando absolut glaubwürdig erschien und von teutonischer Architektur nach Italien herüberblickte, – der Rest des Satzes klingt beinahe wie ein Vorgriff auf Respighis Pini di Roma – war zutiefst beeindruckend.
Man folgte der lebendigen Darbietung gebannt: Auch vom Publikum verlangt das Busoni-Konzert eine hohe intellektuelle Aufnahmebereitschaft und widerspricht zunächst allen gewohnten Erwartungen. Es erwies sich als richtig, das Monumentalwerk alleine aufs Programm zu setzen, so dass es ohne Ablenkung für sich sprechen durfte. Die Begeisterung – mit langanhaltendem Applaus für alle Musiker – war dann sicher ehrlich. Am Schluss wurde allen klar, dass hier selbst eine Zugabe eher fehl am Platze gewesen wäre.
[Martin Blaumeiser, 21. Juni 2025]