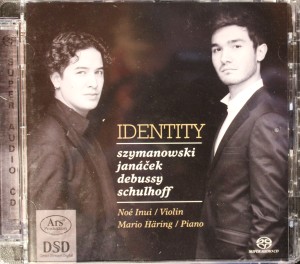Am 19. 11. 2023 brillierte der britische Pianist Jonathan Powell mit einem Klavierabend zu Ehren des in Bad Tölz begrabenen Komponisten Hans Winterberg im dortigen Kurhaus. Nach einer hochrangig besetzten, vom BR-Redakteur Bernhard Neuhoff klug geleiteten Podiumsdiskussion über den verschlungenen Lebensweg Winterbergs und die vielschichtigen Wurzeln seiner Musik spielte Powell Stücke von Komponisten, die – bis auf Arnold Schönberg – alle in der späteren Tschechoslowakei geboren wurden, und deren Bedeutung ebenfalls erst nach und nach adäquat gewürdigt wird: Alois Hába, Josef Suk, Vítězslava Kaprálová, Egon Kornauth, Viktor Ullmann und Leoš Janáček, bevor der Abend dann mit Winterbergs beeindruckender 3. Klaviersonate schloss.

Das durch unglückliche – wenn nicht befremdliche – Umstände in Vergessenheit geratene Werk des deutschsprachigen Prager Juden Hans Winterberg (1901–1991), der Theresienstadt überlebte, nichtsdestotrotz 1947 nach Bayern zog, wird erst seit wenigen Jahren durch das Exilarte Zentrum an der Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien in Zusammenarbeit u.a. mit Boosey & Hawkes – die nun erstmals Musik des Komponisten verlegen – erforscht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gleichzeitig gab es in letzter Zeit einige neue Aufnahmen, u.a. mit Liedern sowie Klavier- und Kammermusik. Die erste CD mit – neu produzierten – Orchesterwerken wurde hier kürzlich ausführlich besprochen. Wer mehr zu Person und Werk sucht, findet die grundlegenden Infos auf der Seite von Dr. Michael Haas, der dem interessierten Publikum als Produzent der legendären Decca-Serie Entartete Musik bekannt sein dürfte.
Am Sonntag, 19. November 2023 fand zu Ehren Winterbergs, der ab den 1970ern einige Jahre in Bad Tölz lebte und auch dort begraben liegt, im Kurhaus der Stadt ein denkwürdiger Klavierabend statt, der mit einer prominent besetzten Podiumsdiskussion begann: Nach sehr engagierten Grußworten des 3. Bürgermeisters, Dr. Christof Botzenhardt, sowie des Enkels Winterbergs, Peter Kreitmeier, beschäftigten sich – unter der umsichtigen und hervorragend getimten Moderation Bernhard Neuhoffs von BR Klassik – Michael Haas (nun Senior Researcher bei Exilarte), Frank Harders-Wuthenow (Boosey & Hawkes), Lubomir Spurny (Masaryk-Universität Brno) sowie der Prager Journalist Petr Brod mit dem verschlungenen Lebensweg und der nicht ganz unkomplizierten Verwurzelung des Komponisten im vielschichtigen Prager Musikleben nach Gründung der Tschechoslowakei. Winterberg gilt nicht nur dem britischen Pianisten Jonathan Powell als „missing link“ zwischen Mahler, Janáček und der Neuen Wiener Schule. Ab den 1960ern hat der Komponist sogar seine ganz persönliche Antwort auf den Nachkriegs-Serialismus gefunden.
Im eigentlichen Klavierproramm hatte Powell mit Bedacht Musik gewählt, die die zuvor beleuchteten unterschiedlichen Wurzeln – bis zurück in die „k.u.k.“ Ära – hörbar machen. Der Pianist startete mit dem für 1918 überraschend tonalen Intermezzo op. 2, Nr. 2 (f-Moll) des späteren Viertelton-Revolutionärs Alois Habá (1893–1973), das klanglich – obwohl weit weniger dicht – an die Sonate Alban Bergs erinnert. Es folgten vier kurze Genrestücke von Josef Suk (1874–1935) – aus den Zyklen Vom Mütterlein op. 28, Wiegenlieder op. 33, Erlebtes und Erträumtes op. 30 und Episoden (1923). Suk, Schüler – und späterer Schwiegersohn – Dvořáks, machte vor allem durch große, in ihrer Orchestrierungskunst Richard Strauss in nichts nachstehende Orchesterwerke Furore, besonders mit der Uraufführung von Zraní nur zwei Tage nach Gründung der Tschechoslowakischen Republik. Schon an diesen Kleinoden spürten die Zuhörer – man hätte sich da durchaus ein paar mehr gewünscht – Powells klangliche Delikatesse, sein tiefes Verständnis für Harmonik und die empathische Charakterisierungskunst bis ins kleinste motivische Detail. Aus dem interessanten Diskant des Bechstein-Flügels im Kurhaus kitzelte er wunderbare Farben heraus.
Die April-Präludien der viel zu jung verstorbenen kompositorischen Frühbegabung Vítězslava Kaprálová (1915–1940) entstanden noch 1937 in ihrer Heimat, kurz bevor sie nach Paris zu Martinů ging. Pianistisch schon elaboriert – etwa die Ostinati des ersten Stücks oder die Prokofieff-Nähe des vierten –, überzeugte die ergreifende Schlichtheit des dritten Préludes jedoch am meisten. Powell zeigte hier schon mal seine Krallen und stellte mit seiner Darbietung sämtliche mir bekannten Tonträgeraufnahmen in den Schatten.
Mit der 13-minütigen Fantasie op. 10 des aus Olmütz gebürtigen, österreichischen Komponisten Egon Kornauth (1891–1959) erlebte das Publikum dann ein Klavierfest ganz anderen Kalibers. Was der Schüler des berühmten, ganz in der Brahms-Nachfolge stehenden Robert Fuchs hier 1913 an pianistischer Kraftmeierei einerseits, klanglichem Feinsinn und dramaturgischem Überblick andererseits verlangt, kann nur ein echter Virtuose so unter einen Hut bringen, dass der musikalische Gehalt – quasi Richard Strauss zum Quadrat – den äußerlichen Aufwand vergessen macht. Dazu muss man wissen, dass Jonathan Powell 2020 den Preis der deutschen Schallplattenkritik für ein musikalisches Monstrum, die gut 8-stündige Sequentia Cyclica des britischen Exzentrikers Kaikhosru Sorabji erhalten hat: hier mein Bericht über die Aufführung beim Heidelberger Frühling 2022 – eine fast übermenschliche Leistung. Am Sonntag gelang Kornauths Stück jedoch selbst Powell nochmals stärker als auf seiner eigenen CD-Einspielung – emotional hinreißend.
Viktor Ullmann (1898–1944) überlebte Theresienstadt nicht, wurde im Oktober 1944 nach Auschwitz gebracht und sofort ermordet. Von seinen sieben bedeutenden Klaviersonaten ist die letzte zu Recht die berühmteste. Wie weit Ullmanns klare Stilistik und kompositorische Könnerschaft schon bei der 1. Sonate (1936) war, bewies Powell nachdrücklich. Ullmanns immer enormer Tiefgang wurde nicht nur im langsamen II. Satz (In memoriam Gustav Mahler) deutlich, sondern gleichermaßen in den vertrackten Ecksätzen. Leoš Janáčeks (1854–1928) ganz später, leicht kryptischer Erinnerung schloss der Pianist unmittelbar Arnold Schönbergs (1874–1951) berühmte aphoristische, atonale, aber eben noch nicht zwölftönige Sechs kleinen Klavierstücke op. 19 von 1911 an; wahrscheinlich die einzigen Werke, die Teilen des Publikums schon vor dem Konzert bekannt gewesen sein dürften. Hier konzentrierte sich Powell völlig darauf, Spannung und Emotion rein durch Klang zu erzeugen, wobei das Martellato am Ende des vierten Stücks nicht hart genug erschien. Beim letzten – ebenfalls eingedenk Mahlers Tod – hätte man eine Stecknadel fallen hören können.
Als krönenden Abschluss dann eine der ersten Darbietungen von Hans Winterbergs dritter Klaviersonate von 1947, kurz vor seiner Immigration nach Bayern entstanden. Powell ediert für Boosey auch die vier Sonaten wie die ebenfalls vier Klavierkonzerte des Komponisten. Kein Wunder, dass er diese Musik anscheinend ohne jede Mühe bewältigt. Die bewegte, auf mechanistischer, ein wenig monochrom wirkender quasi Ostinato-Grundierung aufgebaute Entwicklung im knappen 1. Satz erinnerte den Rezensenten merkwürdigerweise sofort an ein viel neueres Stück: Detlev Glanerts Marmormeer (aus den Vier Fantasien op. 15 von 1987) – wie fremdes Leben auf nicht-organischer Grundlage. Viel leichter fasslich danach das konturierte, farbige Molto adagio, dabei expressiv düster wie Bergs Wozzeck – gebändigte Trauer; vielleicht über den Verlust von Heimat? Faszinierend am Ende das rasante, tonaler wirkende, glockige Finale, beschwingt aber stellenweise wie mit schweren Fesseln beladen. Trotz der Konkurrenz einiger großer Namen zuvor konnte sich Winterbergs Stück in diesem höchst anspruchsvollen Programm gut behaupten. Man darf sich schon auf die baldigen Uraufführungen des 4. Klavierkonzerts und weiterer Werke Hans Winterbergs durch Jonathan Powell freuen. Wie Dr. Botzenhardt meinte: „Am besten werden wir ihm gerecht, wenn wir uns mit seiner Musik beschäftigen“. Das Publikum zeigte sich jetzt schon begeistert.
[Martin Blaumeiser, 21.11. 2023]