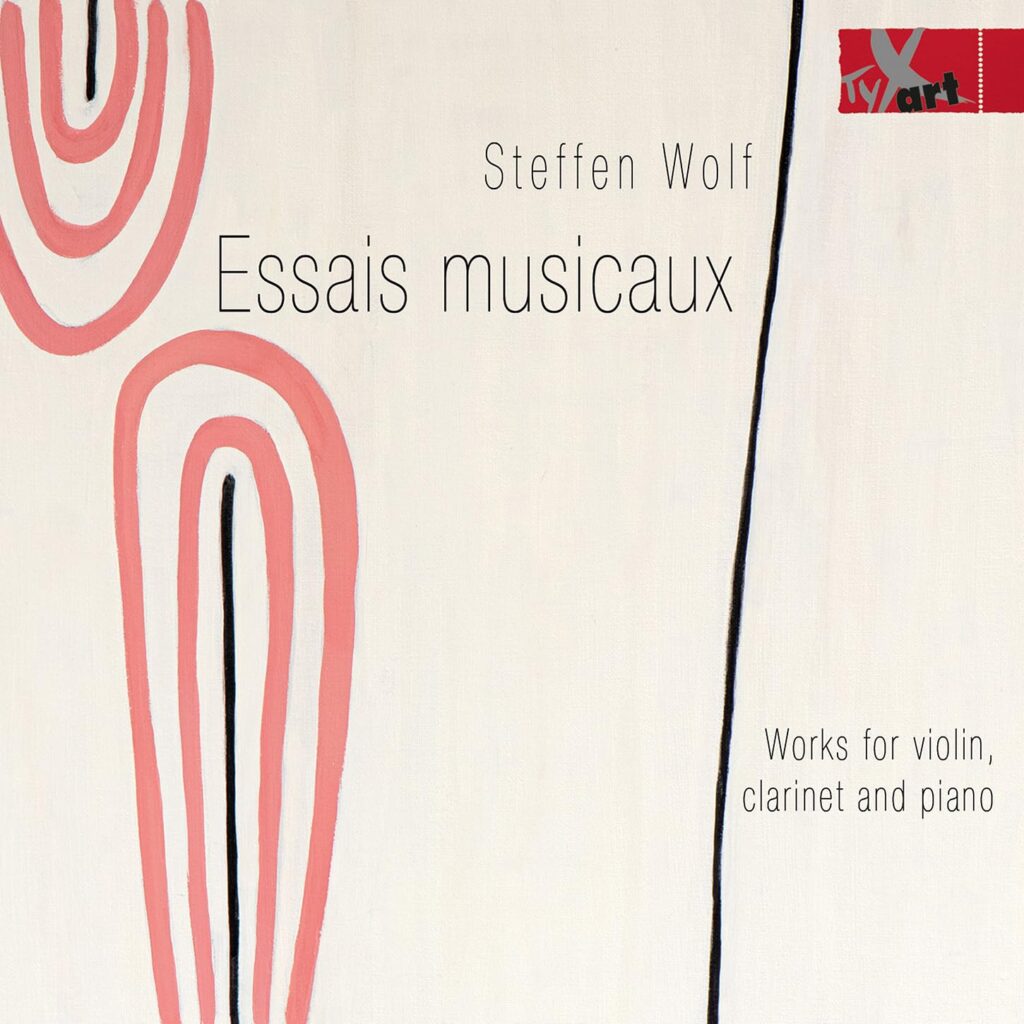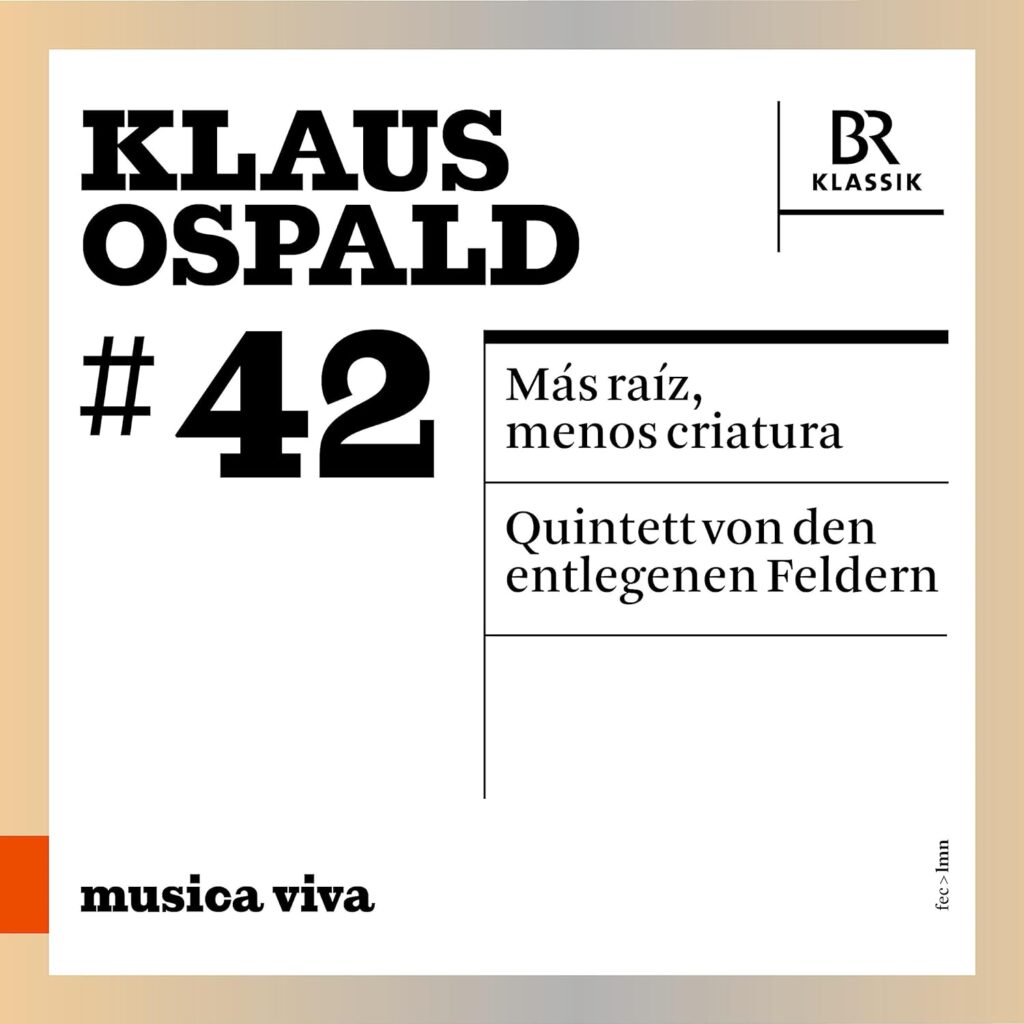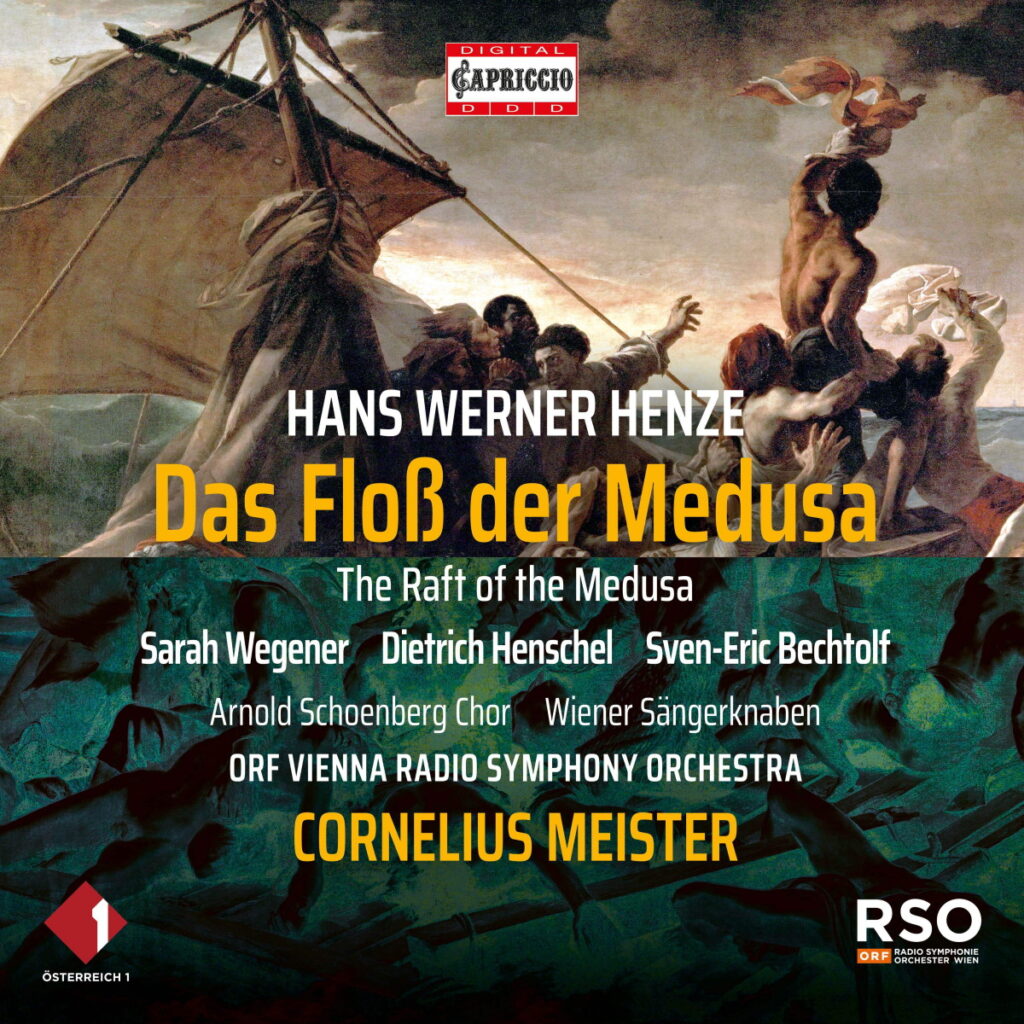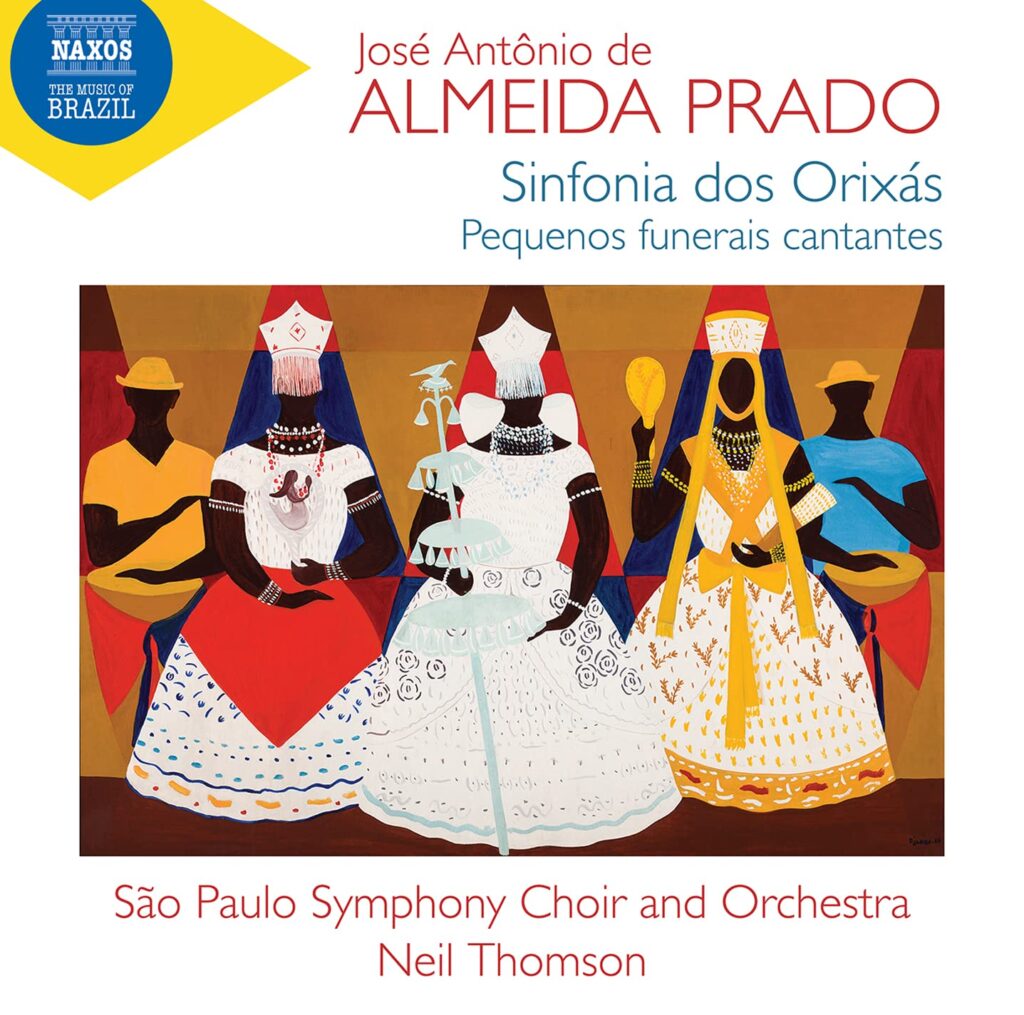Beim Konzert der musica viva am 28. Juni 2024 im Münchner Herkulessaal präsentierte sich Jörg Widmann mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks einmal mehr in gleich dreifacher Funktion: als Klarinettist, Dirigent und natürlich als Komponist. Mal abgesehen von Wolfgang Amadeus Mozarts „Adagio für Glasharmonika“, KV 356/617a, mit dem Christa Schönfeldinger Widmanns Schlüsselerlebnis mit diesem Instrument in Erinnerung rief, gab es ausschließlich Widmann-Werke: „Armonica, „Drei Schattentänze“, „Danse macabre“ und das gewaltige Trompetenkonzert „Towards Paradise“ (Labyrinth VI) mit dem Solisten Håkan Hardenberger.

Im letzten Konzert der musica viva Saison am 28. 6. 2024 durfte sich der Münchner Jörg Widmann gleich dreifach in Szene setzen: als Komponist von vier eigenen Werken, mit einem Solostück für sein Instrument: die Klarinette, sowie als Dirigent des Abends – und konnte diesmal in allen Belangen überzeugen. Vor knapp sieben Jahren versuchte sich Widmann hier bereits in dieser Mehrfachfunktion – wir berichteten. Damals rief zumindest sein Dirigat Stirnrunzeln beim Rezensenten hervor. Seitdem hat Widmann ziemlich viel mit Orchestern gearbeitet, nicht nur an eigenen Stücken, mittlerweile auch als Erster Gastdirigent bei der NDR Radiophilharmonie (Hannover). Widmann ist am Pult sicht- und spürbar deutlich souveräner geworden: Er gibt nicht nur hochengagiert und klar alle wichtigen Impulse, sondern steuert den Klang insgesamt viel differenzierter als früher. Natürlich darf man von einem Komponisten erwarten, dass er seine eigene Musik wahrscheinlich besser kennen dürfte als die meisten Dirigierkollegen. Dennoch hat seine Ausstrahlung auf das BRSO heute einen unvergleichlich positiveren Effekt und unmittelbarere Wirkung als etwa in besagtem Konzert von 2017.
An diesem Abend gibt es vier Widmann-Stücke, allerdings keine Uraufführung. In Armonica (2006) versucht der Komponist, die fast jenseitigen klanglichen Sphären der Glasharmonika – diese steht nicht etwa als Soloinstrument ganz vorne, sondern weil dynamisch sonst chancenlos – mittels delikatester Orchestrierung quasi auf den gesamten Apparat zu erweitern. Dabei gelingen ausladende, organische Spannungsbögen mit nur einem absichtsvoll verstörenden „Abbruch“. Christa Schönfeldinger, mit den komplexen Anforderungen von Widmanns Partitur seit nunmehr über 60 Aufführungen bestens vertraut, beweist anschließend – als offizieller Programmpunkt bei der musica viva höchst ungewohnt – mit dem Standardwerk für die Glasharmonika, Wolfgang Amadeus Mozarts Adagio KV 356/617a, die wundervolle Zerbrechlichkeit und Klangschönheit ihres besonderen Instruments. Die Begegnung mit diesem Stück war für Widmann das anregende Schlüsselerlebnis für Armonica.
Wenn der Komponist ein Solo auf der Klarinette darbietet, ist dies immer hochspannend. Die eigenen Drei Schattentänze von 2013 beleuchten höchst kontrastierende Aspekte der Klangerzeugung: Im Echo-Tanz geht es um extreme Techniken des Überblasens, damit erzeugte Mehrstimmigkeit und Mikro-Tonalität. Die übrigen beiden benötigen elektro-akustische Unterstützung: Der (Under) Water Dance vermittelt die beabsichtigte Illusion mittels eines künstlichen Hallraums, der Danse africaine benutzt die Klarinette als imaginäres Schlagzeugensemble – mit Verstärkung. All dies stößt beim Publikum auf helle Begeisterung.
Der Danse macabre (2022) steht natürlich in der großen Tradition des Totentanzes, die nicht erst mit Saint-Saëns beginnt. Der Tod als einschmeichelnder, aber zugleich sarkastischer Werber für den letzten Weg alles Lebendigen, ist naturgemäß eine Steilvorlage für einen Instrumentationskünstler von Rang. Das verwendete Orchester ist noch nicht einmal überdimensioniert, enthält aber erwartungsgemäß Exoten wie Flexaton oder Waterphone – dessen Name verweist sowohl auf seinen wassergefüllten Korpus als auch den Erfinder Richard Waters, und das Instrument machte insbesondere in Filmmusiken des Horror-Genres Karriere. Für die Gattung ist Widmanns Beitrag mit 17 Minuten schon recht lang – mehr echte Tondichtung als nur netter Lärm wie z. B. Helmut Lachenmanns Marche fatale – und verwurstet verschiedene vertraute Tanzmodelle bis zur Groteske bzw. zum nackten Gerippe. Das hemmungslos tonale Hauptmotiv geht fast so ins Ohr wie Klaus Badelts Filmmusik zu Fluch der Karibik. Trotzdem ist das Publikum ob der leichten Zugänglichkeit des Werkes einigermaßen überrascht.
Das mit knapp 40 Minuten äußerst ausladende Konzert Towards Paradise für den nach wie vor phänomenal tonschön agierenden Trompeten-Weltstar Håkan Hardenberger gehört zur Gruppe der Labyrinth-Stücke, in denen Widmann immer auch seine momentane Befindlichkeit als Komponist reflektiert. 2021 prägte diese freilich die Corona-Situation, und so dreht sich der Weg ins Paradiesische nicht zuletzt um das Thema Einsamkeit, was durch den halbszenischen Gang des Solisten von außerhalb des Podiums durch die einzelnen Orchestergruppen, wo er mit unterschiedlichem Erfolg Anschluss sucht, bis zum Entschwinden in die „Katakomben“ des Herkulessaals am Ende überdeutlich wird. Anders als im 2002 für Sergei Nakariakov geschriebenen Konzertstück, das mit seinem Hochgeschwindigkeitswahnsinn Virtuosität ganz wörtlich ad absurdum führte, steht im Labyrinth VI Lyrik und Nachdenklichkeit im Vordergrund. Das Werk ist aber – trotz eindringlicher Choral-Andeutungen – keineswegs nur langsam.
Hardenberger nimmt vom ersten Augenblick die Zuhörer gefangen. Die exquisite Schönheit der Melodik seines riesigen Parts ist von geradezu erstaunlicher Einprägsamkeit, verlangt dafür eine unglaubliche Sicherheit in der Höhe, aber noch mehr Flexibilität im Ausdruck bei den großartigen Interaktionen mit einzelnen Teilen des Orchesters. In der Mitte gibt es zudem auch Jazz-Momente – die jedoch mit etwas zu wenig Synkopen nicht die Authentizität etwa von B. A. Zimmermanns Nobody knows de trouble I see erreichen. Die Innigkeit gerade an Stellen, wo die Trompete mit Dämpfern spielen muss, scheint bei Hardenberger unübertrefflich. Widmann ist hier meilenweit entfernt von der bis ins Extreme ausdifferenzierten Geräuschhaftigkeit seines Dritten Labyrinths, setzt auf Klangkombinationen, die stets aufhorchen lassen und emotional unterstützend wirken – so etwa Akkordeon oder gestrichene Crotales als schärfste Waffen im Diskant. Symbolisiert gegen Schluss Bachsche Kontrapunktik das Erreichen eines paradiesischen Zustands? Dunkles Blech und geheimnisvolles Schlagzeug stellen dies zumindest infrage, während Hardenberger als letztes Statement einsam ein dreigestrichenes Es verhaucht.
Selten einmütiger Applaus für eines der besten Werke Widmanns überhaupt, für ein in jeder Sekunde aufmerksam und empathisch mitgehendes BRSO und selbstverständlich die musikalische Glanzleistung des dann sehr glücklich wieder aus dem Off erscheinenden Solisten. Widmann wird zu Recht für die Erfüllung der hohen Erwartungen in allen drei Funktionen bejubelt – das soll ihm erst mal jemand nachmachen!
[Martin Blaumeiser, 1. Juli 2024]