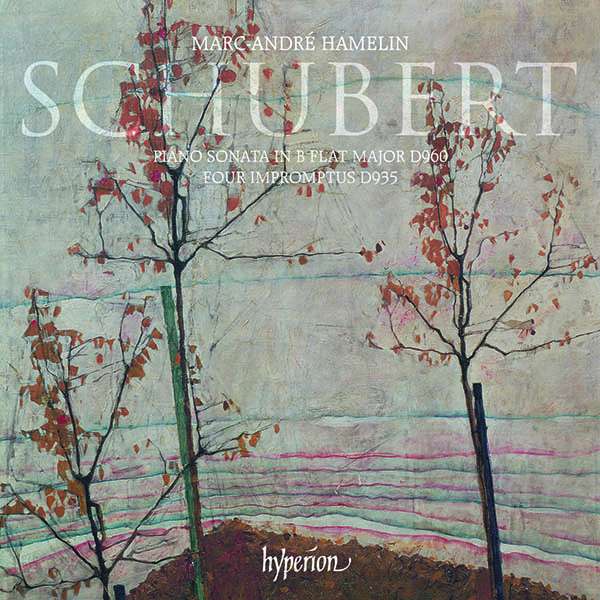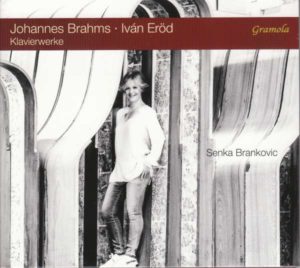Der Chor des Bayerischen Rundfunks lädt gemeinsam mit dem Münchner Kammerorchester und dem Dirigenten Yuval Weinberg ein, neue musikalische Horizonte zu erkunden. Im Münchner Prinzregententheater geben sie am 17. November 2018 ein Konzert mit zeitgenössischer Chormusik, bei welchem mitreißende Entdeckungen auf uns warten: Den Anfang macht Bjørn Andor Drage mit seinem „Klag-Lied“ für Soli (Priska Eser, Jutta Neumann, Bernhard Schneider, Christof Hartkopf), Sprechchor, gemischten Chor und Streicher nach einer – zuvor erklingenden – Vorlage von Dietrich Buxtehude. Danach hören wir „Ad genua“ von Anna Thorvaldsdóttir für Sopran-Solo (Anna-Maria Palii), gemischten Chor und Streicher, „Nuits, adieux“ aus der Feder von Kaija Saariaho für gemischten Chor mit vier Solisten (Sonja Philippin, Ruth Volpert, Q-Won Han, Matthias Ettmayr) und „Nocturne (Richter)“ von Thierry Machuel für gemischten Chor a cappella op. 7. Nach der Pause gibt es noch Werke von zwei Klassikern des 20. und frühen 21. Jahrhunderts: Zum einen Krzysztof Penderecki, von dem „Domine, quid multiplicati“ für gemischten Chor a cappella (Andrew Lepri Meyer, Tenor-Solo), „Cherubinischer Lobgesang“ für gemischten Chor a cappella und die „Serenade“ für Streichorchester erklingen; und zum anderen Arvo Pärt, dessen „Berliner Messe“ für Chor und Streichorchester aufgeführt wird.
Dieses Programm ist durchaus gewagt für ein Abonnementkonzert, und doch dürfte es viele der Hörer positiv überrascht und begeistert haben. Kaum jemand aus dem Publikum dürfte die Komponisten der ersten Programmhälfte gekannt oder sogar Musik von ihnen gehört haben: „Horizonte“ lautet deshalb auch das Motto des Konzerts.
Zu Beginn des Programms steht direkt eine Uraufführung, „Klag-Lied“ aus der Feder eines norwegischen Komponisten, von dem bislang kaum Musik über die Landesgrenzen drang: Bjørn Andor Drage. Als Komponist begibt er sich auf die Suche nach einem eigenen und unverwechselbaren Stil, der oft auf Modellen der Barockzeit basiert, welche allerdings nur fragmentarisch Gebrauch finden und zu neuen Formen modelliert werden. Laut Drage liegt eine gesamte Welt in der Zwölftonreihe, alle Kontraste und Extreme lassen sich aus ihrer Ganzheit ableiten. So nimmt die Dodekaphonie auch zentralen Stellenwert im Schaffen Drages ein, wobei sie nicht zwingend im „atonalen“, durch die Zweite Wiener Schule konnotierten Gewand erscheinen muss, sondern auch tonale oder ebenso gänzlich neuartige Stile annehmen kann. Drage braucht keine übermodernen Effekte, um originell zu sein, er bedient sich bekannten Idiomen, um damit eigenes zu schaffen. Das „Klag-Lied“ entstand 2004 nach dem Tod seiner Mutter, ursprünglich als a cappella-Stück, wobei er sich auf das gleichnamige Werk Buxtehudes BuxWV 76 bezieht – diesen veranlasste der Tod seines Vaters zur Komposition des Trauerliedes. Drage begeistert sich für die Musik der Barockzeit mit ihrem stetigen rhythmischen Trieb und fühlt sich zu dem für seine Zeit expressionistisch-fortschrittlichen Buxtehude hingezogen, dessen Gespür für Dissonanz ihn anreizt. Die sich auffächernden kontrapunktischen Bewegungen des Originals extremisierte Drage alleine durch seine Aufteilung der Musiker: Den Chor spaltete er in vier Solisten, einen vierstimmigen Sprechchor und (singenden) gemischten Chor auf, wobei der Text in fünf Sprachen erklingt. In der 2015 entstanden, heute uraufgeführten Fassung teilte er zudem die neu hinzugekommenen Streicher mehrfach und schuf so ein zutiefst komplexes und dichtes Gewebe aus Stimme, Sprache, Tönen und Klängen. Dabei beweist Drage enormes Gefühl für formale Gestaltung: Wellenartig expandiert das Geschehen von zartem Flüstern bis hin zu einem Aufschrei gegen den Tod und kehrt wieder zu seiner Ausgangsstimmung zurück. Immer wieder schwingen Fragmente der barocken Klangwelt mit, doch schon treibt die Musik hinfort und lässt die Anklänge wie ein schwaches Echo vergangener Zeiten erscheinen. Erschüttert bleibt der Hörer zurück; die kurzen Momente der Hoffnung in der Musik negiert Drage und am Schluss tönt noch der mehrsprachige „Schmerz“ nach.
Ebenso überwältigend geht der Abend weiter mit einer zweiten musikalischen Überraschung, der isländischen Komponistin Anna Thorvaldsdóttir. „Ad genua“ (Auf die Knie) bezieht sich wie auch Drages Werk auf Buxtehude, allerdings auf den gleichnamigen zweiten Satz des Oratoriums „Membra Jusu nostri“, welches einzelne Körperteile des Gesalbten besingt. Mit der Einleitung durch die Bässe und Celli zieht uns Thorvaldsdóttir tief hinab, nur um uns mit dem Einsatz des Solo-Soprans wieder zum Licht zu führen. Meditativ, spirituell und naturverwurzelt schwebt die Musik auf sanften Dissonanzen durch immer neu aufgespannte Klangsphären, treibt ohne Nachdruck, aber zielgerichtet auf den Wendepunkt zu, wo der Fall auf die Knie nicht mehr das Ersuchen nach Vergebung darstellt, sonders das Huldigen der ewigen Musik. Hinreißend zart und schlicht singt Anna-Maria Palii das Sopran-Solo, luzide Schönheit schmeichelt der Fragilität dieser Musik zwischen Licht und Schatten. Der Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Kammerorchester rücken die beiden unbekannten Komponisten genau ins rechte Licht, gehen auf deren Klangvorstellungen ein und erfüllen sie mit Farbe und Ausdruck. Yuval Weinberg bewegt sich so sicher und frei in der Musik, als hätte er sich seit Jahren genau diesen Werken hingegeben. Meisterlich erspürt er die Pausen, lässt sie nicht als bloße Lücken im Raum stehen, sondern ergründet ihren Zweck in der Struktur.
Nach zwei derart beeindruckenden Werken lässt sich über das nächste hinwegsehen: „Nuits, adieux“ von Kaija Saariaho. Auch dieses Chorstück bearbeitet Trauer, jedoch nicht auf eine direkt auf den Hörer wirksame Weise, sondern auf eine intellektuell erdenkbare. Saariaho zerfasert die Worte des Chors in einzelne Laute, wobei sie Geräusche imitiert, die sie in der ersten Fassung mit Elektronik erreichte. Man kann sich verschiedene Stadien des Abschieds bis hin zu einer Versöhnung in diese Musik denken, aber wirklich hören tut man nichts davon. Manche Abschnitte wirken so skurril, dass man sich ein Lachen direkt unterdrücken muss: Ist dies gewollt in einem Stück, das Trauer behandelt? Wenn der ganze Chor wild hechelt, zischt, stöhnt und kurzzeitig aufschreit, fällt es schwer, die Ernsthaftigkeit der Thematik nachzuvollziehen.
Thierry Machuels „Nocturne (Richter)“ weist eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte auf, denn die Musik entstand vor dem Text. Ursprünglich schrieb Machuel das Chorwerk nach einem „berühmten Dichter des 20. Jahrhunderts“, doch nach der Uraufführung verweigerten die Erben unerwarteterweise die Rechte am Text – so beauftragte Machuel Benoît Richter, Worte für seine Komposition zu finden, die mit der Musik und deren Wirkung zusammen funktionieren; dies war der einzige Weg, die Partitur zu retten. Das Werk zaubert manch einen interessanten Klang hervor, findet Wendungen, die aufhorchen lassen – und doch fließt die Musik insgesamt etwas blass daher; sie bannt den Hörer nicht, gleitet scheinbar ohne Ziel dahin.
Nach der Pause folgen hochkarätige Werke von zwei Größen der letzten Jahrzehnte, die ineinander verschränkt wurden. Zu Beginn hören wir zwei a cappella-Werke von Penderecki, „Domine, quid multiplicati sunt“ und „Cherubinischer Lobgesang“; sie beide bestechen durch den Umgang mit Tonlagen, Höhen und Tiefen. Mal baut sich die Musik vom Bass her auf bis in die Sopranlage, mal bricht plötzlich die Basis weg; die Stimmgruppen spielen sich gegeneinander auf wie hohe Wellen, bis sie ineinander schwappen und zerfallen. Penderecki nutzt auch die Entfernung zwischen Sopran und Bass, kostet den klanglichen Abstand aus. Im Anschluss erklingt Pärts „Berliner Messe“, die jedoch von Pendereckis Serenade für Streichorchester unterbrochen wird. In der Serenade konfrontieren die Streicher den Hörer mit rauer Härte; die am Anfang stehende Passacaglia attackiert mit unbarmherziger Wucht und rhythmischer Energie, bereits die ersten repetierten Töne laden die Stimmung auf. Das Larghetto lässt kurzzeitig auch gewisse Sentimentalität durchscheinen, die abrupt wieder zerstört wird. Es ist ein packendes Werk, das mit einer Serenade nur wenig zu tun zu haben scheint, aber eben dadurch Aufsehen erregt. Ich hätte sie lediglich Pärts Messe vorangestellt oder es an den Schluss gesetzt, denn das Ohr braucht etwas Zeit, sich in die Neue Welt einzufinden und mit ihren jeweiligen Harmonien zurechtzukommen. Dies jedoch ist der einzige Mangel an dem ansonsten von vorne bis hinten perfekt durchgeplanten Programm, das von einem Werk direkt zum nächsten führt, thematisch, musikalisch und/oder inhaltlich.
Pärts „Berliner Messe“ evoziert sogleich den melancholischen, trüben Klang, den man hier mit nordischer und baltischer Musik verbindet. Jede einzelne Harmonie hat ihren festen Platz, jede Melodie führt folgerichtig in die nächste, alles passt in- und zueinander in feiner Ausgewogenheit. Hinreißend gibt sich die Streicherbegleitung, die eben nicht als Continuo durchgeht, sondern teils ganz fragmentarisch gesetzt ist und dem Chor Raum lässt, sich eigenständig zu entfalten. Inbrünstige Religiosität strömt von der Messe aus, nicht aufdringend, sondern durchdringend.
Große Hoffnung ruht auf dem jungen Dirigenten Yuval Weinberg, der mit seinen 28 Jahren bereits ein solch inniges Musikverständnis beweist und dieses ausnahmslos nachvollziehbar an den Hörer vermitteln kann. Weinberg horcht, lauscht, forscht und lässt entstehen, pausenlos stimmt er den aufkeimenden Klang noch feiner ab und behält dabei die Zügel in der Hand. Daraus resultiert eine zutiefst persönliche, aber auch einheitliche Klangvorstellung, die ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Kammerorchester vertrauen auf das Schaffen ihres Dirigenten und werden nicht enttäuscht, alle Musiker wirken als unzertrennbare Einheit, die wechselnden Solisten bleiben stets mit dem restlichen Ensemble verbunden und auch das Zwischenspiel zwischen Streicher und Sänger funktioniert makellos.
[Oliver Fraenzke, November 2018]

Bestellen bei jpc