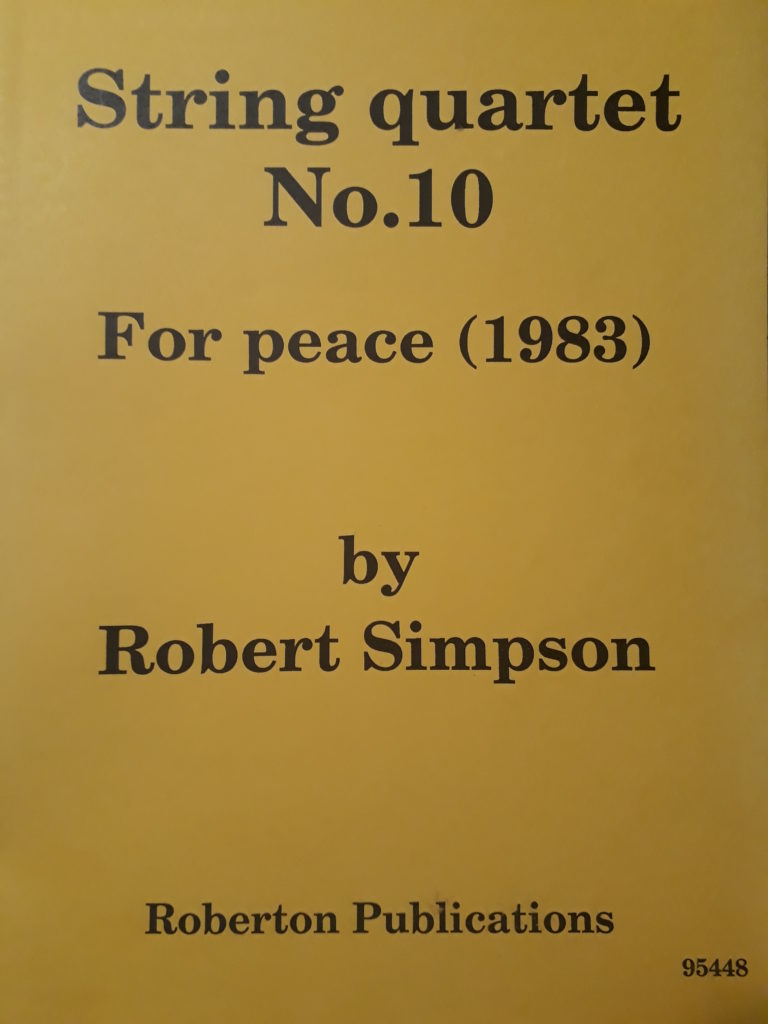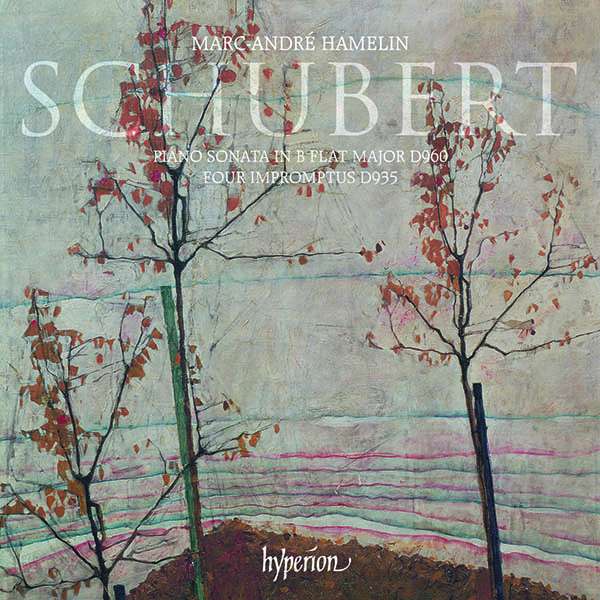Hyperion CDA68397; EAN: 0 34571 28397 5

Drei tschechische Cembalokonzerte des 20. Jahrhunderts präsentiert der aus Teheran stammende Meistercembalist Mahan Esfahani mit dem Prager Radiosinfonieorchester unter Leitung von Alexander Liebreich auf dem Hyperion-Label: Bohuslav Martinůs „Konzert für Cembalo und kleines Orchester“ H 246, Hans Krásas „Kammermusik für Cembalo und 7 Instrumente“ sowie Viktor Kalabis‘ „Konzert für Cembalo & Streichorchester“.
Die drei Werke für Cembalo und Ensemble bzw. kleines Orchester, die Hyperion hier mit Mahan Esfahani und dem Prager Radiosinfonieorchester unter Leitung von Alexander Liebreich vorgelegt hat, spiegeln in gewisser Weise die Vielfalt tschechischer Musik des 20. Jahrhunderts wider. Der aus Teheran stammende, in den USA aufgewachsene und zunächst dort ausgebildete Esfahani war der letzte Schüler der legendären Cembalistin Zuzana Růžičková (1927–2017) und lebt nun sogar in Prag. Neben seinen gefeierten Bach-Aufführungen und Einspielungen hat er sich schon immer gleichermaßen für zeitgenössische Literatur eingesetzt.
Abgesehen von der Musik des Barock, die – folgt man historischer Aufführungspraxis – selbstverständlich das Cembalo benötigt, war das Instrument durch die Fortschritte im Klavierbau als Soloinstrument mit Orchester lange obsolet geworden. Erst mit eben dem zunehmenden Interesse an historisch „korrekten“ Interpretationen Alter Musik sowie dem aufkommenden Neoklassizismus ab den 1920er Jahren, schrieben einige Komponisten dann auch wieder Cembalokonzerte. Die hier präsentierten Gattungsbeiträge waren schon Paradenummern von Růžičková und wurden von ihr ebenfalls eingespielt.
Bohuslav Martinůs (1890–1959) Konzert für Cembalo und kleines Orchester H 246 entstand 1935 für die französische Cembalistin Marcelle de Lacour, eine Schülerin der berühmten Wanda Landowska. Der Komponist traut allerdings insbesondere dem gegenüber tiefen Streichern mit Stahlsaiten eher schwachbrüstigen Bass nicht: So gibt es neben dem Cembalo noch ein obligates Klavier im kleinen Ensemble, das nicht nur den Bass unterstützt oder ganz übernimmt, sondern durchaus auch mal solistisch in den Vordergrund tritt und dem Cembalo zeitweise die Schau stiehlt. Andererseits ergeben sich dadurch feine, sehr interessante Klangkombinationen – das Zusammenspiel beider Instrumente haben später andere Komponisten, z. B. Elliott Carter oder Frank Martin, erneut aufgegriffen. Der Cembalosatz ist gegenüber dem nur oberflächlich an das Concerto Grosso erinnernden, recht brav agierenden Ensemble mit vielen Dissonanzen angereichert, ohne das Ganze zu dekonstruieren. Esfahani spielt mit Leidenschaft; Liebreich begleitet präzise, setzt aber kaum eigene Akzente. Zwar reicht Martinůs Stück nicht an die beiden folgenden Werke heran, man langweilt sich freilich keine Sekunde.
Hans Krása (1899–1944) wird heute gern zu den Theresienstädter Komponisten gezählt, obwohl natürlich die meisten seiner Werke vor der Internierung entstanden sind, darunter die wunderbare, zweisätzige Kammermusik für Cembalo und 7 Instrumente (1936). Krása entstammte einer deutschsprachigen, jüdischen Prager Familie, und in seiner Musik spielen ebenso deutsche Traditionen eine viel größere Rolle als etwa beim gleichaltrigen Pavel Haas – beide wurden am selben Tag in Auschwitz ermordet –, der mehr der Janáček-Nachfolge zuzurechnen ist. Esfahani steigt mutig in die hier vorherrschende, oft dichte Kontrapunktik ein – über Strecken nur die solistischen Bläser begleitend, in den eigenen Soli recht zerbrechlich wirkend, aber immer mit Charme. Das Stück ist mit seinen Anklängen sowohl an zeitgenössische Popularmusik (eigenes Liedzitat im 2. Satz, fast wie Kurt Weill) wie auch durch seinen klar kammermusikalischen Charakter vielschichtiger als Martinůs Konzert – wirklich großartige Musik.
Zuzana Růžičková dürfte Krása in Theresienstadt begegnet sein – später überlebte sie Auschwitz und Bergen-Belsen. Seit 1952 war sie mit dem Komponisten Viktor Kalabis (1923–2006) verheiratet, der ihr mehrere Werke gewidmet hat. Kalabis‘ Musik – u. a. fünf Symphonien – führt gerade in Deutschland noch immer ein Schattendasein: Dabei verbindet sie auf sehr persönliche Weise neoklassizistische Elemente mit avantgardistischeren Techniken bis hin zum Serialismus und ist quasi ein Musterbeispiel für die unterschiedlichen Tendenzen in der ehemaligen Tschechoslowakei nach dem 2. Weltkrieg. Trotz der Besetzung nur mit Streichern überzeugt sein Cembalokonzert von 1975 durch eine ungemeine Farbigkeit und Differenziertheit, die Liebreich wunderbar herüberbringt. Esfahani beherrscht die außerordentliche Virtuosität des Cembalosatzes souverän, kommt an seine Lehrerin durchaus heran. Dieses fast halbstündige Konzert ist ein Gipfelwerk der Gattung. Sowohl die Lyrik des Andantes als auch die atemberaubende Beweglichkeit des abschließenden Allegro vivos – hier alles sehr bewusst vorgetragen – versetzen den Zuhörer in Staunen. Jeder Cembalist sollte dieses Stück kennen!
Die Neuaufnahmen machen Růžičkovás Interpretationen keinesfalls überflüssig. Zumindest aufnahmetechnisch sind sie deren Einspielungen aus den 1980ern und 1990ern deutlich überlegen. Das Klangbild ist hier geradezu optimal – durchsichtig und hochdynamisch. Zudem sind die drei wertvollen Stücke so bislang nie auf einer CD zu hören gewesen, die schon deshalb eine klare Empfehlung verdient.
[Martin Blaumeiser, November 2023]