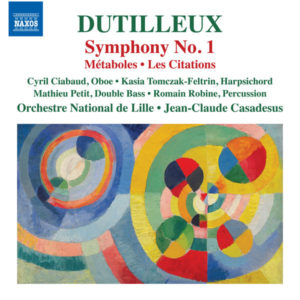Bartóks „Herzog Blaubart“ traf auf Schönbergs „Erwartung“
Da Béla Bartóks Einakter „Herzog Blaubarts Burg“ aus dem Jahr 1918 einen kompletten Abend zeitlich nur unzureichend ausfüllt, ist auf den meisten Bühnen die Kombination mit einem anderen kürzeren Stück Standard. Auch das Essener NOW-Festival setzte auf dieses bewährte Konzept zum Beginn des alljährlichen zweiwöchigen Konzertmarathons im Ruhrgebiet – und brachte mit Arnold Schönberg und dessen atonalem Monodram „Erwartung“ eine weitere Lichtgestalt der frühen Moderne ins Spiel.
Die Burg ist finster und rätselhaft. Warum weinen die Mauern? Was verbirgt sich hinter den geschlossenen Türen? Was wird sich noch alles in den versteckten Winkeln der Seele von Herzog Blaubart, diesem rätselhaften Mann und Gebieter verbergen? Wie sehr ist diese Burg doch ein Stein gewordenes Psychogramm der menschlichen Seele! Und mittendrin wirft die Liebe mehr Fragen auf, als das Antworten geliefert werden.
Um all dies sinnlich erfahrbar zu machen, stand im Alfried-Krupp-Saal viel souveränes Potenzial zur Verfügung: Vertretungsweise eingesprungen für den verhinderten Dirigenten Henrik Nanasi war der aus Wien stammende Gastdirigent Friedemann Layer. Und der leistete auf Anhieb genau das richtige, um die fantastischen Möglichkeiten des Essener Orchesters mit kontrollierter Intuition aufzuspüren und all dies schließlich in eine berstende Spannung hinein zu steigern.
Düstere Quartenmotive vor allem der Celli wollen auf Anhieb sagen, dass hier eine Innenwelt im Aufruhr ist. Das Darsteller-Paar lebt einen psychoanalytisch besetzen Geschlechterkonflikt mit ganzer Intensität. Die Niederländerin Deidre Angenent fordert als in dieser halbszenischen Aufführung als Judith, die neue Frau des Herzogs, mit flexiblem Mezzopran und einer authentisch wirkenden Körpersprache ihren rätselhaften Geliebten heraus. Dieser möge alle Türen seines düsteren Hauses, aber eben auch seiner Seele öffnen und alle, auch die letzten, möglicherweise verstörenden Geheimnisse offenbaren. Herzog Blaubart selbst wird von dem Amerikaner Andrew Schroeder, Bariton verkörpert – der wiederum dieser Rolle betont menschliche Züge verleiht – ein angenehmer Zug, wo andere Blaubart-Intepreten diese Rolle gerne etwas zu vorauseiland dämonisieren. Blaubart gibt schließlich nach und gibt den Blick frei auf Waffenkammern, Tränenseen, imaginäre Schätze – und stellt schließlich die ganzen verflossenen Gespielinnen im eigenen Lustimperium zur Schau. Die ganze imaginäre Kraft der bildgewaltigen Story wird in diesem Moment allein durch die Macht der Musik und die Präsenz der Darsteller hautnah erfahrbar.
So, wie Bartóks Blaubart-Partitur durchaus noch nicht den wirklich radikalen Bartók offenbart, sondern gerne auch mit Spurenelementen von Richard Strauss und Debussy sowie natürlich mit osteuropäischen Volksmusik-Elementen kokettiert, so reagiert in Arnold Schönbergs einsätzigem Monodrama „Erwartung“ viel spätromantisch-sinfonisches Kolorit mit einer radikalen, unmittelbar auf den Ausdrucksmoment bezogenen, atonalen Klangsprache. Einmal durch den furiosen Bartok vor der Pause in Fahrt kommen, lässt das Orchester auch hier sämtliche Möglichkeiten einer ausdrucksintensiven Überwältigung vom Stapel und dies weiterhin in kluger, den weitgespannten Bogen berücksichtigenden Dosierung. Und das dient nach der Pause vor allem einem Zweck – nämlich der Ausnahme-Sopranistin Angela Denoke, Sopran alles zu geben, was diese zur Entfaltung ihres stimmgewaltigen, mimisch eindringlichen, dramatischen Potenzials braucht. Denoke ist – man braucht es nicht zu erwähnen, wer sie zum Beispiel als Walküre kennt – auf Anhieb bestens in ihrem Element, um hier in ihrer schlicht und einfach als „eine Frau“ betitelten Rolle, einen Sehnsuchts-Höllentrip zu zelebrieren, der keinen Stein auf dem anderen lässt. Welche Energien dieser Gesang auftürmt, dabei detailscharf sämtliche Nuancen ausgeleuchtet und dies auch in akrobatischen Intervallsprüngen bebende Höhepunkte erfährt, das wirkt in Essen schlichtweg atemberaubend! Was in Marie Pappenheims metapherngesättigtem Libretto passiert und was Schönbergs Partitur mit so viel unheimlichen, bittersüßen Emotionen auflädt, bringt im Kopf unmittelbar einen düsteren Film Noire in Fahrt: Die weibliche Hauptperson, alleine gelassen, verliebt, durchdrungen von verlangender Begierde, aber auch zerfressen von Verlustängsten, irrt durch einen dunklen Wald. Auch die Kühle des Mondlichts verspricht hier keine Zuflucht mehr. Schließlich findet sich der Geliebte, im Gesprüpp liegend, tot. Ermordet. Es geht hier nicht um das Warum! Ein expressionistisches Sujet wie dieses zeigt sich konsequent darin, nicht über das unmittelbar Zuständliche hinaus zu gehen. Wenn all dies dann noch durch Angela Denokas Bravourauftritt und dieses hochmotivierte Essener Orchester geadelt werden, wirkt alles nur noch faszinierend unentrinnbar.
Mittlerweile schon ein ganzes Jahrhundert alt, funktionieren diese grenzensprengenden Meisterwerke auch heute absolut zuverlässig, um ein aufnahmebereites Publikum in ungeahnte, elementare Zustände zu katapultieren. Daher war dieses Opern-Doppelpack auch ein würdiger Auftakt für ein Festival, das sich in seinem Kerngeschäft vor allem der Neuen Musik widmet. Bis zum 4.11. sind beim Essener NOW-Festival noch zahlreiche Konzerte, Uraufführungen und Percormances zu erleben.
[Stefan Pieper, Oktober 2018]
Infos unter:
https://www.theater-essen.de/spielplan/a-z/programmvorstellung-festival-now-2018-82202/