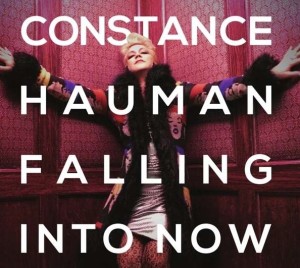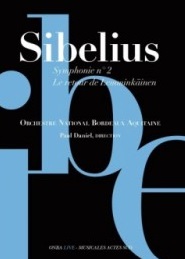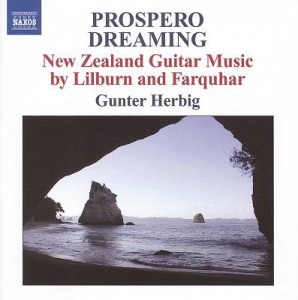ODE 1270-2, ISBN: 0 761195 127025

Mit Orchesterwerken Toivo Kuulas leistet das Philharmonische Orchester Turku, unter der Leitung von Leif Segerstam, einen Beitrag zur Pflege finnischer Komponisten. Gespielt werden dessen beiden Südosterbothnischen Suiten (Nr. 1, op. 9 und Nr. 2, Op. 20) sowie der Festmarsch Op. 13 und Preludium und Fuge Op. 10.
Jean Sibelius, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiert, polarisiert bis heute Musiker und Musikwissenschaftler vor allem im deutschen Sprachraum, was seiner internationalen Reputation, ja Vergötterung als DER Komponist Finnlands nicht schadet, diese sogar gewissermaßen verstärkt. Umso erfreulicher und abwechslungsreicher ist es, wenn der Fokus hin und wieder dann auf dessen Zeitgenossen fällt und deren Talent Tribut zollt – wie zum Beispiel Toivo Kuula, einem viel zu früh abberufen Komponisten (1883 – 1918). Zu früh, da er im Zuge von likörseligen Feierlichkeiten zum Ende des finnischen Bürgerkrieges erschossen wurde – wie der solide, leider nur in Englisch und Finnisch verfasste Booklettext von Kimmo Korhonen verrät. Und Kuula war einer, der zweifelsohne großes Talent hatte.
Ein seinem Temperament entsprechendes, zugleich genrebedingt plakatives Beispiel ist der eröffnende Festmarsch Op. 13 (Juhlamarssi). Bereits hier erweist Kuula seinem Ruf als Melodiker und finnischer Patriot alle Ehre. Das beginnende C-Dur-Thema im Horn weist bereits auf ein fernes Idyll voraus, auf das man im Jahre 1910 noch flehentlich wartete (und das in seiner Motivik sicher nicht zufällig an die Alphornweise „Hoch auf´m Berg, tief im Tal grüß ich dich viel tausend Mal!“ im Schlusssatz von Brahms´ 1. Symphonie in c-Moll Op. 68 erinnert). Gekonnt spinnt der Komponist seinen dreiteiligen Hymnus weiter und spart dabei nicht mit direkten Perkussionseffekten, bei deren Lärm es der Phantasie des Hörers überlassen bleibt, ob man dahinter Schlachtsalven des Krieges oder Gewehrspaliere im Zuge der gewonnenen Freiheit heraushören soll. Nun wäre es ungerecht zu sagen, der Juhlamarssi lebe nur von seiner Vordergründigkeit; Kuula beherrscht, zur Zeit der Komposition 27 Jahre alt, alle Facetten des Orchesters und die Fähigkeit zum Kontrast. Besonders schön gelingt dies im Mittelteil, wenn die Hymne und die wirklich permanenten Beckenschläge sich beruhigen. Denn dort stimmen die Klarinetten eine Art Trio an, das Melancholie in e-Moll sowie zarte Geigeneffekte in sich vereint. Auch die Philharmoniker aus Turku, die hier unter der Leitung von Leif Segerstam zu hören sind, geben den Zauber dieses etwas kurzen Mittelteils schön wieder. In gleicher Weise stürzen sie sich mit Inbrunst auf die eigentlichen Marschabschnitte, wobei gerade bei solch einem Werk und einem Dirigenten wie Segerstam etwas mehr Differenzierung zwischen den Lautstärken wünschenswert wäre, kurz etwas weniger des Guten. Das gilt besonders für die Trompeten, die vor allem bei den Spitzentönen hörbar an ihre Grenzen gelangen.
Deutlich mehr musikalischen Atem offeriert die größtenteils 1906/07 entstandene Erste Südostbottnische Suite Nr. 1, Op. 9, benannt also nach dem zentralwestfinnischen Bundesstaat, der am Ostufer der bottnischen Meerbusens liegt. Gleich beim ersten Satz Landschaft (Maisema) treten einerseits sowohl die sehr intonationssicheren Holzbläser als auch die tiefen Streicherbässe, also Bratschen bis Kontrabässe hervor. Andererseits hört man von den laut Partitur zupfenden Violinen gleich zu Beginn so gut wie nichts, was auch später im Satz auffällt. Das Herz des Stückes, das sehr elegische Englischhornsolo, trägt der Solist Satu Ala zwar mit einem guten, bewusst schlichten Ton vor (mit einer sehr dezenten Streicherbegleitung). Jedoch lässt er dieses (gerade für die Tempobezeichnung Moderato) zu schnell vorüberziehen, wodurch der Eindruck von etwas abgeflachter Tiefe der Empfindung entsteht, insbesondere durch die eher geringen dynamischen Abstufungen. Überhaupt zählt die Differenzierung der Dynamik eher zu den Schwächen zumindest in Maisema, etwa auch bei dem ans Solo anschließenden Streicherchoral, wo von Beachtung des pianissimo keine Rede sein kann. Allerdings hebt Segerstam diese Mängel gegen Ende etwas auf, wenn die Pizzicati eher zu hören sind und er das den Satz beschließende Largamente dezent wörtlich nimmt.
Dass sich Kuula in seinem Werk auf finnische Folklore konzentriert, beweist auch das daraufhin erklingende Volkslied (Kansanlaulu). Die bloße Streicherbesetzung lässt nicht zufällig an ähnlich besetzte Werke Edvard Griegs, Johan Svendsens oder Jean Sibelius’ denken. Eine sehr melancholisch gefärbte e-Moll-Melodie, zuerst im Solocello, später in den Violinen, wird von einem harmonisch vielfarbig angereicherten Choralsatz begleitet, der dem Stück einen sehr schlichten Glanz verleiht. Die Tatsache, dass der Klangkörper aus Turku hier eher ein Moderato denn das vorgegebene Adagio zum Tempo nimmt, kann man verschieden beurteilen, immerhin handelt es sich hier ja um ein Volkslied – und dieses sollte nicht zu prätentiös klingen. Von einem ähnlichen Charme ist der darauf erklingende südostbottische Tanz (Pohjalainen tanssi) mit seiner schlichten dorischen Weise und der etwas eigenwilligen melodischen Bauart. Gerade dieses Mittelstück der Suite lebt von seiner Schlichtheit und einer bis dahin ungewohnten dynamischen Ausgeglichenheit, gerade was die Integration der Pauken anbelangt. Ebenfalls sehr einfalls- und kontrastreich ist das vierte Stück der Suite, der Teufelstanz (Pirun Polska). In seiner Anlage deutlich ein Scherzo, bietet dieser Satz nicht nur ein metrisch unbestimmtes Thema (trotz Dreivierteltakt), sondern auch eine bemerkenswerte musikalische Entwicklung, bei der auch die Orchesterfarben eine Rolle spielen. Einzig die Holzbläser treten beim Fortissimo des Scherzos zu sehr in den Hintergrund, fallen aber im Trio dafür umso schöner ins Gewicht.
Den großangelegten Schlusssatz der ersten Südostbottnischen Suite, Lied der Dämmerung (Hämärän laulu) empfanden zwei bedeutsame Lehrer Kuulas aus Bologna, Enrico Bossi und Luigi Torchi, als wunderbar, kritisierten aber dessen Orchestrierung. Wahrscheinlich bezogen beide sich auf die Tatsache, dass Kuula bereits vom monumentalen Beginn des Satzes an bemüht war, bei aller Spannung einen dennoch differenzierten Klang aufgrund der reichhaltigen Form zu erzielen. Eine pavaneartige Melodie im alla-breve-Metrum baut sich Stück für Stück zu einer eher dunklen Hymne auf und wird in ihrer Schlichtheit darin kontrastiert, dass Kuula auch hier seine akkordischen Raffinessen spielen lässt. Dem gegenüber steht ein luzides Thema im Englischhorn, welches dem Finale einen eher tänzerischen Charakter verleiht, obgleich auch hier bereits eine hymnische Steigerung eintritt. Alsbald wechselt das Geschehen wieder ins Tempo primo, der archaische Anfang kehrt wieder, nur breiter und pathetischer und mündet schließlich in einem Beckenschlag, woraufhin das Ganze, mit letzten Partikeln der motivgebenden Quarte d-d-a, leise erlischt. Die heterogene Form von Hämärän laulu hat gleichermaßen ihre Stärken und Schwächen; zumindest bemüht sich Leif Segerstam mit den Turkuer Philharmonikern, diese unter einen Bogen zu zwängen und mechanische Stereotypen zu vermeiden, was größtenteils auch gelingt.
Dass die zweite Südostbottnische Suite sieben Jahre später entstanden ist (1912/13), hört man am fortgeschrittenen kompositorischen Handwerk Kuulas. Sehr reizvoll und anfangs pittoresk erklingt die Ankunft der Braut (Tulopeli), wenn die Hörner mit einem Signal in Mahlerscher Manier beginnen und aus dem darin enthaltenen Motivmaterial ein immer mächtiger orchestriertes Fugato formen. Leider gerät zwar das Orchester mit dem Streichereinsatz deutlich ins Schleppen, gewinnt dafür jedoch bei vollem Tuttieinsatz wieder an Tempo. Erfreulich ist die hier wohlbedachte Steigerung gegen Ende, was vor allem die dynamische Auskostung bis hin zum fff anbelangt. Der darauffolgende Regen im Walde (Metsässä sataa) zeigt besonders deutlich, zu welch raffinierten Instrumentationslösungen Kuula in der Lage war. Über einem huschenden Streichersatz werfen die in ihrer Besetzung erweiterten Holzbläser modal gefärbte Signale in den Raum, die dem Ganzen eine besondere Exotik verleihen. Die Beschäftigung Kuulas mit Debussy ist hier deutlich zu spüren, gleichwohl offenbart der Komponist vor allem in der Mitte des Satzes seine eigene Handschrift, wenn sich klare Tutti-Konturen ergeben. Die Philharmoniker nehmen das Allegro durchaus wörtlich, schaffen es jedoch auch, die besondere Atmosphäre dieses Satz wiederzugeben.
Wie auch in der ersten Suite haben die Streicher einen Satz alleine. Wieder ist es die auffällige Nähe zu anderen nordisch-romantischen Vorbildern, die der dritte Satz, ein Menuett (Minuee), suggeriert, ohne dass jedoch auch nur der geringste Eindruck von Nachahmung etwa Griegs entstünde. Das Prinzip ist hier ähnlich wie in Tulopeli: ein zierliches Thema gibt dem Satz ein Gerüst, welches immer größer und breiter wird bis hin zum Schluss. Da hätte es den recht klangfreudigen Ausführenden nicht geschadet, wenn sie das Moderato nicht allzu wörtlich genommen und dem Satz etwas mehr Schwung verpasst hätten. Ausgewogener klingt der Tanz der Waisenkinder (Orpolasten polska), der in seiner kompakten Kürze und originellen Instrumentierung eine nahezu schwerelose Melancholie ausstrahlt. Gerade mit diesem Intermezzo beweist Kuula seinen herrlichen Facettenreichtum.
Das abschließende Irrlicht (Hiidet virvoja viritti) bekräftigt, ähnlich dem Schlusssatz der ersten Südostbottnischen Suite, allein schon durch seinen Titel wiederum die monumentale Ader des Komponisten. Abgesehen von dem arg vibrierend eröffnenden Cellosolo bietet der Satzanfang in den ersten drei Minuten dennoch eine klanglich sehr abwechslungsreiche (dank zweier Harfen und Celesta), gleichwohl deutlich dramatischere Szenerie als das Vorhergehende. Nachdem daraufhin das dunkle Cellothema wieder ertönt und die klangliche Schärfe des Tuttis zu einem ersten Höhepunkt findet, beginnt der Satz eher zu fließen, sprich in einen Kehraus zu führen. Kuula verleugnet auch hier nie seine gereifte Meisterschaft der Instrumentierung, alles klingt luzide und leicht. Zunächst. Dass der Schein aber trügt, merkt man mit einem schleichenden Wechsel, harte Klangballungen nehmen immer weiter zu, es entsteht eher eine Nähe zum Symphoniker Sibelius und dessen fluoreszierenden Klangkaskaden. Wie mittlerweile zu erwarten, kommt es auch hier zu einem machtvollen Höhepunkt, schließlich hält das Geschehen inne. Zuletzt ergibt sich auch hier die dreiteilige Form-Symmetrie, das Ende kommt dann überraschend schlicht und ohne äußerliche Dramatik daher.
Anhand der beiden Suiten hat sich gezeigt, wie entscheidend Toivo Kuula sich in wenigen Jahren entwickelte, aber auch, wie gleichermaßen finnisch und kosmopolitisch, wie gleichermaßen temperamentvoll und einfühlsam-differenziert seine künstlerische Gestaltung war. Das letzte Beispiel dieser CD, Präludium und Fuge Op. 10 (1909), belegt dies nochmals eindrucksvoll. Über einem Bass-Ostinato, das hier leider etwas zu leise erklingt, intonieren die Klarinetten und Oboen eine einfache achttaktige Melodie in c-moll, auf deren Basis sich das formal sehr geschlossene Präludium aufbaut und ebenso wieder abklingt. Die Kontinuität gelingt dem Orchester passabel, das Largamente in der zweiten Hälfte kommt verhalten. Einen kraftvollen Bogen spannt die Fuge, die sowohl alle Elemente der Bach-geschulten Kontrapunktik (c-Moll-Soggetto, gekonnte Dux-Comes-Behandlung), als auch eine konsequente Ausschöpfung des Orchesterapparates bereithält. Vor dem Hintergrund der mehr fantasiegesteuerten Suiten erscheint eine solche Tonschöpfung natürlich etwas trocken als Konklusion. Allerdings wäre Toivo Kuula nicht er selbst, wenn er nicht auch dieser Fuge einige dramatische Akzente verpassen würde, außerdem ist seine Orchesterfuge auch insofern eigenständig, als sie auf wirkungsvolle (Schlagwerk-)Effekte etwa der Bach-Bearbeitungen eines Schönberg oder Elgar verzichtet.
So bleibt abschließend folgendes Resümee zu ziehen: Mit Toivo Kuula haben die Philharmoniker aus Turku und ihr unermüdlicher Maestro Leif Segerstam einem Komponisten, dem trotz geringer Lebenszeit ein sehr bemerkenswertes Œuvre gelang, beeindruckend Respekt gezollt. Mag auch ihre Darbietung nicht frei von Schwächen und Unausgereiftheiten sein, so ist diese CD dennoch ein eindrucksvolles, beredtes Zeugnis der künstlerischen Neugier eines der weltweit ältesten Orchester überhaupt, das mit Kuula dem jungen Wilden der Epoche des kulturellen Aufbruchs einer finnischen Identität huldigt.
[Peter Fröhlich, November 2015]