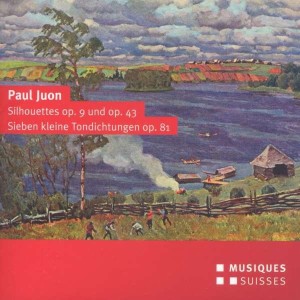Am 10. und 11. Juli 2022 spielte die Staatskapelle Weimar in der Weimarhalle unter der Leitung von Giedrė Šlekytė ihr zehntes Symphoniekonzert der Spielzeit 2021/22. Es erklangen Jean Sibelius‘ Violinkonzert und Sergej Rachmaninows Symphonie Nr. 1 sowie, als deutsche Erstaufführung, Saudade von Žibuoklė Martinaitytė. Als Violinsolistin war Rebekka Hartmann zu hören. Die folgende Besprechung bezieht sich auf das Konzert vom 11. Juli.
Der Abend begann vielversprechend mit zeitgenössischer Musik. Die 1973 geborene, in New York lebende litauische Komponistin Žibuoklė Martinaitytė hat bislang vorrangig mit ihren Orchesterwerken Aufmerksamkeit erregt. Ihr Stück Saudade, ein einsätziges Werk von etwa einer Viertelstunde Dauer, stammt aus dem Jahr 2019 und war an den beiden Weimarer Konzertabenden zum ersten Mal in Deutschland zu hören. Der Begriff „Saudade“ stammt aus dem Portugiesischen und bezeichnet „ eine Meta-Nostalgie, ein Sehnen, das auf die Sehnsucht selbst ausgerichtet ist“, wie die Komponistin in ihrer Werkeinführung schreibt. Dieser Zustand wird durchaus schlüssig in Musik übersetzt. Ohne dass man von Themen oder Motiven sprechen könnte, sind doch über den Verlauf der Komposition gewisse Grundbausteine präsent, die dem Werk ein einheitliches Gepräge geben. Man hört immer wieder fluktuierende Cluster aus Stufen der Molltonleiter, die sich einem Niederlassen auf dem Grundton verweigern und dadurch nie zur Ruhe kommen. An Glissandi und feinen chromatischen Umspielungen spart Martinaitytė nicht, ohne dass dabei der diatonische Grundcharakter der Musik verloren ginge. Die Form ist leicht zu überblicken: Nach einer längeren statischen Eingangsphase steigt die Musik in die Tiefen der Kontrabässe hinab, bevor sie allmählich zum blechbläserdominierten Tutti anwächst und schließlich leise verklingt. Die ganze Zeit über wirkt die Musik entrückt, wie eine Folge poetischer Impressionen aus fein abgestuften orchestralen Grautönen, in welchen sich Naturlaute mit Klängen mischen, die an einen Synthesizer gemahnen. Die Aufführung durch die Staatskapelle unter dem Dirigat Giedrė Šlekytės, einer Landsfrau Martinaitytės, wirkte rundum gelungen, sodass man von dem Werk einen positiven Eindruck bekam. Nichts deutete darauf hin, wie sich der Abend noch entwickeln würde.
Mit Rebekka Hartmann konnte für das Violinkonzert von Jean Sibelius eine Solistin außerordentlichen Formats gewonnen werden, sodass, rein auf die Solostimme bezogen, die Aufführung dieses Werkes eine überragende musikalische Leistung genannt werden muss. Rebekka Hartmann besitzt einen untrüglichen Sinn für die musikalische Form, für den Zusammenhang der Töne. Jede Note ist ihr bedeutungsvoll, spielt eine Rolle im Ganzen. So wirken unter ihren Händen selbst Passagen in raschesten Notenwerten nie verwischt, übereilt oder bloß absolviert. Alles atmet und gerät in Schwingung, die Violinstimme erscheint bis in kleinste Einzelheiten hinein ausgeleuchtet und von Leben durchpulst. Aber welch ein prosaisches Tun dagegen im Orchester! Wie jedes der großen symphonisch angelegten Violinkonzerte lebt auch das Sibeliussche von der Interaktion des Soloinstruments mit den orchestralen Kräften. Was hilft es also, dass eine beseelte Musikerin das Solo spielt, wenn das Orchester sich damit begnügt, nur den Hintergrund zu liefern und nicht einmal versucht, einen Dialog auf Augenhöhe entstehen zu lassen? Es folgte hier lediglich gehorsam dem Taktstock der immer ordentlich taktierenden Dirigentin, die sich mit einer bloßen Koordinatorenrolle zufrieden zu geben schien, und lieferte schwunglos eine matte Begleitung zu Rebekka Hartmanns begnadetem Spiel.
Die Aufführungsgeschichte von Sergej Rachmaninows Erster Symphonie zeigt eindrücklich, was einem Meisterwerk blühen kann, wenn seine Premiere missglückt. Die Uraufführung 1897 unter der Stabführung Alexander Glasunows muss den Berichten zufolge zu einem furchtbaren Durcheinander ausgeartet sein; mit dem Ergebnis, dass der tonangebende Kritiker César Cui dem Werk bescheinigte, als Programmmusik über die Sieben Plagen Ägyptens durchgehen und „alle Bewohner der Hölle in geradezu köstlicher Weise erfreuen“ zu können. Bekanntlich litt der Komponist anschließend jahrelang unter Depressionen, gab die Symphonie nie mehr zur Aufführung frei und veröffentlichte sie nicht. Zwischenzeitlich verschollen, kam sie erst nach seinem Tod wieder ans Licht und wurde mit einem halben Jahrhundert Verspätung endlich als die musikalische Großtat erkannt, die sie ist. Ist das nicht eine Mahnung an die Dirigenten, sorgsam mit den ihnen anvertrauten Werken umzugehen und ihnen die bestmögliche Pflege zuteil werden zu lassen? Ich gehe zu Giedrė Šlekytės Gunsten davon aus, dass sie die Probenzeiten vor allem nutzte, um in diesem Sinne für Žibuoklė Martinaitytės Werk zu wirken, und ihr schlicht die Zeit fehlte, bei Sibelius und Rachmaninow mehr als routinierte Aufführungen zu Stande zu bringen. Hätte Glasunow die Rachmaninowsche Symphonie seinerzeit so dirigiert wie Giedrė Šlekytė, so wäre die Aufführung kein Fiasko geworden, aber auch nicht mehr als gut koordinierte Routine. Die Dirigentin sperrte das Werk in einen Käfig aus Taktstrichen. Nirgendwo hatte man das Gefühl, als animiere sie die Musiker dazu, weiter als bis zum nächsten Takt zu denken. So wirkten die Ecksätze grobschlächtig und stumpf martialisch, immer auf die „Einsen“ der Takte fixiert, wohingegen sich das Adagio müde von Ton zu Ton fortschleppte. Das Scherzo gelang noch am relativ besten und entwickelte eine gewisse Leichtigkeit, ohne dass dies am insgesamt ernüchternden Eindruck des Ganzen viel ändern konnte.
[Norbert Florian Schuck, Juli 2022]