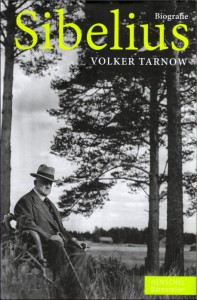Die Norddeutsche Orchesterakademie feierte unter der Leitung von Kiril Stankow den Abschluss ihrer ersten Proben- und Konzertphase mit einem Konzert im großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie am Sonntag, den 8. Juli 2018, um 20:00 Uhr. Hierbei spielten die Musiker der Akademie das Konzert für Violine und Orchester op. 35 von Erich Wolfgang Korngold sowie die Alpensinfonie op. 64 von Richard Strauss. Solist an der Violine war Zsolt-Tihamér Visontay.
Wessen Traum wäre es nicht, in der sogenannten „Sahneschnitte“ Hamburgs, nämlich der Elbphilharmonie, ein Konzert zu erleben oder gar selbst zu geben. Dieser Traum erfüllte sich nun am vergangenen Sonntag für 140 Musikerinnen und Musiker aus aller Welt, eine bunte Mischung aus Laien, Studenten und Profis zwischen 18 und 74 Jahren. Nach einem ersten Auftritt am Tag zuvor in Neubrandenburg brachten sie hier ihr allererstes Projekt krönend zu Ende.
Dazu suchten sich die Musiker ein wirkungsvolles Programm aus: Die gewaltige Alpensinfonie von Richard Strauss steht neben dem mittlerweile bekannt gewordenen Violinkonzert Erich Wolfgang Korngolds, den Strauss nicht zu Unrecht als ein „frühreifes Genie“ bezeichnete. Man sollte sich aber hüten zu denken, jene zwei (in ihrer Geschichte häufig unterschätzten) Werke seien nur zu rein äußerlichen Zwecken gewählt worden, denn es steckt viel mehr Herzblut dahinter, als es beim Hören des Programms den Anschein haben könnte. Sowohl die intensive musikalische Vorbereitung als auch das Management und nicht zuletzt der Abend selbst belegten das Engagement dieses Projektes, das in Hamburg seinen Abschluss gefunden. Von ebenso viel Hingabe zeugt das hintergründig und phantasievoll gestaltete und geschriebene Programmheft, ohne dabei den Laien zu über- und den Kundigen zu unterfordern. Es enthält einen kurzen, aber prägnanten Einblick in die Entstehung des Violinkonzerts, wenngleich vernachlässigt wird, dass der zur Zeit des Nationalsozialismus aus Europa verbannte Jude Korngold seine künstlerische Erfüllung mit diesem Konzert wiederfand. Auch besticht es u.a. durch ein Interview mit dem Dirigenten Kiril Stankow, einem Absolventen der Musikhochschule Weimar, worin dieser sein künstlerisches Credo offenbart: „Wir tauchen ein und geben uns der Suche hin.“
Ein sehr treffendes Motto für diesen gelungenen Abend; schon während der ersten Klänge bannten die Instrumentalistn die Aufmerksamkeit auf ihr Forschen und Entdecken in der Musik: Der erste Satz des Konzerts, Moderato nobile, klang bis in die letzte Nuance durchdacht und schillerte regelrecht, Stankow und die Musiker betonten den rhapsodischen Charakter des Konzertes frei. Dass dieses Werk bei aller Virtuosität und allem Filmmusikanklang dennoch lyrisch und anspruchsvoll sei, wie Ulrike Timm in ihrem Heftbeitrag schrieb, zeigt allein der junge Geiger Zsolt-Tihamér Visontay. Dieser verstand es, die meisten Feinheiten seines Parts schön und ausdrucksvoll zu musizieren und agierte mit dem Orchester absolut ebenbürtig. Dass viele Kritiker und Kollegen Korngold diesen Ausflug in die vermeintliche Trivialität der leichten Muse nicht verziehen, mochte seiner Zeit geschuldet sein, ist im heutigen Stilpluralismus allerdings unverständlich. Vor allem an diesem Abend, wo sämtliche Mitwirkende und der Solist das Konzert mit allem Bewusstsein, in den Tempi nie überhetzt und dezent in sämtlicher Dynamik ertönen ließen. Lediglich einige Spitzentöne gerieten Visontay bei genauem Hinhören nicht ganz sauber, überartikulierte er manch wenige Töne durch überdeutliches Vibrato. Dies alles sind jedoch Lappalien, die den Gesamteindruck des Konzertes in keiner Weise trübten, was auch der Applaus zwischen den einzelnen Sätzen verriet. Der Schluss des ersten Satzes gelang den Musikern eindrucksvoll, allein die makabren Glissandi der Streicher am Ende klangen keineswegs vulgär. Der zweite Satz, die Romance, war ein einziges Idyll, so hauchzart spielten alle miteinander. Und das Finale Allegro assai vivace mit dem berühmten Zitat aus The Prince and the Pauper überwältigte. Nirgendwo klang es überhetzt, dafür hörte man die Spielfreude von vorne bis hinten durch. Selbst in den noch so heroischen Stellen klang der Schlusssatz keineswegs plakativ, sondern durchdacht und zugleich lebendig, nicht zuletzt dank solch unscheinbarer Details wie der leisen Glockenschläge, die hier fein herausklangen.
Ohne Zweifel wussten alle die tatsächlich einzigartige Akustik der Elbphilharmonie zu nutzen. Allerdings klang das durchsichtig instrumentierte Konzert in dieser Atmosphäre etwas „zu perfekt“: Zwar brillierte der Klang lupenrein und makellos, jedoch fehlten gewisse Ecken und Kanten des spontanen Musizierens, so dass ein leicht steriler Beigeschmack blieb. Aber auch dies sei nur am Rande erwähnt und war spätestens bei der Alpensinfonie schnell vergessen: Zwar wirkte deren Beginn, die Nacht, nach dem wunderbar fahlen Fagottsol, etwas zu direkt in den Posaunen, die den motivisch zentralen Choral noch etwas mystischer hätten gestalten können; aber spätestens beim Sonnenaufgang wurde die Darbietung dieses Werkes zu einer Offenbarung. Ab jetzt entfaltete sich die komplette Norddeutsche Orchesterakademie mit hinreißender Energie und tauchte zusammen mit Kiril Stankow in die üppigen Farben dieses Werks ein. Es war, als erfülle sich der philosophische Anspruch der Selbstreinigung und -erhöhung, den der Nietzsche-Kenner Richard Strauss mit seiner Sinfonie hegte (wie Sebastian Handke im Programmheftbeitrag es ausführte).
Jedes Instrument ließ sich mitreißen, selbst die filigranen Harfen waren im vollen Klangkörper gut zu hören. Mehr noch, die Musiker ließen sich an kaum einer Stelle zu bloßer Vordergründigkeit verleiten, sondern gestalteten die Sinfonie „erzählerisch“, sie bildeten klare und eigenständige Abschnitte, die zugleich höchst organisch wirkten und einen wunderbaren Kontrast zwischen lyrischen und rauschhaften Passagen schufen. Dazu bei trug ohne Zweifel der manchmal etwas unklare, aber weitestgehend doch präzise Führungsstil Stankows, der auf flüssige bis rasche Tempi setzte und auf überzeugende Prägnanz, wobei er auf unnötige Monumentalität zu verzichten wusste. Sogar die in den meisten Darbietungen plump dahingeschmetterte Stelle der zwölf Hörner im Hintergrund wirkte plastisch und durchdacht, so dass man sich wirklich wie auf der Jagd fühlt. Überhaupt sind die Blechbläser, insbesondere die Trompeten, besonders hervorzuheben. Mitreißender Höhepunkt war schließlich der Abschnitt Gewitter und Abschnitt, wo allein das Schlagwerk den Eindruck erweckte, der Blitz schlüge über einem ein. Selbst hier vermochte Stankow das Orchester genau zu artikulieren. Die Donnermaschine ging jedoch in ihrem einzigen Einsatz etwas unter durch die überlaute Orgel, die der Organist ansonsten gut zu registrieren wusste.
Es fällt nicht leicht, annähernd kritische Details aus jenem Abend herauszufiltern, so liebevoll wurde das Werk wiedergegeben, was umso mehr erstaunt, wenn man bedenkt, dass die Musiker kaum mehr als eine Woche Zeit zum Proben für diese beiden Kolosse hatten. Freilich gab es manches, was etwas ausgefeilter oder vertieft hätte sein können: So klingt der Sonnenuntergang doch zu geschwind und gleiches gilt auch für den Ausklang, dessen andachtsvoller Charakter dadurch auf der Strecke blieb, wobei andererseits gerade dieses Finale weniger sentimental wirkte. Zumal soll die Melodik laut Partitur „mit sanfter Extase“ gespielt werden, ein Merkmal, das Stankow hervorhob. Überhaupt können jene Kleinigkeiten diese Leistung der Norddeutschen Orchesterakademie, die sich mit der manch eines großen Orchesters vergleichen lässt, kaum minimieren. Es blieb ein gelungener Abend, an den man gerne zurückdenkt. Höchst ärgerlich nur, dass nach dem leisen Schlussakkord direkt jemand aus dem Publikum hineinplatzen musste, anstatt die vom Dirigenten gehaltene Ruhe noch zu wahren. So etwas ruiniert das Ergebnis und ist darüber hinaus absolut unnötig und beschämend! Aber immerhin, der Saal tobte vor Applaus und zum Dank für die Ovationen des Publikums wandte sich das Orchester charmant an alle Seiten, verbeugte sich sogar. Ich wünsche mir sehr, dass diese erfolgreiche Premiere jener Akademie keine Eintagsfliege bleibt und noch weitere so einzigartige Probenphasen und Konzerte, nicht nur in der Elbphilharmonie, möglich sein werden!
[Peter Fröhlich, Juli 2018]