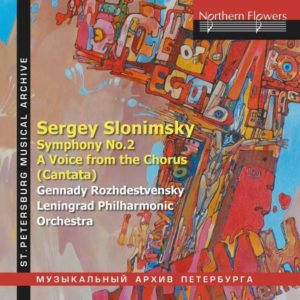Das Theater Trier brachte DIE ZAUBERFLÖTE von Wolfgang Amadeus Mozart, in einer Inszenierung von Heinz-Lukas Kindermann am 28. Juni 2018 zum vorletzten Mal zur Aufführung. Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier wirkt ebenso mit wie die Statisterie (einstudiert von Christian Niegl) und der Opernchor und Extrachor des Theater Trier unter Leitung von Generalmusikdirektor Victor Puhl. Die Bühne machte Heinz Hauser, Carola Vollath war für Kostüme verantwortlich, die Choreographie stammte von Darwin José Diaz Carrero und Robert Przybyl. Die Rollen waren folgendermaßen besetzt: Sarastro: Irakli Atanelishvili, Tamino: James Elliot, Papageno: Bonko Karadjov, Königin der Nacht: Frauke Burg, Pamina, deren Tochter: Eva Maria Amann, Monostatos: Fritz Spengler, Erste Dame: Evelyn Czesla, Zweite Dame: Sotiria Giannoudi, Dritte Dame: Silvia Lefringhausen, Sprecher: Franz Grundheber, Erster Priester: Carsten Emmerich, Zweiter Priester: Fernando Gelaf, Erster Knabe: Tobias Stephanus, Zweiter Knabe: Héloise Neuberg, Dritter Knabe: Miao Yan Law, Altes Weib (Papagena): Helena Steiner, Erster geharnischter Mann: Gor Arsenyan, Zweiter geharnischter Mann: László Lukács.
Die Zauberflöte in heutigen Zeiten zu inszenieren, erscheint auf den ersten Blick wie ein aussichtsloses Unterfangen. Auch nach über 200 Jahren erfreut sich das letzte Bühnenwerk Mozarts ungebrochener Beliebtheit, was es schwierig macht, eine originelle und erfrischende Inszenierung auf die Beine zu stellen. Nichts desto weniger unternahm das Theater Trier zum Abschluss seiner Saison 2017/18 genau diesen Versuch. Heraus kam eine gleichermaßen interessante, ja kluge, und durchaus phantasievolle Adaption jener Oper, die der ehemalige Intendant des Theaters dieser Stadt, Heinz-Lukas Kindermann, hervorbrachte. Dieser Regisseur, immerhin schon über achtzig Jahre alt, hat nicht nur die Antikenfestspiele Triers ins Leben gerufen, sondern wirkt darüber hinaus (wie sich aus dem informativen, aber nicht überladenen Programmheft entnehmen lässt) regelmäßig in Wien, unter anderem als Präsident des österreich-bayerischen Forums, das sich für die Bewahrung berühmter Opernbüsten und Fresken einsetzt.
Was geschah nun in der Trierer Zauberflöte? Statt konservativem Pomp oder minimalistisch-„moderner“ Kargheit kam hier ein reflektiertes und stellenweise auch schillerndes Szenario zum Vorschein, das die Phantasie der Kinder anregt und Erwachsene zum Nachdenken einlädt. Das Bühnenbild ziert vor allem ein großdimensionierter Spiegel, der nicht nur verschiedenste Effekte erzielte (in Verknüpfung mit übriger Bühnentechnik), sondern auch eine symbolische Hintergründigkeit evoziert, gleichsam, als solle sich jeder einzelne Charakter dieses Singspiels immer wieder reflektieren. Auch andere Facetten der Inszenierung fallen positiv auf: Bei der Arie „Wie stark ist nicht dein Zauberton“ war es seit Schikaneders Zeiten zumeist üblich, Menschen in allerlei Tierkostümen tanzen zu lassen. Kindermann jedoch projiziert stattdessen leuchtende Augenpaare in den Hintergrund, was der recht heiteren Arie eine dunklere, unheimlichere Strömung verleiht und angenehm kitschfrei wirkt.
Reflektiert, ja eigenwillig, wirken denn auch die Kostüme: Zwar bekommt man den Eindruck, als hätte sich Carola Vollath hauptsächlich an Kleidungen des spätviktorianischen England orientiert. Das allein wäre aber zu kurz gedacht. Nahezu jede Szene ist gekennzeichnet durch einen detailgenauen Wechsel der Kostüme, welche den Fortgang der Handlung nachempfinden. Trägt etwa Tamino zu Beginn der Oper noch ein schlichtes Streifenhemd mit einer Latzhose dazu, so zeichnet der edle weiße Umhang am Ende den Helden aus, der seine Prüfungen nun endgültig bestanden hat. Auch die Choreographie der beiden Tänzer Darwin José Diaz Carrero und Robert Przybyl hatten ihre besondere Note. Sparsam eingesetzt, sorgten deren Bewegungsmuster für kräftig-eigenständige Akzente, mal für ein Schmunzeln, mal für Nachdenklichkeit.
An Mühen und Kosten wurde nicht gegeizt, was für ein vergleichsweise kleines Theater wie das von Trier doch beachtlich ist. Auch musikalisch und schauspielerisch merkte man nahezu jedem Mitwirkenden seine Freude an, was vielleicht auch der Tatsache zu verdanken ist, dass es sich hierbei um die letzte Produktion unter der Stabführung von Generalmusikdirektor Victor Puhl handelt. So erklang etwa die Ouvertüre unter seinem Dirigat sehr zügig und schwungvoll. Einzelne Instrumente leuchteten hier besonders hervor, so etwa die Flöten oder die Oboen, und glichen ein paar wenige Läufe im Seitenthema aus, die übereilt vorüberhuschten.
In der ersten Nummer sind es dann die drei Damen Evelyn Czesla, Sotiria Giannoudi und Silvia Lefringhausen, welche stimmlich gut miteinander verschmolzen und auch sichtlich ihre Freude daran hatten, als personifizierte Vamps aus dem Varieté verführerisch aufzutreten. Heimlicher Star des Abends war Bonko Karadjov, der mühelos die meisten Lacher der Zuschauer für sich zu gewinnen verstand. Sei es in der berühmten „Vogelfänger“-Arie, die als kleine Überraschung einen alternativen Text von Michael Ende enthält, sei es aber auch in „Bei Männern, welche Liebe fühlen“, in der seine robuste und kantige Stimme auch lyrisch wurde und sehr schön mit seiner Partnerin Eva Maria Amann harmonierte. Seinen komödiantischen Höhepunkt jedoch fand Karadjov in „Ein Mädchen oder Weibchen“, was er zu einer wahren Farce umgestaltete. So schnappte sich der Sänger keck den Taktierstab von Monsieur Puhl und bot seine eigene Version dieser heutzutage etwas bieder erscheinenden Arie, was dann selbstbewusst lächerlich und sympathisch wirkte.
Nicht zu vergessen sei sein Kompagnon James Elliot als Tamino. Hatte dieser anfangs noch seine Schwierigkeiten, so war dies spätestens bei der „Bildnisarie“ vergessen: Hier zeigte sich sein lyrisch-einfühlsamer und zugleich energischer Tenor englischer Schule. Überhaupt wuchs er den Abend stets über sich hinaus, auch schauspielerisch, und erwies sich als zuverlässiger und musikalischer Partner gerade in Ensemblenummern. Am eindrucksvollsten zeigte sich dies im langen Dialog mit dem Sprecher der Eingeweihten, wo Mozart ein begleitetes Rezitativ komponierte. Hier konnte das Theater einen prominenten Gast und gebürtigen Trierer an jenem Donnerstag begrüßen: Franz Grundheber, der hier trotz seines hohen Alters einen starken und einprägsamen Auftritt hinlegt. Als ungewöhnlich und jenseits vieler gängiger Darstellungsmuster erwies sich die Königin der Nacht, Frauke Burg. So erschien ihr erster Auftritt in „Oh zittre nicht“ nur anfangs als „grandios“. In Wahrheit wirkte sie wie eine fremde Macht, nicht von dieser Welt, ein Eindruck, den Burg durch ihre fluoreszierend-helle Stimme und ihre sichere Führung unterstrich. Schade nur, dass nicht nur an dieser Stelle das Bühnenbild einen erheblichen Haken offenbarte: So wirkungsvoll der Spiegel optisch war, so problematisch erwies er sich für viele Sänger, die dahinter agierten, was sich auf die Textverständlichkeit auswirkte. Wie gut, dass dann die Höllenarie auf dem vorderen Bühnenteil stattfand: Hier offenbarte Frauke Burg eine ganz andere Seite: Die rachsüchtige und zugleich um ihre Macht fürchtende Königin verkörpert sie hier voll und ganz überzeugend. Anstatt auf bloße Bravour zu setzen, wie dies einige Koloratursopräne tun, verstand es Frauke Burg von Anfang bis Ende, Gänsehaut sowie einen Klang voll düsterer Energie und eine Spannungskurve zu erzeugen, wozu ihre bewussten Rubati beitrugen.
Als ebenbürtiger Gegenpol agierte Eva Maria Amman als Pamina: Mit ihrer vollen und intonationssicheren Stimme wusste sie sich auf vielfältige Weise in Szene zu setzen. Ihren größten Auftritt jedoch hatte sie in „Ach, ich fühls“. Die todtraurige Stimmung dieser Arie über den scheinbaren Verlust der Liebe wusste sie nicht nur einzufangen, sondern auch erlebbar zu machen. Bis in die kleinste dynamische Facette sang, rief und hauchte sie ihre Töne voller musikalischer Inbrunst aus. Wiederum als Antipode trat ihr erster Partner des Abends, Fritz Spengler als durchtriebener Moor Monostatos auf. Hier erwies es sich als originelle Idee, statt dem üblichen Spieltenor einen Countertenor zu nehmen. Spengler versteht es, durch die helle Sopranlage seiner Stimme, der Figur eine ironische Leichtigkeit zu verpassen, hinter der Komplexe und Abgründe lauern. Spätestens in seiner Arie „Alles fühlt der Liebe Freunden“ wird das deutlich: Hier zeigte der junge Countertenor, was Monostatos eigentlich umtreibt: Er möchte lieben und geliebt werden, was ihm seinerzeit allerdings allein wegen seiner Hautfarbe verwehrt blieb.
Als Sarastro bestach der georgische Sänger Irakli Atanelishvili. Zwar merkte man ihm seinen sprachlichen Akzent deutlich an, dem musikalischen Genuss tat das jedoch keinen Abbruch. Sowohl bei „O Isis und Osiris“ als auch bei „In diesen heil´gen Hallen“ sang er gleichermaßen kräftig und sonor und mit runder Stimmführung, auch strahlte er trotz seines jungen Alters schon die Autorität aus, welche zum Charakter des Sarastro dazugehört. Präsent, aber auch nicht allzu drollig, sind die drei Knaben auf der Bühne. Auch wenn deren höchste Stimme manchmal Mühe hat, hervorzutreten, so waren die Kinder doch sorgfältig einstudiert. Leider herrschte bei den zwei Geharnischten ein klangliches Ungleichgewicht, hier war es der tiefere der beiden, welcher sich nicht so recht durchzusetzen vermochte, obgleich ja sonst alles stimmte. Auch geriet hier die Begleitung durch das sonst so grundsolide Orchester matt, da der Fluss innerhalb der Polyphonie etwas fehlte. Umso erfreulicher dann der große Schlussauftritt Papagenos, indem dann auch die junge Helena Steiner als Papagena sich stimmlich entfalten durfte und davor eine Spiellust offenbarte, die einen zum Schmunzeln bringt. Und was wäre schließlich eine Zauberflöte ohne Chor? Hier sorgte der verstärkte Opernchor des Theater Trier für einige große Auftritte sowie einen wirkungsvollen Schluss, insbesondere die Männerstimmen überzeugen.
Fazit: Natürlich handelt es sich bei diesem Theater nicht um ein großes Opernhaus wie beispielsweise in Wien, was entsprechend bemerkbar wird, und doch haben die Trierer doch eine mehr als beachtliche, unverkrampfte und alles andere als herkömmliche Zauberflöte kreiert und damit anderthalb Monate lang für ein ausverkauftes Haus gesorgt – zu Recht, wenn man alleine die Leistungen von diesem Abend bedenkt, an dem das Publikum schon gar nicht mehr aufhören wollte zu applaudieren. Emmanuel Schikaneder und Mozart wären sicher stolz auf so viel Zuspruch gewesen!
[Peter Fröhlich, Juli 2018]

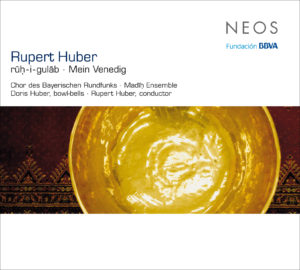

 (Foto von: M. Hallersleben)
(Foto von: M. Hallersleben)