Lyrita, SRCD 389 (Vertrieb: Naxos); EAN: 5 020926 038920
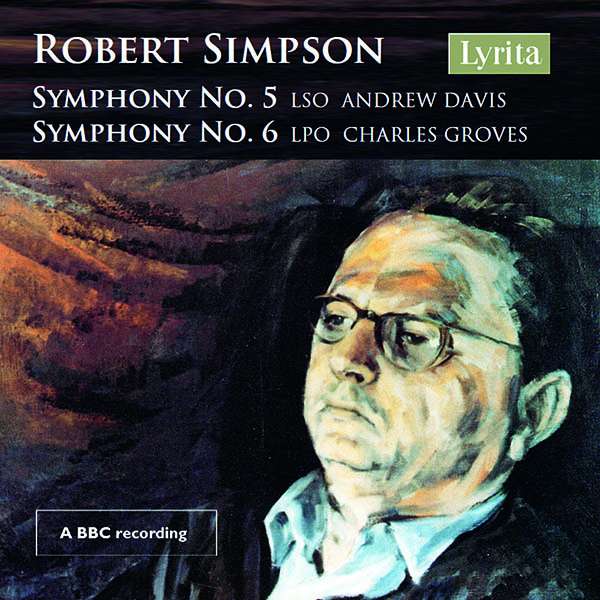
Dass die Symphonie tot sei, war sozusagen angesagte Losung einer ganzen Generation von Komponisten, Intendanten, Dirigenten und Musikkritikern. Eine der dümmsten Losungen aller Zeiten, und – so könnte man sagen – „Totgesagte leben länger“. Dieser Versuch der Geschichtsbeeinträchtigung seit Anfang der 1950er Jahre stammt zudem ausgerechnet aus einer Zeit, in welcher einige der größten Symphoniker unbeeindruckt von derartigem ideologischen Quatsch munter weitergewirkt haben – es sei aus der älteren Generation hier nur an Egon Wellesz, Lászlo Lajtha, Sergej Prokofieff, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Havergal Brian, Max Butting, Hilding Rosenberg, Willem Pijper, Walter Piston, Roberto Gerhard, Paul Hindemith, Harald Sæverud, Alexander Tansman, Marcel Mihalovici, Alexander Tscherepnin, Carlos Chávez, Ernst Krenek oder Edmund Rubbra erinnert. Und dann natürlich der heute alles überragende Dmitri Schostakowitsch, umgeben von Meistern wie William Walton, Aram Chatschaturian, Eduard Tubin, Karl Amadeus Hartmann, Vittorio Giannini, Michael Tippett, Henk Badings, Sándor Veress, Vagn Holmboe, Daniel Jones, William Schuman oder Witold Lutoslawski. Die meisten werden das wenigste davon kennen, was sich freilich kontinuierlich verändert, denn die ideologischen Barrieren sind längst aufgeweicht. In den folgenden Generationen geht es unverändert so weiter, bis heute wird die Symphonie reich und substanziell gepflegt, wobei gewiss auch zu konstatieren ist, dass sich der Gattungsbegriff generell sehr erweitert hat. Hans Werner Henze, von den deutschen Fachidioten in ihrem geistigen Schrebergärtnertum immer wieder als „letzter Symphoniker“ tituliert (welche Peinlichkeit für die hiesige Musikwissenschaft!), war unter all den Symphonikern seiner Generation beispielsweise eher ein prätentiöser Zwerg, auch wenn er seine Symphonien teils sehr elefantenhäutig instrumentierte (Nr. 7 und 9). Und an dieser Stelle sei nur noch ein Blick auf die Spitze des Eisberges geworfen, also auf die Meister neben und nach Schostakowitsch, die mit einem vergleichbar umfangreichen symphonischen Œuvre hervorgetreten sind: der schwedische Einzelgänger Allan Pettersson mit 16, der sowjetisierte Pole Mieczyslaw Weinberg mit 22, der irophile Brite Robert Simpson mit 11, der St. Petersburger Russe Sergej Slonimsky mit 33 und heute der Finne Kalevi Aho mit bislang 17 Beiträgen.
Äußerster Pol des Unsentimentalen
Unter diesen Serientätern nimmt Robert Simpson (1921–1997) eine einzigartige Position ein. Ohne Umschweife kann man seine Musik als äußersten Pol des Unsentimentalen in der Musik des 20. Jahrhunderts definieren. Er hält sich mit keiner Stimmung, mit keinem Sentiment auf, und sei es noch so verzaubernd und verlockend, wie so oft in seinem Schaffen. Seit geraumer Zeit ist die Gesamteinspielung seiner Symphonien unter Vernon Handley (Hyperion) nicht mehr verfügbar, und daher ist es emphatisch zu begrüßen, dass nun doch noch in seinem Jubiläumsjahr 2021 – mit Unterstützung der Robert Simpson Society – bei Lyrita Records eine CD mit den BBC-Uraufführungsmitschnitten seiner Symphonien Nr. 5 (1972) und Nr. 6 (1977) erschienen ist – diese Werke stehen so ungefähr im zeitlichen Zentrum seines Lebenswerks und bestechen unmittelbar mit der enormen Spannweite des Ausdrucks zwischen harscher, strukturell strikter Offensivkraft und herrlichster lyrischer Introspektion, durchaus in maximalem Kontrastverhältnis zueinander ausgeführt. Dass Simpson sich stark von Haydn und Beethoven, von Bruckner und Carl Nielsen beeinflusst wusste, wird – ganz besonders im Falle Nielsen – hier schnell sinnfällig.
Universelle Gesetzmäßigkeiten
Exzellent ist hier vor allem die Aufführung der Fünften Symphonie durch das London Symphony Orchestra unter dem damals jungen, bis heute für hohe Qualität bürgenden Andrew Davis (1973). Die in einem 39 Minuten langen, durchgehenden Satz sich artikulierende Gesamtform wird von zwei mächtigen Allegrosätzen gerahmt, die das Zeug haben, das Erbe der Beethoven-Bruckner-Tradition in erneuerter Form weiterzutragen. In der Mitte finden wir ein knappes, unerbittlich treibendes Scherzo, und als langsame Zwischenspiele sind zwei intim verwobene Canoni eingefügt, die in scharfem Gegensatz zu den schnellen Sätzen stehen.
Die Aufführung der Sechsten Symphonie 1980 durch das London Philharmonic Orchestra unter Charles Groves ist, wie auch der Bookletautor bezugnehmend auf die Aussagen des Komponisten bestätigt, viel roher, al fresco. Das 33minütige Werk gliedert sich in zwei große Abteilungen und fesselt mit ungeheuerlichem Momentum. Und obwohl die Aufführung fern einer idealen Erfüllung bleibt, ist diese Aufnahme zumindest für all jene unverzichtbar, die bereits wissen, dass Simpson zu den größten Meistern des 20. Jahrhunderts zählt und es sich lohnt, alles von ihm zu haben: Denn es wird hier die Urfassung der Sechsten gespielt, und Simpson hat zum Beispiel den Anfang in der revidierten Fassung komplett geändert. Natürlich wird diese Musik nicht jedem gefallen – also weder den bequemlichen Traditionalisten, die auf Gefälligkeit Wert legen, noch den besserwisserisch belehrenden ideologischen Fanatikern des dystopischen Post-Holocaust-Bruchs mit jeglicher Tradition –, doch wer sich darauf einlässt, kann sich dem Sog kaum entziehen. Und wenn man das Gefühl hat, sich hier auf ein unerbittliches Rauhbein eingelassen zu haben, dann erlebt man umso überraschter, zu welch subtiler Zärtlichkeit Simpson in der Lage, sobald er die Musik in die ganz und gar ungegenständlichen Gefilde jenseits des forschen Drangs, des unaufhaltsamen Momentum wandern lässt – nicht weniger streng, aber dies ist dann ausschließlich die innere Disziplin, die er niemals vermissen lässt. Simpson liebte die Astronomie, und auch in der Musik vertraute er auf universelle Gesetzmäßigkeiten. Nachdrückliche Empfehlung!
[Christoph Schlüren, Dezember 2021]


