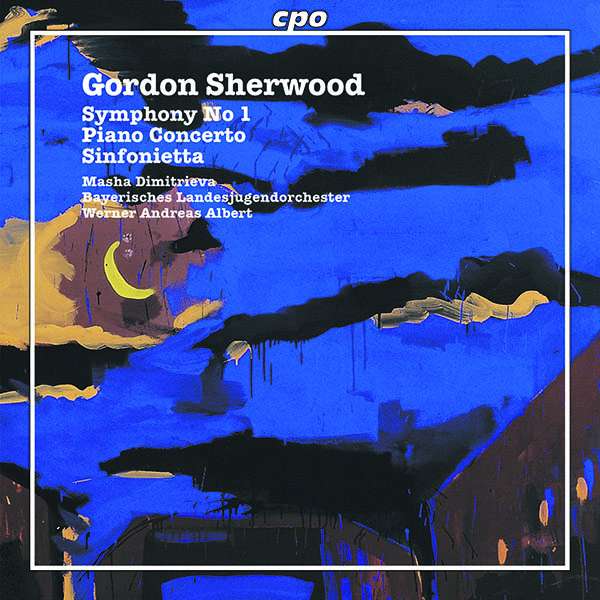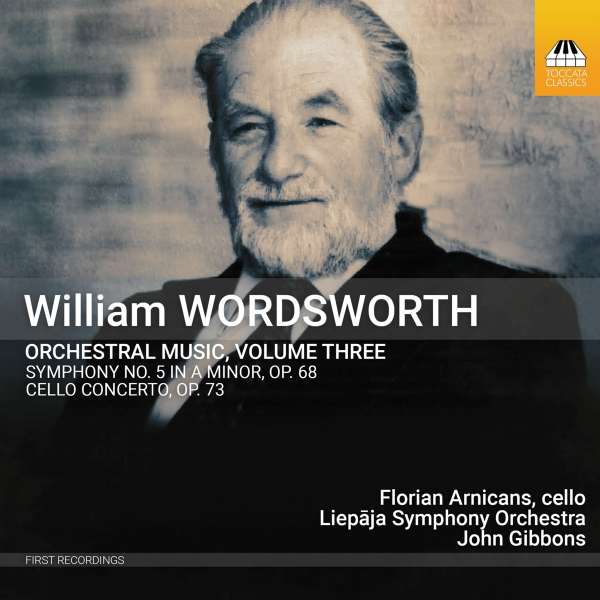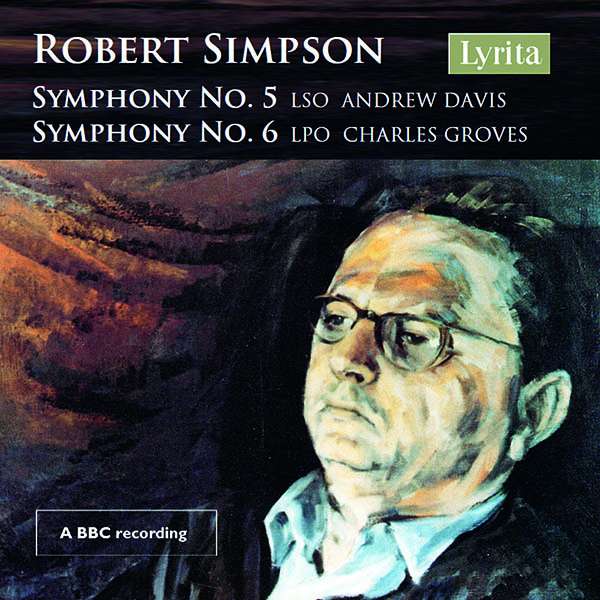Accentus Music, ACC80544; EAN: 4 260234 833089

Bekanntlich gehört Franz Schmidt zu denjenigen Komponisten, welchen im laufenden Jahr aufgrund eines runden Jubiläums verstärkte Aufmerksamkeit zuteil wird. Im Dezember jährt sich sein Geburtstag zum 150. Male, was sich diskographisch durchaus bemerkbar macht, lässt sich doch unter den CD-Veröffentlichungen der letzten Monate eine erhöhte Dichte an Schmidt gewidmeten Tonträgern feststellen. Zum Teil handelt es sich dabei um aktuelle Einspielungen, zum Teil um historische Aufnahmen, die zum ersten Mal auf CD erscheinen (unter diesen ist vor allem der bei Orfeo erschienene Mitschnitt der Oper Fredigundis aus dem Jahr 1979 bemerkenswert). Noch rechtzeitig vor Anbruch des Schmidt-Jahres 2024 erschien im vergangenen Dezember bei Accentus Music eine neue Gesamteinspielung seiner Symphonien, die erste dieser Art aus Großbritannien.
Der Dirigent Jonathan Berman gehört zu den besten Kennern von Franz Schmidts Leben und Schaffen. Seine Einspielungen der Symphonien mit dem BBC National Orchestra of Wales sind der bedeutendste, aber keineswegs der alleinige Bestandteil seines „Franz Schmidt Project“, das er vor einigen Jahren in Vorbereitung zum 150. Geburtstag des Komponisten ins Leben rief. Parallel zu den zwischen Januar 2020 und Oktober 2022 durchgeführten Aufnahmen hat Berman Interviews mit anderen Musikern über Schmidt geführt und begonnen, eine Schmidt-Diskographie zu erstellen (sie ist noch nicht abgeschlossen) – das Material findet sich auf seiner Internetseite The Franz Schmidt Project.
Was Bermans eigene Aufnahmen betrifft, so ist ihm und seinen walisischen Musikern – dies sei vorweggenommen – eine Leistung geglückt, die sich kein an der Symphonik Franz Schmidts interessierter Hörer entgehen lassen sollte.
Als Prüfstein zur Beurteilung dieser Gesamteinspielung habe ich zunächst den einzigen Satz einer Schmidt-Symphonie gewählt, der mir in vielen Aufnahmen zu lang vorkam, nämlich das Scherzo der Ersten Symphonie. Die Eckteile dieses Satzes erschienen mir nie problematisch, wohl aber der Mittelteil, der aus zwei separaten Stücken besteht, die ineinander übergehen. Das erste dieser Trios (cis-Moll) besteht im Grunde nur aus einem sich über die Intervalle des verminderten und übermäßigen Dreiklangs nach oben schraubenden achttaktigen Thema, das, berücksichtigt man die vorgeschriebenen Wiederholungen, insgesamt elfmal hintereinander zu hören ist, wenngleich auf verschiedenen Stufen. Das kann sehr gleichförmig wirken und seinen Schatten auf das unmittelbar folgende langsame Trio (Des-Dur) werfen, das dann wie eine Durststrecke erscheint. Aber muss dieser Eindruck sein? Berman lenkt im ersten Trio die Aufmerksamkeit auf die Gegenstimmen, macht deutlich, was sich alles um das Thema rankt, wie es bei jedem Durchlauf etwas anders kontrapunktiert und klanglich eingefärbt wird. So wird jedes Erscheinen des Themas zum Ereignis. Die Musik atmet gleichmäßig und holt alle acht Takte Luft. Nirgends klingt es, als trete das Geschehen auf der Stelle. Im Gegenteil hört man bei Berman, wie einfallsreich Schmidt mit diesem Trio das Passacaglia-Prinzip in einen Scherzo-Satz eingebaut hat. Nach dem elften Themendurchlauf legt sich diese Quasi-Passacaglia zur Ruhe und fließt in das langsame zweite Trio über. Berman gestaltet diesen Übergang unaufdringlich zwingend, der Beginn des Des-Dur-Trios erscheint als der natürliche Zielpunkt. Im Folgenden lässt der Dirigent stärkere Rubati zu, aber stets in schöner Übereinstimmung mit dem harmonischen Verlauf der Musik. Die Musik dehnt sich, entspannt sich – durchaus ein erwünschter Effekt nach dem so rigoros durchgeführten cis-Moll-Abschnitt –, aber sie verliert nicht die Orientierung und auch nicht den Fluss. Wenn dann der Hauptteil des Scherzos erneut ansetzt, klingt alles erholt und erfrischt – und es wird klar, welch originelle vierteilige Dramaturgie Schmidt, vom üblichen Scherzo-Schema abweichend, in diesem Satz verfolgt. Im Hauptteil selbst hält Berman die Musik geschickt zwischen ungeschlachter Ländlichkeit und eleganteren, sich ein wenig zierenden Klängen in der Schwebe. Nein, dieser Satz enthält keine Längen, sondern in jedem Takt großartige, spannende Musik!
Was für das Scherzo gilt, gilt für die ganze Symphonie. Das Werk erfährt durch Berman und die Walliser eine rundherum ausgewogene Wiedergabe, die allen Affekten gleichermaßen Rechnung trägt und durch alle Tempi hindurch die Spannung aufrecht erhält. Schmidts Erste ist ein glänzend instrumentiertes Werk, doch geht es Berman hörbar um mehr als um die Vorführung bloßer orchestraler Brillanz. Das Klangbild, das er mit seinem Orchester erzeugt, leuchtet von innen her, da es vom kontrapunktischen Tonsatz aus entwickelt ist. Schmidt ist ein essentiell polyphoner Komponist und seine Harmonik stets als Ergebnis des Zusammentreffens der Stimmen gedacht. Die Herausforderung, die er an die Ausführenden stellt, ist weniger spieltechnischer als geistiger Art (Paul Wittgenstein pflegte den Komponisten, bei denen er Klavierkonzerte in Auftrag gab, das Schmidtsche Es-Dur-Konzert als Musterbeispiel ausgewogener Instrumentation vorzulegen!) und besteht in erster Linie darin, die für Schmidt charakteristische exzessive Chromatik funktional zu erfassen und den linearen Spannungsauf- und abbau in den einzelnen Stimmen nachzuvollziehen. Jonathan Berman hat sich tief in die Feinheiten des Schmidtschen Tonsatzes versenkt und ein Gespür für die Darstellung des polyphonen Geflechts entwickelt, weswegen man in seiner Einspielung die Nebenstimmen auch in lautstarken Momenten deutlich durchklingen hört.
Mehr noch als der Ersten kommt dies der Zweiten Symphonie zu Gute. Bermans Aufführung dieses Werkes entwaffnet all jene vorlauten Kritiker, die in demselben ein überladenes Monstrum sehen wollen und dabei wahlweise von „k.u.k.“- oder „Jugendstil“-Bombast fabulieren. Ja, Schmidt macht in dem Stück, das allein schon im Hinblick auf seine Form zu den hervorragendsten Leitungen des Komponisten gerechnet werden muss, seine handwerkliche Meisterschaft durchaus demonstrativ geltend und schöpft bezüglich der Möglichkeiten, die ihm das große Orchester zur polyphonen Gestaltung bietet, aus dem Vollen, aber überladen klingt das alles doch nur, wenn der Dirigent keinen rechten Überblick über den Tonsatz hat. Man höre nun bei Berman den Schlusschoral des Finalsatzes: Da ist kein undifferenziertes Dröhnen und Rauschen. Das Choralthema führt eindeutig, wird aber nicht so überstark herausgestellt, dass alles Übrige zu einer diffusen Begleitung herabsinkt. Stattdessen wird hörbar, mit welch feinen Ornamenten Schmidt das Thema umrankt. Auch behandelt Berman das Tempo feinfühlig, lässt es an manchen Stellen geringfügig nachgeben, damit eine Nebenstimme deutlicher zu vernehmen ist, achtet aber sorgsam darauf, das Thema nicht zu zerdehnen und das Grundtempo zu halten. Diese Kunst des Rubatos beherrscht Berman auch im Leisen, wie sich beispielhaft in der Mitte der Durchführung des ersten Satzes, in der langsamen Variation vor Beginn des Scherzos im zweiten Satz sowie im Trio des Scherzos zeigt.
Besonders erfreut in dieser Gesamtaufnahme die Darbietung der Dritten Symphonie. Dieses Werk kann gerade deswegen als Schmidts schwierigste Symphonie gelten, weil sie sich verglichen mit ihren Geschwistern so unauffällig gibt. Zusammen mit dem zeitnah entstandenen Zweiten Streichquartett markiert sie in Schmidts Schaffen den Punkt der stärksten Abkehr vom „spätromatischen“ Idiom. Einer auf Äußerlichkeiten aufbauenden Interpretation entzieht sie sich auffällig. In der Ersten Symphonie kann ein Dirigent sich an Gesten jugendlicher Aufbruchsstimmung und an Naturlauten orientieren, aus der Zweiten kann er ein opulentes Fin-de-siècle-Feuerwerk machen, die Vierte gibt immer wieder die Möglichkeit zu nachdrücklicher Emotionalität. Die Dritte dagegen hat keine spektakuläre Außenseite. Wer will, der höre zu und nehme Teil an dieser sanft dahinströmenden, ungemein fein gestalteten Musik, aber man erwarte nicht, dass sie irgendwelche Anstalten macht, den Hörer zu überreden. Schmidts Dritte ist ein leidenschaftlich unrhetorisches Stück. Einem solchen Werk kommt man nur bei, wenn man sich auf die Introspektion der Musik einlässt und nicht nach Gelegenheiten zur Effekthascherei sucht, wo keine sind. Bermans intensives Nachvollziehen der zart gesponnenen melodischen Linienspiele mit ihrer ebenso kühnen wie unaufdringlichen Chromatik ist hier der einzig erfolgversprechende Ansatz. Und so blüht diese Musik auf wie selten zuvor.
Das BBC National Orchestra of Wales zeigt sich in jeder dieser Schmidt-Aufnahmen als ein bestens disponierter Klangkörper, der wie ein großes Kammerensemble agiert: Den Spielern ist die Bedeutung ihrer einzelnen Stimmen offenbar voll bewusst, und man hört einander genau zu. Anders wären die dezenten Rubati und das fein abgetönte polyphone Musizieren auch kaum möglich. Großartige Orchestersolisten stehen für das Trompetensolo am Beginn der Vierten Symphonie und das Cellosolo im langsamen Satz desselben Werkes zur Verfügung. Auch in dieser meistgespielten Symphonie Schmidts zwingt Berman der Musik nichts auf, sondern lässt sie aus der Ruhe und Einsamkeit des einleitenden Trompetenthemas heraus entstehen und durch die allmähliche polyphone Entfaltung wie von selbst immer tiefgründiger und inniger werden. Auch imponiert die Geschlossenheit der Aufführung. Der markerschütternde Aufschrei im Scherzo, der in weniger durchdachten Aufführungen recht plötzlich ertönt und wieder verklingt, wird hier als der Höhepunkt spürbar, auf den die ganze Entwicklung der drei miteinander verbundenen Sätze zuzusteuern scheint, und nach dem es für die Musik tatsächlich keinen anderen Ausweg gibt, als den Anfang des ersten Satzes zu rekapitulieren und mit dem Trompetenthema den Kreis zu schließen.
Als Zugabe erklingen noch die Orchesterstücke aus Schmidts erster Oper Notre Dame, denen Berman und seine Musiker keineswegs weniger Aufmerksamkeit schenken als den Symphonien und anhand deren so recht deutlich wird, dass Schmidt auch als Opernkomponist symphonisch denkt.
Die Edition bereitet nicht nur großes Hörvergnügen, sondern erfreut auch durch ein umfangreiches Beiheft, das neben den Werkeinführungen ein 15-seitiges Interview enthält, in welchem sich der Dirigent ausführlich zu seiner Beschäftigung mit Franz Schmidt äußert.
[Norbert Florian Schuck, Juli 2024]