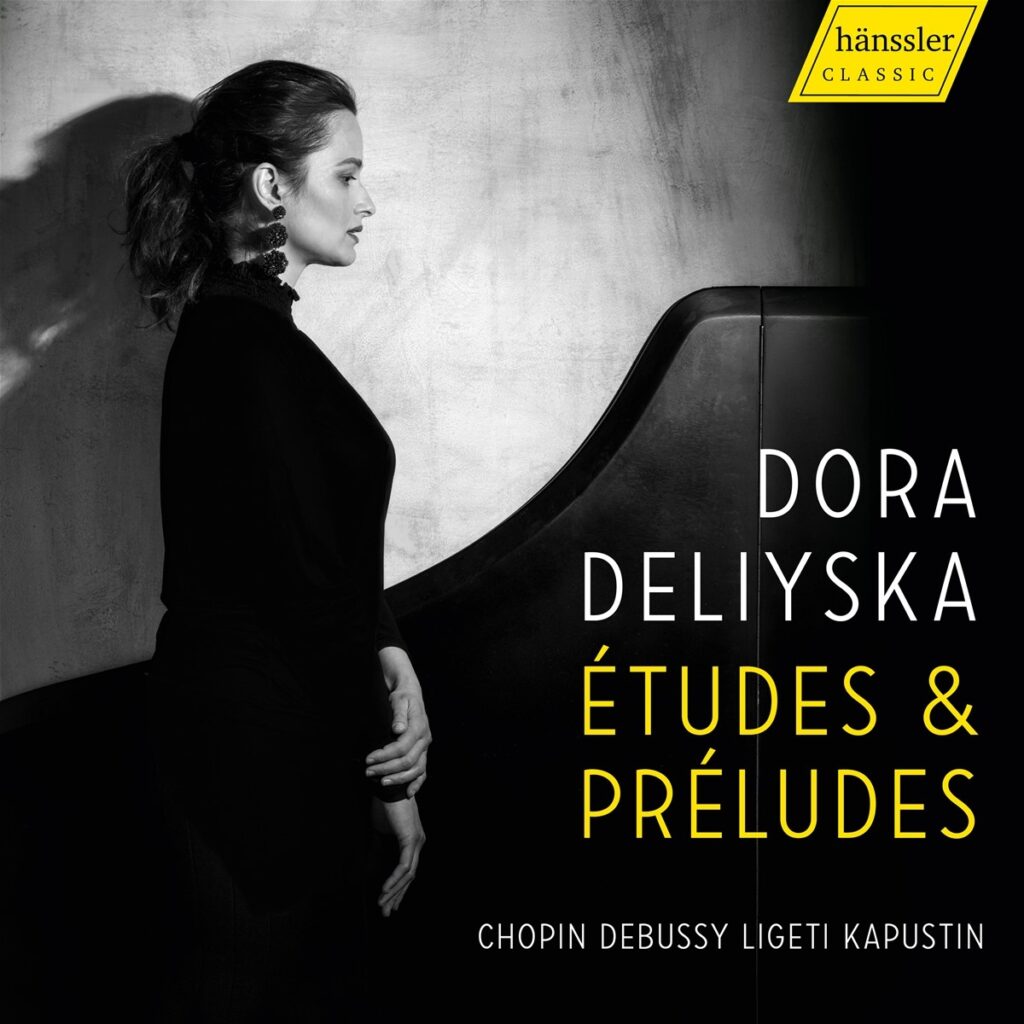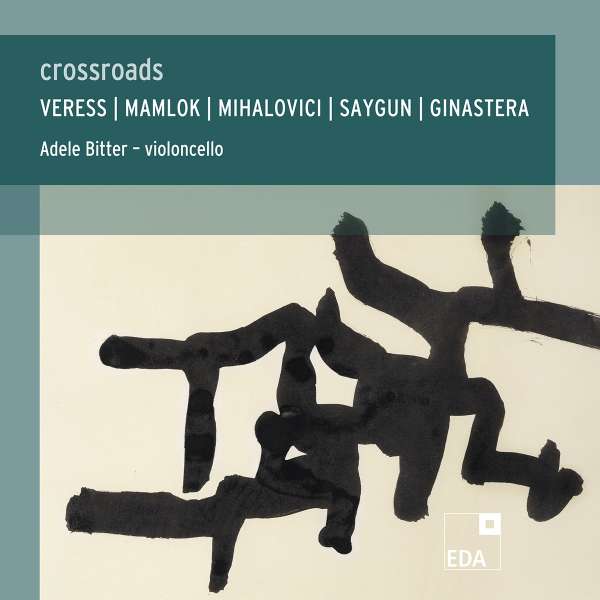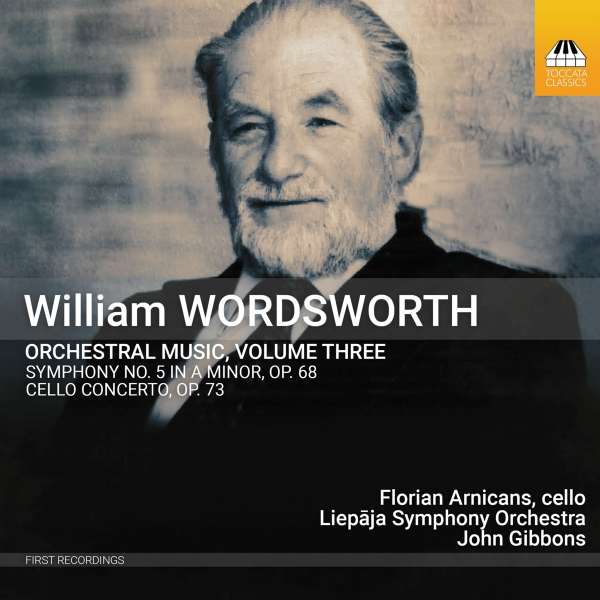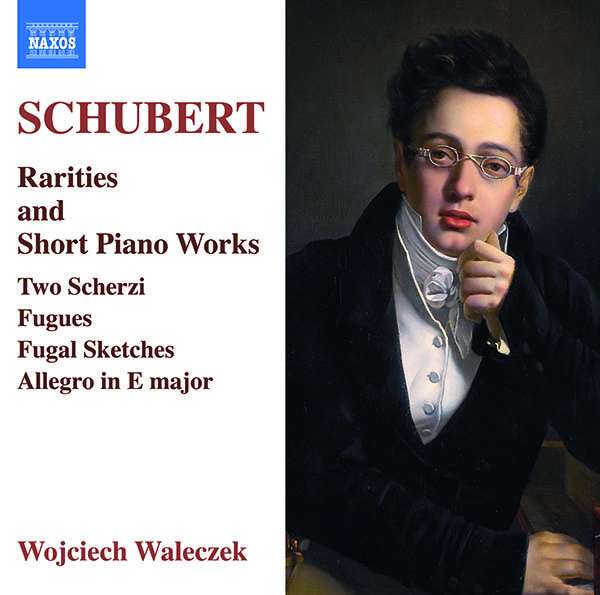Aldilà Records, ARCD 020, EAN: 9 003643 980204

In einem Programm von hohem Repertoirewert präsentieren Christoph Schlüren und das Orquestra Simfònica Camera Musicae Musik von Johann Sebastian Bach, Reinhard Schwarz-Schilling, Wolfgang Amadeus Mozart, Giorgio Federico Ghedini, Douglas Lilburn und Paul Büttner, überwiegend für Streichorchester. Als Solisten treten die Flötistin Raquele Magalhães und der Geiger Joel Bardolet hinzu.
„Resurrection“ ist das neue Album von Christoph Schlüren am Pult des katalanischen Orquestra Simfònica Camera Musicae (bzw. seit 2021 Franz-Schubert-Philharmonie) benannt, und was hier „aufersteht“, ist die Musik wenig bekannter, sorgsam ausgewählter Komponisten des 20. Jahrhunderts. So werden im Rahmen eines auch dramaturgisch sehr schlüssigen (Konzert-) Programms Werke (in der Regel für oder mit Streichorchester) von Paul Büttner, Reinhard Schwarz-Schilling, Giorgio Federico Ghedini und Douglas Lilburn den „Klassikern“ Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart gegenübergestellt. Es geht also gerade nicht darum, vermeintliches „Nischenrepertoire“ einzuspielen, sondern ein Plädoyer für den Wert der Musik all dieser Meister abzulegen und sie in exemplarischer Manier zusammen mit den Größen des Repertoires zu präsentieren. Dabei handelt es sich bei nahezu allen hier versammelten Werken um Bearbeitungen.
So steht gleich am Beginn als kleine „Ouvertüre“ eine Einrichtung von Johann Sebastian Bachs Fuge g-moll BWV 578 für Streichorchester durch Lucian Beschiu. Diese Wahl ist insofern charakteristisch, als dass kontrapunktisch geprägte Werke stets ein Markstein von Schlürens Programmen sind, und außerdem handelt es sich bei G um so etwas wie den Zentralton des vorliegenden Albums (nur die Werke von Schwarz-Schilling und Mozart stehen nicht in irgendeiner Weise „in G“). Hervorragend die Transparenz der Darbietung und die sorgfältige Gewichtung der einzelnen Stimmen, ausgezeichnet artikuliert vorgetragen (wie gleich zu Beginn bei der ersten Präsentation des Themas zu beobachten), auch im Sinne der Vitalität und Spielfreude, die diesem kleinen Stück zu eigen sind.
Deutsche Musik der Nachkriegszeit ist lange äußerst avantgarde-dominiert rezipiert worden, was aber die Bandbreite dessen, was in diesen Jahrzehnten tatsächlich komponiert worden ist, in keiner Weise zutreffend widerspiegelt. Unter den überhaupt nicht wenigen Komponisten, die nicht mit der Tonalität brachen, ist Reinhard Schwarz-Schilling (1904–1985), Schüler von Braunfels und Heinrich Kaminski, eine signifikante Erscheinung. Seine „kanonische Choralbearbeitung“ der Passionsmelodie Da Jesus an dem Kreuze stund für Orgel (bzw. Flöte, Violine und Orgel) entstand zwischen 1936 und 1942. Für die vorliegende Aufnahme hat wiederum Beschiu sie für Flöte, Violine und Streichorchester eingerichtet, wobei der erste Abschnitt den Streichern, der zweite den beiden Soloinstrumenten mit Bass vorbehalten ist und erst der letzte alle Stimmen vereint. Aufbauend auf barocken und vorbarocken Modellen (man beachte namentlich die starke modale Färbung der Musik) erschafft Schwarz-Schilling eine gemessene, verinnerlichte, aber doch sehr expressive Klagemusik in gedeckten Farben. Die Flötistin Raquele Magalhães und der Konzertmeister des OSCM, Joel Bardolet, liefern gemeinsam mit den Streichern eine ungemein beseelte, die weiten, kunstvoll miteinander verflochtenen melodischen Linien dieser Musik vorzüglich nachvollziehende Interpretation.
Bardolet erlebt man anschließend noch einmal als Solisten in einem weiteren Bach-Arrangement. Bekanntlich sind Bachs Werke oftmals nicht in ihren Erstfassungen überliefert, sondern in der Form, wie sie uns vorliegen, Bearbeitungen und Neuzusammenstellungen, die Bach selbst in späteren Jahren vorgenommen hat. Im Falle seines Klavierkonzerts f-moll BWV 1056 etwa gilt als gesichert, dass wenigstens der erste Satz ursprünglich einem nicht erhaltenen Violinkonzert entstammte, und so findet sich hier eine Einrichtung des gesamten Konzerts für Violine und Streicher, nun in g-moll. In den Ecksätzen betonen Bardolet, Schlüren und ihre Mitstreiter die polyphonen Strukturen wie gleich zu Beginn die durch die Stimmen laufende Dreitonfigur oder später immer wieder ausgesprochen expressiv herausgearbeitete Nebenstimmen in den Solopassagen. Ganz im Fokus steht der Solist im langsamen Satz, wo Bardolet der außerordentlichen Kantabilität des Soloparts (nicht umsonst stammt dieser Satz vermutlich aus einer verschollenen Kantate) eindrucksvoll Rechnung trägt, mit leichten agogischen Freiheiten, die aber niemals den Fluss der Musik stören, und nota bene in einem echten Largo-Tempo, das dem wundervollen Melos dieser Musik wahrhaft Zeit zum Sich-Entfalten gibt.
Mit Wolfgang Amadeus Mozarts Fantasie f-moll KV 608 folgt nach Schwarz-Schilling faktisch eine zweite Trauermusik, denn wie auch ihr Schwesterwerk KV 594 ist dieses Werk für das Mausoleum Gideon Ernst von Laudons entstanden, was auch die für uns gewiss erst einmal kurios erscheinende Originalbesetzung für ein mechanisches Musikinstrument erklärt. Ein hochexpressives, chromatisch gefärbtes spätes Meisterwerk von reicher Polyphonie, von dem es etliche Bearbeitungen gibt, die das Werk für den Konzertsaal „retten“, so etwa die vorliegende für Streichorchester von Edwin Fischer. Die ausgeprägte Kontrapunktik der Fantasie ist natürlich ein Fest für Schlüren und seine Mitstreiter, die die komplexen Strukturen mit großer Umsicht und gestalterischer Stringenz realisieren, geprägt von ernster, gravitätischer, würdevoller Expression, unter Verzicht auf jedwede Manierismen, die Binnenspannung (auch in der Harmonik) exzellent nachvollziehend, mit viel Richtung und Präzision. Wenn hier etwas noch besonders hervorzuheben ist, dann die geradezu dramatische Wucht, die der Schluss in dieser Einspielung entfaltet, auch durch ein leichtes, wohldosiertes Anziehen des Tempos.
Im Programm folgt ein kleines Intermezzo aus zwei kurzen Stücken, das Raquele Magalhães gewidmet ist. Noch vor etwa 15 Jahren sah es auf dem Tonträgermarkt in Sachen Giorgio Federico Ghedini (1892–1965) eher dürftig aus, und auch wenn sich die Situation mittlerweile erfreulicherweise etwas gebessert hat, dürfte der Name dieses italienischen Meisters nach wie vor eher wenigen Musikfreunden geläufig sein. Dabei ist seine Musik von bemerkenswerter Originalität, hervorstechend insbesondere ihr eminenter Klangsinn, der aber nicht vom Impressionismus kommt, nicht vielfarbig schillert, sondern ihren „demone sonore“, wie er auch genannt worden ist, eher auf Kargheit und Reduktion gründet: man höre etwa die kristalline Klarheit der langsamen Passagen oder den aufregend schrägen, zwischen Archaik und Moderne pendelnden Schlusshymnus seiner Architetture (für Orchester). Auf dieser CD nimmt Ghedini von der Besetzung her eine Sonderstellung ein, da von ihm ein Stück für Flöte solo ausgewählt wurde (zugleich das einzige Werk auf diesem Album, das im Original gespielt wird), und zwar mit Canto, o della solitudine das dritte seiner 1962 entstandenen Tre pezzi per Flauto solo. Hier kommt Magalhães’ Kunst des Flötenspiels exemplarisch zum Zuge; eine famose Darbietung, die die weit aufblühenden Linien dieses Stücks ebenso wunderbar realisiert wie seine Momente des Zögerns, des Stockens, all dies auch klanglich sehr fein differenziert.
Klassische Musik in Neuseeland ist wesentlich mit dem Namen Douglas Lilburn (1915–2001) verbunden, hier vertreten mit seiner Canzona Nr. 1, 1943 ursprünglich als Schauspielmusik entstanden, 1980 dann etwas erweitert und hier in einer Fassung für Altflöte und Streicher von Lucian Beschiu eingespielt. Im Rahmen dieses Programms knüpft diese kleine „Aria“ stimmig etwa an Schwarz-Schillings Choralbearbeitung oder den Mittelsatz von Bachs Konzert an, wobei die barocke Inspiration durch einen leicht archaischen, fast rituell anmutenden Einschlag ergänzt wird, mit sparsam, aber sehr präzise eingesetzten Mitteln viel Atmosphäre erzeugend. Das Dämmerlicht dieses kleinen Stimmungsbilds korrespondiert vorzüglich mit dem betörenden Ton von Magalhães’ Altflöte.
Am Schluss des Programms steht das 1916 entstandene Streichquartett g-moll des Dresdners Paul Büttner (1870–1943) in einer Streichorchesterfassung von Schlüren selbst. Büttner war ein Schüler Draesekes; seinen Durchbruch als Komponist erlebte er 1915 mit der Uraufführung seiner Dritten Sinfonie im Leipziger Gewandhaus unter der Leitung von Nikisch. Sozialdemokrat und in der Arbeiterbewegung engagiert, wurde er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten aller Ämter enthoben. Nach dem Krieg wurde sein Schaffen bis zu einem gewissen Grad in der DDR gepflegt und seine Vierte Sinfonie auf Schallplatte eingespielt, wodurch er in Westdeutschland wiederum mit dem Etikett „DDR-Komponist“ in Verbindung gebracht wurde, was faktisch bis zum heutigen Tag Vorbehalte mit sich bringt (sodass einiges an großartiger Musik aus dem Osten nach wie vor weitgehend ignoriert wird).
Büttner ist ein Komponist in der Tradition der deutschen Romantik, ähnlich wie Draeseke zwischen Brahms und Bruckner stehend, aber auch an älterer Musik interessiert. Und so mutet das Hauptthema des ersten Satzes mit seiner kontinuierlichen Achtelbegleitung durchaus klassizistisch an, ganz ähnlich übrigens wie das verwandte erste Thema des ersten Satzes der Zweiten Sinfonie von Leo Spies (müßig, hier über eventuelle Einflüsse zu spekulieren). Hieraus entwickelt sich ein dramatisch geschärftes, mit aufbegehrend-heroischen Gesten arbeitendes, kontrapunktisch geprägtes Sonatenallegro. Nach diesem „Ersten Hauptstück“ wird im „Ersten Zwischenspiel“ ein leicht pastoral anmutendes, laut Partitur „sinnig hingleitendes“ Stimmungsbild angedeutet, das dabei aber wiederum ausgesprochen polyphon gearbeitet ist. Der dezidiert folkloristische Tonfall der ersten Takte des folgenden Scherzos täuscht, denn was sich hieraus entwickelt, ist ein phantastischer Ritt, der sein Material (chromatisch) verfremdet, mit weiten Glissandi geradezu persifliert und sich insofern tatsächlich als der angekündigte „Zweite Hauptteil“ erweist. An vierter Stelle steht der wohl schon längst erwartete langsame Satz, allerdings im reduzierteren Rahmen eines choralartigen „Zweiten Zwischenspiels“, eines Moments „andächtig versunkenen“ Innehaltens. Der „Dritte Hauptteil“, das Finale, beginnt in größter Entschlossenheit mit scharfen Punktierungen und einem Thema à la hongroise, kombiniert mit Reminiszenzen an die vergangenen Sätze. Überraschenderweise kommt das Werk kurz vor Ende noch einmal gänzlich zur Ruhe mit einem kontrapunktisch geprägten Abschnitt, der sich bei näherem Hinschauen als eine Widmung an Büttners Frau Eva entpuppt. Erst danach kommt es wirklich zu einer effektvollen finalen Zuspitzung nebst Wendung nach Dur in beinahe letzter Sekunde.
Schon die Ersteinspielung von Büttners konziser, kontrapunktisch geprägter (bzw. inspirierter) Triosonate für Streichtrio bei Aldilà Records vor einigen Jahren ließ erkennen, dass die epische Breite und meisterhafte Beherrschung der großen Form der Vierten Sinfonie nicht notwendigerweise Rückschlüsse auf Büttners übriges Schaffen erlaubt. Und so ist auch das Quartett wiederum keine Kammerversion der Sinfonie, sondern ein ein Werk, das seine eigenen Wege geht, die sich oft genug als anders entpuppen als der Hörer vielleicht zunächst vermutet, und das sich insofern immer wieder (spielerisch) über Erwartungen und Konventionen hinwegsetzt. Es ist Schlüren und seinem katalanischen Orchester hoch anzurechnen, dieses Stück nun erstmals in einer Einspielung (noch dazu in dieser Qualität) zugänglich gemacht zu haben.
Hervorragend wie üblich Schlürens Begleittext, der Werke und Komponisten (sinnvoll gewichtet) ausführlich vorstellt und dem Hörer allerlei Beachtenswertes an die Hand gibt; sehr aufschlussreich auch (als eine Art Blick „hinter die Kulissen“) die Informationen zur Genese des Programms. Summa summarum einmal mehr ein erstklassiges, sehr verdienstvolles Album.
[Holger Sambale, November 2024]