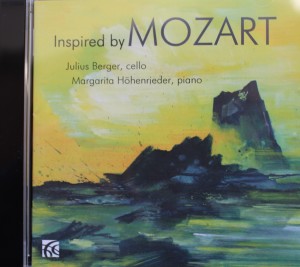Wergo, WER 7409 2, EAN: 4 010228 740929

Auf seiner neuen Solo-CD erforscht Julius Berger die Anfänge der Sololiteratur für Violoncello zu Beginn des 20. Jahrhunderts, fast zwei Jahrhunderte nach Bachs epochalen Suiten. Neben Max Regers Suite d-moll op. 131c Nr. 2 hat Berger hierfür die Passacaglia aus der Solosonate von Donald Francis Tovey sowie – als Weltersteinspielungen – zwei Solowerke von Adolf Busch sowie die Suite Nr. 2 h-moll von Walter Courvoisier ausgewählt.
Dass Johann Sebastian Bachs Suiten für Solocello Anfang des 20. Jahrhunderts durch Pablo Casals aus einem veritablen Dornröschenschlaf erweckt werden mussten, dürfte vielen Musikliebhabern geläufig sein. In der Tat spielte man sie im 19. Jahrhundert wenn überhaupt, dann höchstens mit zusätzlicher Klavierbegleitung, wovon übrigens eine historische Aufnahme der Sarabande aus der Suite Nr. 6 durch Julius Klengel ein ebenso spätes wie in mancher Hinsicht skurriles Zeugnis ablegt. Diese Skepsis gegenüber Musik für solistisches Violoncello (und überhaupt solistische Melodieinstrumente) und ebenso ihre allmählich einsetzende Renaissance zu Beginn des 20. Jahrhunderts lässt sich dabei ebenso deutlich anhand der Literatur für Solocello nachvollziehen. In der Tat gibt es nach einer Reihe von Werken aus der Zeit des Barock eine lange Pause in etwa zwischen 1750 und 1900, in der nahezu überhaupt keine Solowerke entstanden, abgesehen von einigen Beiträgen komponierender Cellisten, besonders bekannt etwa die Capricen von Alfredo Piatti.
Um 1915 ändert sich das Bild allmählich, und gemeinhin werden Kodálys großartige Solosonate sowie Max Regers Drei Suiten op. 131c als die Werke genannt, mit denen die moderne Literatur für solistisches Violoncello beginnt, die also am Beginn einer Renaissance stehen, die bis zum heutigen Tag eine enorme Vielfalt an neuer Literatur hervorgebracht hat. Dieser Scheidepunkt ist es, der Julius Berger auf seinem neuen Album interessiert, und der ihn gleichzeitig dazu animiert hat, die Situation genauer unter die Lupe zu nehmen – und so weitere Solostücke aus jenen Jahren zum Vorschein gebracht hat abseits der bekannten Namen, unter anderem in Form von drei Ersteinspielungen. Es gab also nicht nur Kodály und Reger, sondern auch Donald Francis Tovey, Adolf Busch und Walter Courvoisier, die seinerzeit Musik für Solocello schrieben. Für dieses Wiederaufkeimen einer über Jahrhunderte vernachlässigten Gattung hat Berger das schöne Bild der ersten Blumen auf den Bergen seiner Allgäuer Heimat zu Beginn des Frühlings gefunden, der Soldanellen (oder Alpenglöckchen); daher der Titel des Albums.
Am Beginn steht mit Regers Suite Nr. 2 d-moll, wie alle drei Suiten um die Jahreswende 1914/15 entstanden, ein Klassiker. Berger präsentiert in seinem ausführlichen und von großem Enthusiasmus getragenen Begleittext eine Reihe von Gedanken und Thesen rund um dieses Werk. Man muss gar nicht notwendigerweise allen davon vollumfänglich zustimmen, um seine Ausführungen als eine ungemein anregende Lektüre zu empfinden und Einblicke in seine intensive Beschäftigung mit dieser Musik zu erhalten, die zu einer sehr persönlichen und charaktervollen Lesart der Suite geführt haben. Berger begreift sie als die „schmerzensreiche“ in Regers Triptychon, unter anderem mit Bezügen zu Bachs Choral Wenn ich einmal soll scheiden, und dieser Ansatz ist bereits im Präludium exzellent nachvollziehbar. Berger nimmt den Satz relativ rasch, übrigens durchaus in Einklang mit Regers Metronomangabe (Viertel=54, was bei einem Largo mit Notenwerten bis hin zu Zweiunddreißigsteln nicht eben langsam ist), und das Resultat ist weniger ein breit strömender langsamer Satz als vielmehr ein konfliktreicher, ausgesprochen expressiver, ja teils agitiert deklamierender (vgl. die bereits erwähnten Zweiunddreißigstel im Mittelteil) Monolog. Man beachte in diesem Kontext unter anderem Bergers relativ kurze, teil fast staccatohafte Artikulation in Takten 6 bis 8, die exemplarisch für das Momentum, den dramatisch-passionierten Vorwärtsdrang seiner Interpretation stehen mag.
In Regers viersätziger Suite findet sich an dritter Stelle ein zweites Largo, und es ist interessant zu beobachten, wie Berger in seinem bewegteren Mittelteil den expressiven Duktus des Präludiums wieder aufgreift, andererseits aber den Kontrast zu den breit ausgesungenen, weiten Bögen der Eckteile vorzüglich herausarbeitet. Hier weiß Berger die innige, tief empfundene Gesangslinie exzellent zu realisieren, die großen Zusammenhänge dabei stets im Blick. Bei der Wiederkehr des Anfangsteils spielt Berger offenbar weite Teile auf der D-Saite, was der Musik einen entrückten, sanft gedämpften Charakter verleiht. Bergers grundsätzliches Verständnis der Suite zeigt sich aber auch in den beiden schnellen Sätzen: so ist die Gavotte an zweiter Stelle bei ihm ein sehr wohl helleres, aber nicht leichtfüßiges Intermezzo, stets von einer gewissen Schwerblütigkeit geprägt, die natürlich im etwas verlangsamten, von Berger dezidiert auch verhalten, zögernd begriffenen Mittelteil besonders zum Tragen kommt. Ähnliches gilt für die finale Gigue: Berger lässt sich hier eher Zeit, eilt nicht, sondern nimmt sich sogar im Gegenteil immer wieder Momente des Innehaltens heraus, baut ein gewisses Maß an Rubato auch in diesem Vivace-Finale ein, arbeitet die Harmonik und die dramatischen Höhepunkte klar heraus. Etwas überrascht war ich zunächst darüber, dass er den Schluss etwas verhaltener nimmt als möglich wäre (immerhin Fortissimo al fine), aber tatsächlich kommt die „schmerzensreiche“ Note dieser Musik so ausgezeichnet zur Geltung.
Donald Francis Tovey (1875–1940), der große britische Musikgelehrte, war – wie in den letzten Dekaden durch eine Reihe von CD-Einspielungen allmählich wieder ins Bewusstsein gerufen wird – auch ein exzellenter Komponist, der ein verhältnismäßig schmales, aber sehr dezidiert die Auseinandersetzung mit der großen Form und der Tradition suchendes Œuvre hinterlassen hat. Anfang der 1910er Jahre beschäftigte er sich intensiv mit Musik für solistische Streichinstrumente und publizierte 1913 jeweils eine Sonate für Solovioline und Solocello. Aus der letzteren, der Sonate für Violoncello solo D-Dur op. 30, hat Berger den Schlusssatz, eine großartige, monumentale, an Bach (und natürlich speziell der Chaconne aus der Partita d-moll BWV 1004) geschulte Passacaglia ausgewählt, die bei Berger allein bereits 20 Minuten in Anspruch nimmt. Die Ausdrucksspanne dieser Musik ist enorm, unter anderem mit einem teils geradezu dramatischen Mittelteil in Moll, einer veritablen Apotheose und schließlich einem wie befreit wirkenden finalen Allegro. Faszinierend dabei ganz besonders die klug disponierten Höhepunkte, die sorgfältig über lange Zeiträume aufgebauten Steigerungen – man beachte etwa die stetig zunehmende Bewegung über die ersten Minuten hinweg.
Es gibt mindestens zwei Einspielungen der gesamten Sonate. Interessiert man sich für Toveys Schaffen insgesamt, ist die recht solide, aber im Vergleich doch etwas blasse Einspielung von Alice Neary bei Toccata von natürlichem Interesse. Die (mutmaßliche) Ersteinspielung der Sonate hat indes um die Jahrtausendwende herum die amerikanische Cellistin Nancy Green vorgenommen. Green nimmt die Passacaglia ein gutes Stück zügiger als Berger und kommt auf eine Spieldauer von 14 Minuten (bei neun gekürzten Takten direkt vor dem Moll-Mittelteil). Sie betont dabei eher den Vorwärtsdrang, die Dynamik der Musik, während Bergers Lesart über weite Strecken meditativer, vielleicht sogar ein wenig archaisch wirkt und die große, weiträumige Architektur des Stücks in den Vordergrund stellt. Dass beide Varianten sich als ausgesprochen valide Ansätze erweisen, spricht für die Qualitäten und den Facettenreichtum von Toveys Musik.
Mit den Solowerken von Adolf Busch (1891–1952) betritt Julius Berger gänzlich neues Terrain, denn bislang lagen von diesen Kompositionen keine Einspielungen vor. Busch war natürlich vor allem einer der berühmtesten Geiger der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat aber auch sein Leben lang komponiert. Völlig vergessen war sein Schaffen zwar nie, aber eine besonders große Rolle haben seine Werke auf Tonträger lange Zeit nicht gespielt. In jüngerer Zeit ist speziell seine Kammermusik, die sicherlich einen der Schwerpunkte seines Schaffens darstellt, ein wenig stärker in den Fokus gerückt. Busch war mit Max Reger befreundet, und so ganz möchte ich Bergers Aussage, diese Freundschaft habe zu keiner Verwandtschaft der Kompositionsstile geführt, nicht folgen – es gibt schon eine ganze Reihe von Werken Buschs, die recht deutlich an Reger gemahnen. Was allerdings sehr wohl zutrifft, ist, dass Buschs kompakt gehaltene Suite op. 8a, um 1914 und damit zeitgleich oder sogar vor Regers Suiten entstanden, sich überraschend deutlich von diesen unterscheidet, unter anderem deshalb, weil die Bezugnahme auf das Vorbild Bachs in Buschs Suite zwar auch vorhanden ist, aber weniger deutlich erscheint als in den übrigen Werken auf dieser CD.
Schon das Präludium lässt aufhorchen, eine sich chromatisch windende, dunkel-vergrübelt gehaltene Fantasie, die eigentlich erst mit den letzten Takten g-moll als Grundtonart bestätigt (nicht umsonst trägt die Suite, obwohl um G zentriert, keine Tonartenbezeichnung). Sehr originell, widerborstig und bocksprüngig das kurze Scherzo an zweiter Stelle. Mit den beiden letzten Sätzen, Romanze und Tarantelle, hellt sich der Charakter des Werks auf, wird freundlicher, obwohl selbst die abschließende Tarantelle, nun in G-Dur, nicht unbedingt von Leichtigkeit geprägt ist: vielmehr dominiert auch hier eine gewisse Erdenschwere, sind es die Kanten, die dieser Musik ihr ganz eigenes Profil geben, von Julius Berger mit Nachdruck und viel Sinn für diese spezifische Atmosphärik in Szene gesetzt. Einige Jahre später, 1922 nämlich, ließ Busch seiner Suite noch ein Präludium und Fuge d-moll op. 8b folgen, ein Diptychon, das sich nun wesentlich expliziter auf die Tradition Bachs bezieht. Im eher ruhig gehaltenen Präludium erweist sich Berger einmal mehr als souveräner Gestalter mit sorgfältig durchdachter Artikulation; in der Fuge überrascht erst einmal seine erstaunlich gemäßigte Tempowahl angesichts eines Allegro energico, doch wo das Fugenthema m. E. zu einem rascheren Puls einladen würde, wird dies durch einige Sechzehntelpassagen wenig später wieder relativiert.
Der vermutlich am wenigsten bekannte Komponist, der auf dieser CD vertreten ist, ist der gebürtige Schweizer Walter Courvoisier (1875–1931), der zunächst Medizin studierte und als Arzt praktizierte, bevor er sich doch für die Musik entschied und in München u. a. Schüler von Ludwig Thuille wurde. Nur wenig später wurde er selbst ein gefragter Kompositionslehrer an der Münchener Akademie der Tonkunst. Courvoisiers Œuvre ist eher überschaubar und konzentriert sich insbesondere auf Vokalmusik (Lieder, Chorwerke sowie drei Opern); im Bereich der Instrumentalmusik beschäftigte er sich vor allem mit Variationswerken für Klavier und Solosuiten für Streicher. Seine sechs Suiten für Violine solo op. 31 hat der Geiger Hansheinz Schneeberger auf CD eingespielt. Zeitgleich mit diesen Suiten komponierte Courvoisier 1921 auch zwei Suiten für Violoncello solo, die jedoch unveröffentlicht blieben; vermutlich war auch hier ein Zyklus von sechs Suiten geplant, der jedoch nicht realisiert wurde. Die zunächst vorgesehene Opuszahl 32 hat Courvoisier später seiner Oper Der Sünde Zauberei zugeteilt. Erst 2021 hat Florian Schuck die beiden Suiten herausgegeben.
Julius Berger hat sich auf diesem Album für die Suite Nr. 2 in h-moll entschieden. Courvoisier bezieht sich hier bereits in der Satzfolge deutlich auf Bachs Vorbild: zwar steht am Beginn kein Präludium, sondern eine Introduction, aber die Abfolge der übrigen Sätze folgt genau der Struktur der Bach’schen Suiten, mit dem einzigen Unterschied, dass es gewissermaßen zwei „fünfte Sätze“ (im Sinne Bachs) gibt, nämlich sowohl Bourrée als auch Menuett. Dabei ist die Introduction eher eine Art dramatisch akzentuiertes Vorspiel als ein Präludium à la Bach (mit attacca-Übergang zur nachfolgenden Allemande), in der Bourée gibt es (anders als bei Bach) kein Trio bzw. eine Bourrée II, und während ansonsten alle Sätze (analog zu Bach) in h-moll gehalten sind, steht das Menuett (I) in D-Dur – insofern fallen diese Sätze also auch sonst ganz leicht aus dem Rahmen.
Stilistisch kombiniert Courvoisier deutlich erkennbar Elemente, Formeln und Referenzen an die Musik Bachs mit Mitteln der (nachromantischen) Tonsprache des frühen 20. Jahrhunderts, etwa in Sachen Rhythmik, Harmonik und Modulationen oder gelegentlicher Verwendung von Pizzicato; die spieltechnischen Anforderungen liegen eher im Rahmen der späteren Bach-Suiten. Anders als Bach gibt Courvoisier umfassende Anweisungen zur Dynamik, ganz wie bei Bach sind die Angaben zur Artikulation dagegen sehr sparsam, sodass sich für den Interpret hier zahlreiche Freiräume ergeben, so zum Beispiel in der Allemande mit ihren weitgehend kontinuierlichen Sechzehntelbewegungen. Ein eigenes Profil haben alle sieben Sätze, kleine Charakterstücke etwa die Courante (eine Art Scherzo im 9/8-Takt) oder die abschließende, regelrecht trotzig daherkommende Gigue. Besonders melodiös gehalten sind Bourrée und Menuett, Herzstück der Suite die tief empfundene Sarabande, die meditative Versenkung, ja ein gewisses Maß an Zeitlosigkeit ausstrahlt. All dies erfährt durch Berger eine sprechende, klangvolle, durchdachte Darbietung; in Bourrée und Menuett etwa könnte man teils eine etwas breitere Artikulation wählen, aber dies fällt letztlich unter die besagten Freiräume, die Courvoisier dem Cellisten mit auf den Weg gibt.
Erwähnt sei auch, dass Julius Berger sich für dieses Album für Darmseiten und eine Frequenz von 432 Hz entschieden hat, was den Einspielungen ein warmes, rundes, volles Timbre verleiht. Eine zusätzliche Erwähnung verdient auch noch einmal sein exzellenter, persönlich gefärbter und inspirierender Begleittext (übrigens stammt auch das Foto auf dem Cover der CD von Berger, wie auch ein kleines Gedicht als Geleit). Ob Toveys Sonate wirklich das erste Solowerk nach Bach war, scheint mir ein wenig in einer Grauzone zu liegen, selbst wenn man Solowerke komponierender Cellisten (wie Klengels Opus 43, vielleicht auch noch die 1901 erschienenen Präludien und Fugen des Monegassen Louis Abbiate) ausklammert. Weitgehend zeitgleich mit Toveys Sonate ist z. B. offenbar die Solosuite des (wie übrigens auch Tovey) von Casals hochgeschätzten Emánuel Moór entstanden – dies also ebenfalls eine „Soldanelle“. Ein weiterer Name, den man in diesem Zusammenhang wohl a priori überhaupt nicht vermuten würde, ist Jean Sibelius, der bereits um 1887 einen gut zehnminütigen Zyklus von Variationen über ein eigenes Thema für Solocello komponiert hat, faktisch noch zu seinen Juvenilia zählend.
In den vergangenen Jahren sind aus naheliegenden Gründen zahlreiche (und oft genug hochklassige) Alben für Soloinstrumente und speziell auch Solocello erschienen. Aus dieser Vielzahl sticht Berger „Soldanella“ nichtsdestotrotz noch einmal heraus. Ein Grund hierfür ist die gestalterische Souveränität dieser Einspielungen, vor allem aber ist es der Mut, den Berger hier aufbringt, der Pioniergeist, mit dem er sich für hoch interessante Musik einsetzt, die eben nicht auf Effekt setzt, die nicht populär sein will, sondern sich durch ihre große Ernsthaftigkeit auszeichnet. Es sind expressive, durchdachte, vielleicht nicht immer bequeme, aber in ihrem Bekenntnis zu künstlerischer Größe umso fesselndere Kompositionen, die auf diesen fast 80 Minuten Musik versammelt sind. Hierin liegt der ganz besondere Reiz dieses großartigen Albums.
[Holger Sambale, Oktober 2023]