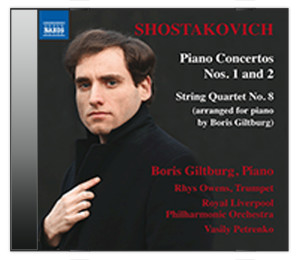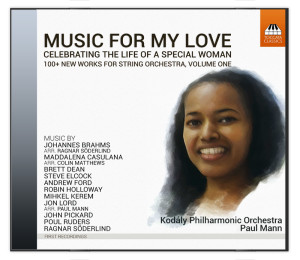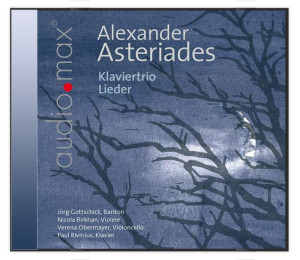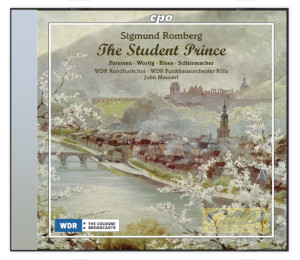Leoš Janáček: Orchestersuiten aus Jenůfa, Kátia Kabanová und Osud („Schicksal“)
Prague Radio Symphony Orchestra – Tomáš Netopil
Label: Supraphon (Vertrieb: note1); Art.-Nr.: SU4194-2 / EAN: 099925419424
Eine neue CD des wunderbaren Labels Supraphon aus Prag stellt drei Orchestersuiten aus Opern Leoš Janáčeks vor. „Moment mal!“, denkt sich da der geneigte Janáček-Fan: Janáček hat ja aus seinen drei Opern Jenůfa, Kátia Kabanová und Osud („Schicksal“) gar keine Suiten ausgekoppelt. Kein Problem, denn das haben andere erledigt: Osud hat František Jílek zusammengestellt, Kátia Kabanová Jaroslav Smolka und als jüngstes Beispiel für diese Art der Janáček-Opernmusik-Zweitverwertung hat sich der Dirigent Manfred Honeck der Oper Jenůfa angenommen, deren Orchestersuite er zusammen mit Arrangeur Tomáš Ille verwirklicht hat.
Man mag zu dieser Herangehensweise stehen, wie man will. Fakt ist: Sie macht auf kompakte und recht unterhaltsame Art Musik Janáčeks zugänglich, die sich sonst als Intermezzo oder kurzes Verbindungsglied in den Weiten großer Opernpartituren verbirgt und im großen Werkzusammenhang eines Bühnenstücks manchmal ein Schattendasein fristet.
Die noch stark spätromantisch angehauchte Jenůfa bietet – sicherlich auch dank ihres dörflichen Sujets, in dem es vor Anklängen an die tschechische Folklore nur so wimmelt – reichlich musikalisches Material, das sich gut für eine Suite eignet. Die von Honeck und Ille unterbrechungsfrei angelegte musikalische Sause vollzieht allerdings manch ungelenke Wendung, die wohl daher rührt, dass man sich bemühte, möglichst wenig Musik hinzu zu komponieren, um die einzelnen Teile miteinander verbinden zu können. Ille hat die Suite zwar nicht chronologisch angelegt, sondern in Art einer musikalischen Collage, trotzdem gelang es nicht vollauf überzeugend, ein musikalisches Konstrukt, ein großes Ganzes, zu bilden, das man als eigenständiges Werk schätzen kann.
Die Oper Kátia Kabanová wurde erst spät durch Charles Mackerras in ihrer originalen Form samt den verschollen geglaubten Orchester-Intermezzi auf die Bühne gebracht. Suiten-Arrangeur Jaroslav Smolka hat diese Intermezzi offenbar noch nicht gekannt und konzentrierte sich auch auf solche Teile der Oper, bei denen in der Suite die Trompete den Gesang substituiert. Das Ergebnis wirkt sehr atmosphärisch und durchaus überzeugend. Nach heutigem musikwissenschaftlichen Standard verzichtet die Suite aber auf reizvolles Material. Und so müsste man im Prinzip eine Suite zu dieser Oper heute ganz neu zusammenstellen.
Osud („Schicksal“) wurde zu Janáčeks Lebzeiten als zu komplex für die Bühnenaufführung empfunden (einmal ganz abgesehen davon, dass auch das Libretto seinerzeit verstörte, das sich unter anderem mit den Themen Prostitution und Selbstmord beschäftigt). Die Oper kam erst 30 Jahre nach dem Tod des Komponisten durch den Dirigenten František Jílek zur Aufführung. Jener bearbeitete das Werk wohl ziemlich freimütig und schichtete ganze Etappen des Handlungsverlaufs um. Dies bot ihm quasi „nebenbei“ eine ideale Grundlage für die Zusammenstellung der hier zu hörenden Suite, die – das hört man ziemlich schnell – der überzeugendste Beitrag auf der vorliegenden CD ist, wenn man einmal von dem ziemlich überraschenden, völlig abrupt einsetzenden Schluss absieht, bei dem man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass da etwas „fehlt“.
Die Leistung des Prager Radio-Sinfonieorchesters ist auf diesem Album im Prinzip solide und ohne Tadel, lässt es aber – womöglich auch aufgrund der etwas holzschnittartigen Einstudierung durch Tomáš Netopil – zuweilen an emotionalem Zugriff vermissen. Die deftigen Sachen wünschte man sich deftiger, die zarten Sachen zarter, die heiteren Sachen heiterer, das Gewitter aus Osud bedrohlicher, usw. Der etwas weitschweifige Booklet-Text erzählt viel über die Opern, aber frappierend wenig über die Entstehung der hier zu hörenden Suiten, die ja doch im Zentrum dieses Albums stehen. Wenn es ein Schulaufsatz wäre, würde mal wohl sagen: „Am Thema vorbei“. Die Klangqualität der Aufnahme von den Tonmeistern des tschechischen Rundfunks ist ebenso solide (aber zugleich auch ebenso unspektakulär) wie die gesamte Produktion. Fazit: Ein Album, das wohl vor allem die ganz eingefleischten Janáček-Jünger brauchen, die alles andere schon haben.
[Grete Catus, Dezember 2016]