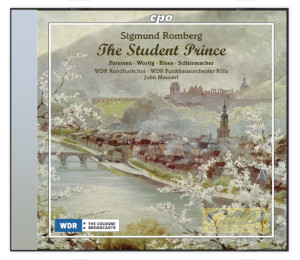Am Freitag, 12. 11. 2021, spielte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Musica-viva-Konzert unter Pablo Heras-Casado zwei Uraufführungen: Vom Sterben der Sterne von Jüri Reinvere sowie Tour de Trance von Arnulf Herrmann – mit Anja Petersen als Sopranistin. Beide Stücke sowie ihre hervorragende Wiedergabe konnten überzeugen.

Ein Abend, der nur aus Uraufführungen von Auftragswerken besteht, ist selbst bei der Münchner Konzertreihe musica viva des BR eher selten. Das erste Stück stammt vom in Estland geborenen und aufgewachsenen Komponisten Jüri Reinvere (Jahrgang 1971). Den ersten Kompositionsunterricht erhielt er in Tallin beim leider viel zu früh verstorbenen Lepo Sumera (1950–2000), der zudem von 1988 bis 1992 estnischer Kultusminister war. Nach der Unabhängigkeit von der Sowjetherrschaft studierte Reinvere in Warschau und Helsinki. Neben seiner Musik ist er aber auch als Lyriker und Essayist hervorgetreten, dabei mehrfach ausgezeichnet worden. Seit 2005 lebt das siebensprachige Multitalent in Deutschland.
Vom Sterben der Sterne bezeichnet der früh von der Astronomie begeisterte Komponist als Symphonische Skizzen. Das 32-minütige Werk mit normaler Orchesterbesetzung (3-faches Holz etc.) arbeitet weniger thematisch als mit Klangflächen, die über weite Strecken dunkel timbriert sind: Teils unheimlich – wie der sich aus tiefen Trommeln, Bässen und Celli langsam hocharbeitende Beginn –, jedoch immer erhaben und ehrfurchtsvoll. Hierbei spürt man noch Einflüsse Sumeras, der eine ganz eigentümliche Art naturbezogenen Minimalismus‘ entwickelt hatte – kaum mit der amerikanischen minimal music vergleichbar. Reinvere ist dennoch sowohl davon als auch von der dichten, clusterhaften Klanglichkeit eines György Ligeti (Atmosphères, Lontano) gleichermaßen entfernt. Der Hörer verfolgt einen großen Entwicklungsbogen mit ab und zu aufblitzenden, fasslichen Motiven – im Sinne eines gewaltigen Crescendos auf einen Höhepunkt hin, nach dem dann die Intensität wieder bis ins beinahe Unhörbare abnimmt – durchaus symphonisch. Die Instrumentation bleibt dabei stets klar: Bis auf das Atmen der Bläser verzichtet Reinvere fast komplett auf mittlerweile überstrapazierte Geräuscheffekte, setzt punktuell mal ein Becken als akustische Hüllkurve im Diskant ein. Klavier, Celesta und Glockenspiel versteht man als eindeutige Zeichen. Dafür hören wir etwa feine Unisoni von Streichern und Flöten oder die gekonnte Imitation von Orgel- oder Akkordeonklängen – alles zutiefst beeindruckend und auf sympathische Weise irgendwie altmodisch. Der Applaus des leider wieder dünn besetzten Herkulessaals ist herzlich.
Arnulf Herrmann (*1968) ist hier längst kein Unbekannter mehr. Als die Sopranistin Anja Petersen 2014 nur zwei Tage vor der Uraufführung für die Drei Gesänge am offenen Fenster eingesprungen war und sich als echter Glücksfall erwiesen hatte, versetzte dies Presse und Publikum in Erstaunen. Seitdem ergab sich eine stetige Zusammenarbeit der beiden Künstler, und für Tour de Trance – nach einem Text von Monika Rinck – hatte Herrmann diese Stimme sogleich im Kopf. Im in vier Abschnitte unterteilten, etwas über halbstündigen Stück kommt Petersen aber erst spät zum Einsatz, wo von Rincks Lyrik lediglich der Anfang ausladender, der ganze Rest dann überraschend schnell und lapidar vertont wird. Das täuscht natürlich; denn zuvor erscheint das Orchester bereits offensichtlich durch Elemente des Textes inspiriert. Liest man Dinge wie „wilde schläge in der ferne“, „halluzinogene leere“ oder „schlingern“, wird klar, dass Hermann in seiner Arbeit mit „Interaktionsfiguren“ den Hörer genau darauf einstimmt. Da gibt es ein meist sehr aggressiv ausgeführtes, rhythmisch klar am Kopfthema von Beethovens Fünfter angelehntes Motiv – im 2. Abschnitt reißt dem Solocellisten hierbei eine Saite, worauf dieser geistesgegenwärtig auf dem Instrument seiner Pultnachbarin weiterspielt. Scheintonale Momente, die jedoch sofort mikrointervallisch destabilisiert werden, oder eine vierteltönige Pendelfigur markieren einen Bewusstseinszustand, dem gewissermaßen der Boden unter den Füßen fehlt. Dies ist alles spannend und in seiner direkten Emotionalität jede Sekunde mitreißend – bis zum abschließenden Zerfall. Frau Petersen kann diesmal mit nicht viel mehr als ein paar länger ausgehaltenen, schönen Tönen glänzen; ihre Präsenz ist trotzdem wieder eindrucksvoll.
Mit Pablo Heras-Casado debütiert heute ein angehender Weltstar bei der musica viva, der von historischer Aufführungspraxis bis eben zur zeitgenössischen Musik alles drauf zu haben scheint. Die Schlagtechnik – fürs bloße Taktieren wechselt er zwischen den Händen – wirkt zunächst ungewöhnlich; seine rhythmische Präzision bis in die Fingerspitzen und das klare, engagierte Einfordern von Ausdruck und Klang sind derweil absolut überragend. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks geht mit ihm von Anfang an eine herrliche Symbiose ein, mit einem bei beiden Uraufführungen großartigen Ergebnis, das keine Wünsche offenlässt. Genau der richtige Mann, den man, nicht nur für solche Musik, nun bitte regelmäßig einladen sollte! Trotz der erneut durch Corona leicht gedrückten Stimmung langanhaltende Ovationen für alle Beteiligten.
BR-KLASSIK sendet die Aufzeichnung des Konzerts am 23.11. um 20:05 Uhr.
[Martin Blaumeiser, 13. November 2020]