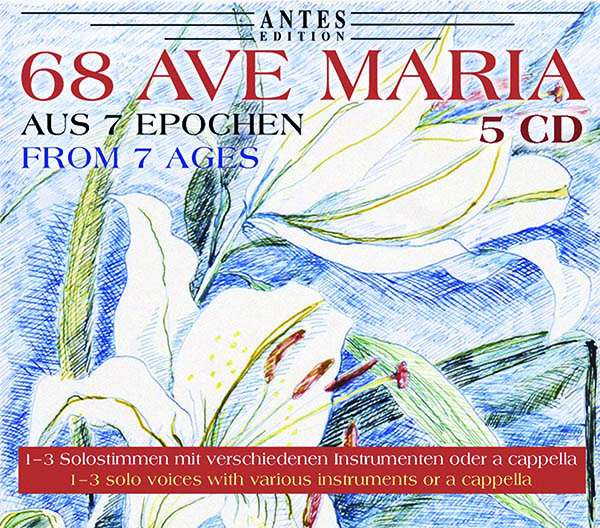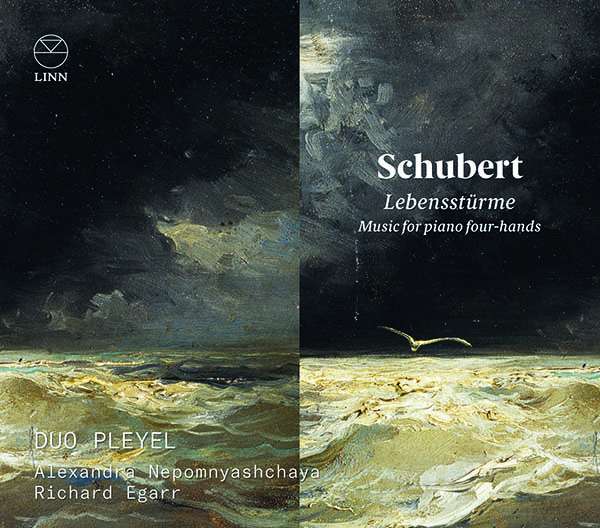Avi-music, 8553239; EAN: 4 260085 532391

Alessandro Fagiuoli und Alessia Toffanin vollziehen die Wandlung des “Bad boy of music“, George Antheil, zu einem der Tradition zugewandten Komponisten anhand seiner vier Violinsonaten nach. Chronologisch beginnen sie mit der viersätzigen Ersten Sonate, die Olga Rudge gewidmet ist, und der Ezra Pound „best of friends“ zugeeigneten einsätzigen Zweiten Sonate je von 1923. Ein Jahr später entstand die Dritte Sonate, welche auf vorliegender CD erstmalig eingespielt wurde, und uns mit ganz anderen Klängen verdutzt. Nach einer Pause von über 20 Jahren schrieb Antheil seine Vierte Sonate 1947/48 als „New Second Violin Sonata“, nachdem er die ursprünglich zweite aberkannte.
Bevor George Antheil zum anerkannten Filmmusikkomponisten wurde und mit seinen freudestrahlenden wie eingängigen letzten Symphonien zum Publikumsliebling avancierte, intendierte er genau das Gegenteil: als Vorreiter des Futurismus wollte er sich einen Namen machen, provozieren und aufreiben, das Instrument zur Maschine verstümmeln. Heute kann man sich kaum vorstellen, dass das Ballet mécanique und A jazz symphony (2. Version) vom gleichen Autor stammen.
Als Antheil 1923 seine Erste Violinsonate schrieb, gelang ihm direkt der große Wurf hin zu einer eigenständigen, provokanten und doch durch ihren aberwitzigen Schwung mitreißenden Sonate. Ein gleichbleibendes Motto durchzieht die vier Sätze, in denen jeweils wenig Entwicklung stattfindet zugunsten von kubistischer Aneinanderreihung verschiedenartiger Elemente, die in sich höchstens rhythmisch fortgesponnen werden. Dabei verlangt Antheil dem Streichinstrument barbarische Vortragsarten ab, dass es gar dem Klang einer Säge gleichkommen soll. Die beiden langsameren, aber nicht weniger intensiven Mittelsätze entführen uns in den Orient, bevor mit dem Presto-Finale der Kopfsatz noch weiter in die Höhe getrieben wird. Im gleichen Jahr entstand die Zweite Sonate, in welcher die Mechanisierung des Klaviers ihr Maximum erreicht, wenn der Pianist am Ende die Tasten gegen zwei Trommeln eintauscht. Darüber hinaus adaptiert Antheil alle möglichen damals populären Melodien, indem er sie ihren Genres entreißt, verzerrt und schließlich verstümmelt in seine Sonate integriert. Stilistisch erscheint sie wie aus einem Guss mit dem Erstlingswerk, jazzige bis vertrackte Rhythmen, Klangtrauben am Klavier und brutale Strichweisen auf der Geige.
Merkwürdig zurückgehalten und reduziert wirkt dagegen die ein Jahr später entstandene Dritte Violinsonate. Entweder darf sie als glühende Verehrung für oder aber als kühner Raubzug gegen Strawinsky angesehen werden darf: So ziemlich alles in dem etwa 18 Minuten langen Satz lässt sich in deutliche Verbindung mit dem Russen bringen. Am offenkundigsten ist der Bezug zu Petruschka, die Antheil inspirierte mitsamt ihrer Bitonalität, den Melodien des Jahrmarkts (Antheil zeigte natürlich besonderes Interesse an der Drehleier), den wuselnden Klangflächen und den hemmungslosen Überlagerungen scheinbar nicht zusammenpassenden Materials; aber auch Sacre du printemps erhält einen Ehrenplatz in diesem Werk. Von den vier Sonaten mag dies die sperrigste und undankbarste sein, aber nur auf den ersten Blick, denn unter der Oberfläche verblüfft die meisterlichen Setzkunst, der formalen Konzeption und die klangliche Differenzierung.
Als Antheil 1933 nach New York zurückkehrte, hinterließ er eine klaffende Lücke im Verzeichnis seiner ‚ernsten‘ Werke und finanzierte sich mit Filmmusiken seinen Lebensunterhalt, erst 1945 entstand eine Sonatine für Violine und Klavier, die nun aber nichts mehr vom „Bad boy of music“ aufwies, sondern ganz im Gegenteil traditionsbewusst und weitgehend verständlich war. Die Vierte Violinsonate entstand genau in der Zeit dieses Umschwungs mit klassisch-dreisätziger Form und nachvollziehbaren Entwicklungen. Da Antheil seine ursprünglich zweite Sonate nun verleumdete, sollte dieses Werk als „New second violin sonata“ den Platz des 25 Jahre früheren Werks einnehmen.
Aufgrund ihrer horrenden technischen Schwierigkeiten wurden diese Sonaten wie allgemein ein Großteil des Solo- und Kammermusikwerk Antheils nur selten aufgeführt – die Dritte der Violinsonaten wurde auf dieser CD gar erstmalig eingespielt. Alessandro Fagiuoli und Alessia Toffanin stellen sich in dieser Aufnahme gleich allen vier dieser Sonaten und liefern ein nicht nur mechanisch einwandfreies Ergebnis ab. Flexibel finden sich die beiden Musiker in allen Stilwelten zurecht, die Antheil erschließt, bleiben schwungvoll und gewitzt, ohne die notwendige Strenge zu bewahren. Sie genießen förmlich die Skurrilität und Entrücktheit dieser Werke, gehen in den abenteuerlichen Klangeffekten auf. Dabei bewahren sich Fagiuoli und Toffanin davor, sich nur auf das reine Geräusch zu konzentrieren: es gelingt ihnen auch, die einzelnen Teile in Bezug zu setzen. In den frühen Sonaten blicken sie unter die triumphierende Oberfläche und erkennen die wahre Substanz. Wie gestaltungsfähig die beiden Musiker tatsächlich sind, merkt der Hörer spätestens in der späten Vierten Sonate, die durch ihre innere Ausgewogenheit und formale Stimmigkeit noch feineres Gespür von den Darbietenden verlangt. Hier trumpfen die Musiker dieser Aufnahme mit großen Bögen, harmonischem Verständnis und formaler Stringenz auf, kontrastieren durch vielseitige Tonfärbung und präzise abgestufte Artikulation. Eine rundum gelungene Aufnahme, die mitreißt und die Spannung die gesamten 80 Minuten Spieldauer aufrechterhält.

[Oliver Fraenzke, Mai 2020]