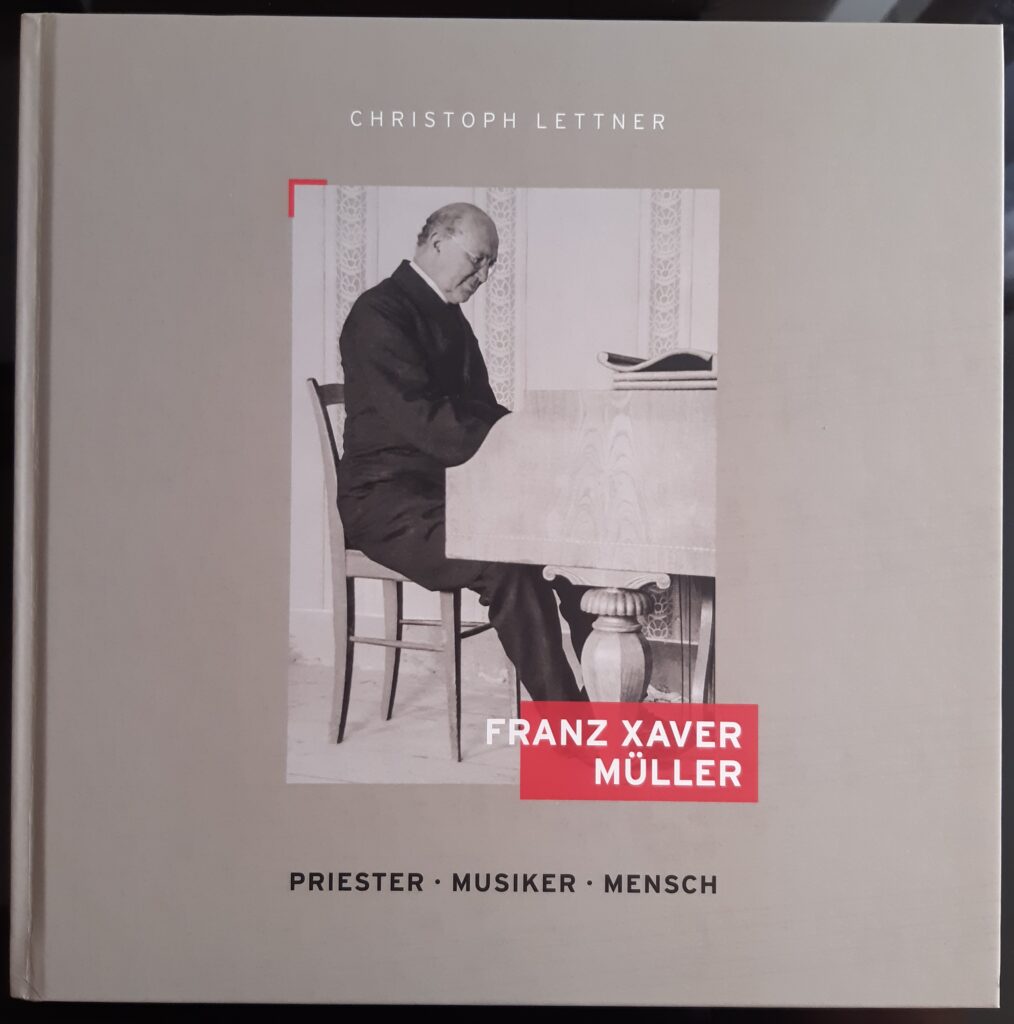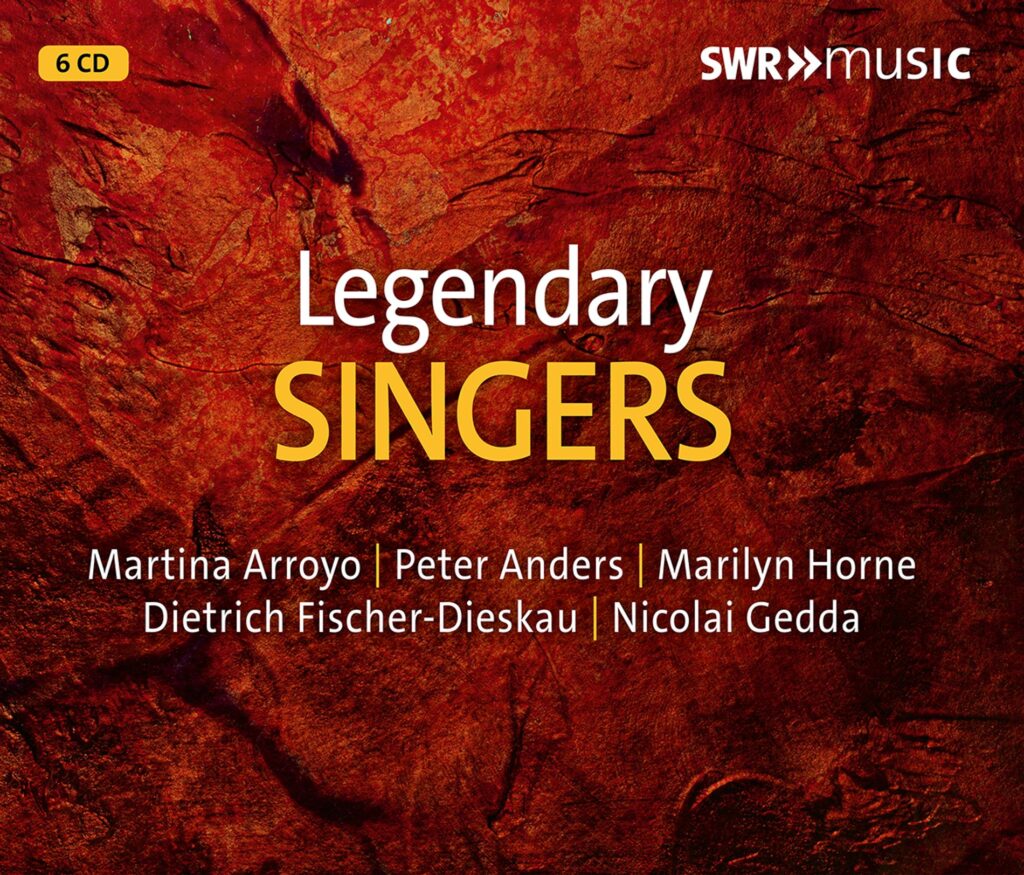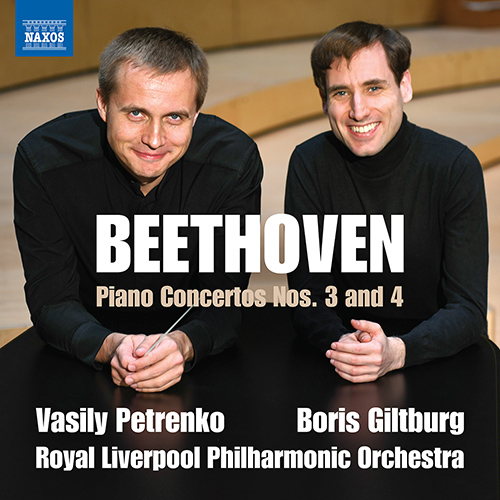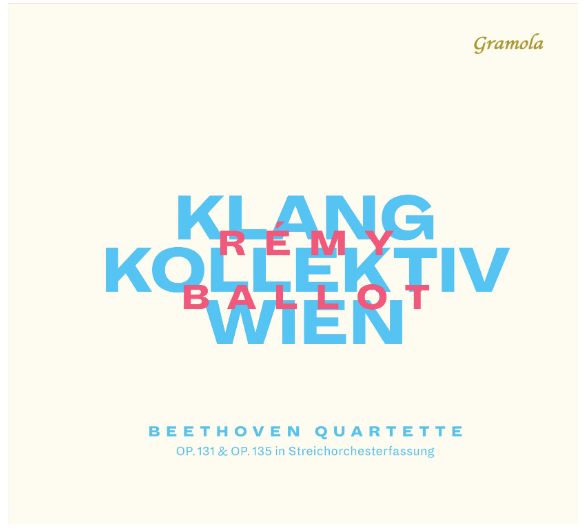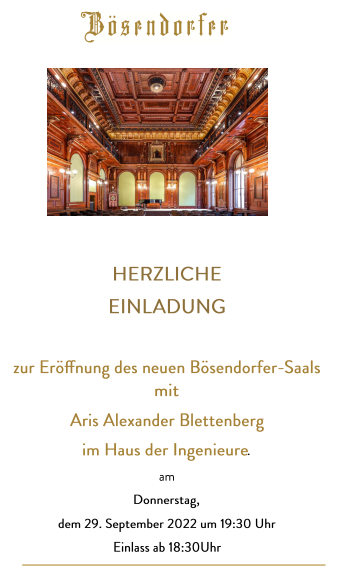Querstand, VKJK2406; EAN:4025796024067
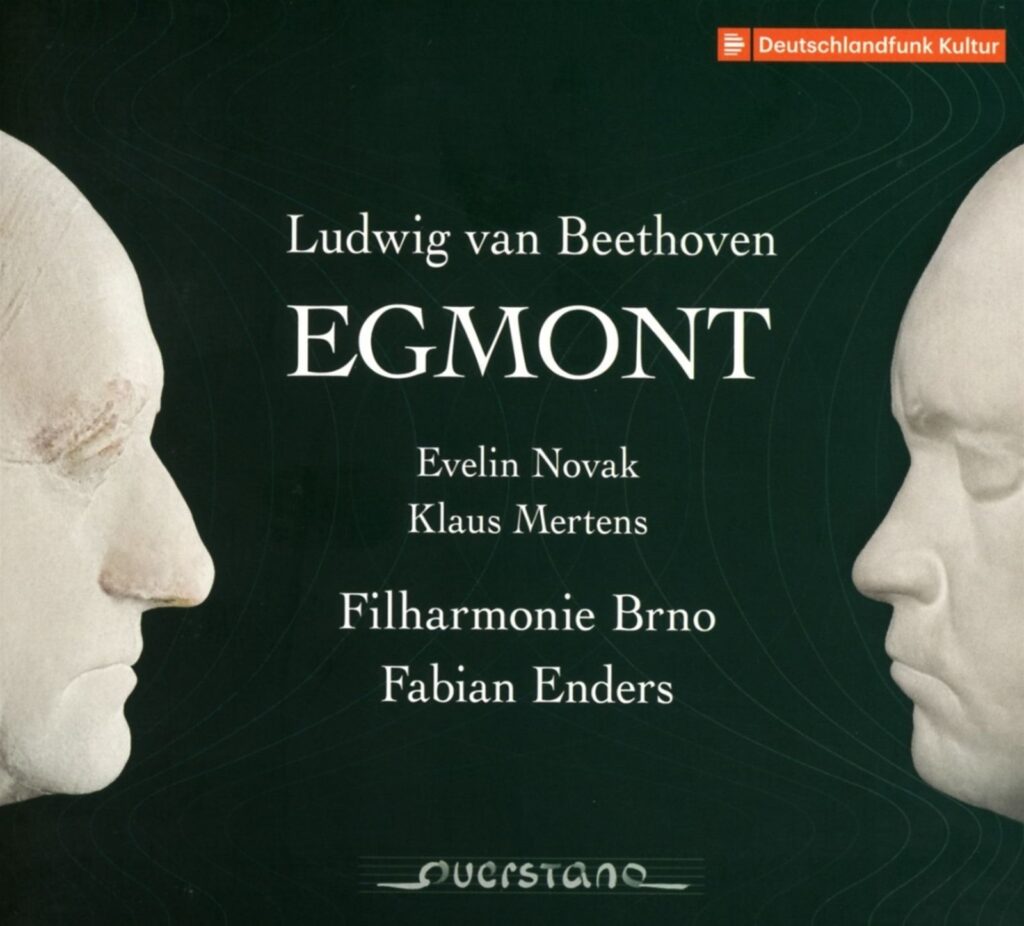
Die Filharmonie Brno hat unter der Leitung von Fabian Enders bei Querstand eine Gesamteinspielung von Ludwig van Beethovens Schauspielmusik op. 84 zu Johann Wolfgang von Goethes Tragödie Egmont vorgelegt. Als Sopransolistin ist Evelin Novak zu hören, als Rezitator der melodramatischen Abschnitte Klaus Mertens.
Von Beethovens Schauspiel-Musik zu Goethes Drama Egmont wird traditionell zwar meist nur die Ouvertüre aufgeführt, dies jedoch umso häufiger – sie ist ebenso unbestrittenes Meisterwerk wie „Hit“ der klassischen Musik. Über Jahrzehnte wurde die übrige Musik aus Beethovens Schauspielmusik zu Goethes Drama Egmont hingegen sehr stiefmütterlich behandelt. Öffentlich aufgeführt wird das komplette Werk fast nie, eingespielt nur alle Jubeljahre einmal.
Zu Beethovens Geburtstagsjahr 2020 – geplant als feierliches Jubelfest und letztlich in den Wirren der Coronakrise unter seinen Möglichkeiten geblieben – änderte sich an diesem Umstand aber einiges: Binnen kurzer Frist wurde gleich eine Hand voll Egmonts neu auf CD veröffentlicht, sodass es zusammen mit den historischen Aufnahmen aktuell zehn verschiedene Einspielungen am Markt gibt, unter denen man komfortabel seinen Favoriten wählen kann.
Dirigent Fabian Enders legt nun mit der Filharmonie Brno in Koproduktion mit dem Deutschlandfunk eine elfte Version beim Label Querstand vor – dies als Ergebnis eines Live-Mitschnitts aus der Potsdamer Friedenskirche vom 19. 11. 2021. Enders hat sich für den Einbezug von Goethe-Textrezitation entschieden, sodass im Rahmen der Gesamtspielzeit dieses Albums immerhin etwa 15 von insgesamt 54:29 min. auf den Textanteil (durch die sonore Stimme von Klaus Mertens vorgetragen) entfallen.
Dabei hat Fabian Enders selbst eigens eine neue Textfassung entwickelt, in der (wie er im Booklet zur vorliegenden CD schreibt) „eine von der Notwendigkeit des Dialogischen gelöste Textgestaltung“ erreicht werden sollte, „die die Szenen gleichsam als Bilder und Bezugsmomente der Musik deutlich … und Motive der Handlung im Hintergrund schlüssig sichtbar werden lässt.“ Das ist zweifellos gut gelungen, und so lässt sich auch der Textanteil in dieser Produktion recht gut anhören, aber eigentlich sind wir ja wegen Beethoven hier.
Da ist Enders Herangehensweise zunächst überraschend: Im Gegensatz zu vielen modernen Beethoven-Deutungen, bei denen die Rolle des Komponisten als Musik-Revolutionär gerne besonders herausgekitzelt wird, indem gern schroffe Akzente und straffe Tempi gesetzt werden, kleidet Enders das übrigens wirklich gut disponierte mährische Orchester in einen samtigen Wohlklang – zumeist perfekt ausbalanciert und durchgehend klangschön.
Im Orchester gibt es allerdings erkennbar Solisten und Instrumentengruppen, die unzweifelhaft besser sind als andere. Besondere Erwähnung verdienen die schön samtigen Streicher, während die Holzbläser zuweilen angestrengt wirken. Die Solo-Oboe schießt dabei des Öfteren über das Ziel hinaus und stört die ansonsten gute Abstimmung.
Die Tempi sind durchweg recht bedächtig, was nicht weiter stört, wenn die innere Spannung gehalten werden kann. In einigen Nummern jedoch (z.B. „No. 3, Zwischenakt II“ oder „No. 7 Clärchens Tod bezeichnend“) würde man sich in der Tat etwas mehr Dynamik wünschen. Alles in allem ist die Interpretation aber so stimmig, dass man sich als Hörerin oder Hörer hier in eine regelrechte Wohlfühlstimmung eingleitet.
Die Gesangsdarbietungen lassen sich ebenfalls ganz auf diese Klangvision ein. Sopranistin Evelin Novak ist leider nicht optimal textverständlich, jedoch ist das nur ein kleiner Malus, denn ihr warmes, lyrisches Klang-Timbre entschädigt ausreichend dafür, dass man sich den Text der Lieder im Booklet zusammensuchen muss.
Das Melodram „Süßer Schlaf…“ ist ein Musterbeispiel für Enders‘ wirklich gute Aufführungs-Leitung: In optimalem Atem koexistieren hier Rezitator und Orchester. Auch die Balance innerhalb des Orchesters ist hier ganz wunderbar. Speziell dieses Stück wirkt auffällig gut eingeprobt. Rezitator Klaus Mertens hat zudem sichtliche Freude daran, sich in hymnischer, schwelgender Art diesem Relikt des frühesten 19. Jahrhunderts ganz hinzugeben.
Vom Aufnahmeklang gibt es Gutes zu berichten: Angenehm räumlich, ohne ein „zu viel“ an Hall. Ja, man nimmt diesem Klang den Live-Ursprung durchaus ab, während sich jedoch die Nebengeräusche, die Live-Aufnahmen manchmal mit sich bringen, auf ein Mindestmaß reduziert sind. Man sollte wohl noch anmerken, dass die als von Beethoven als „Siegessymphonie“ betitelte Schlussnummer in dieser Einspielung vom Schlussapplaus des Konzert-Publikums gefolgt ist (das ohrenscheinlich sehr zufrieden war).
Als Fazit lässt sich ziehen, dass wir es hier mit einer im besten Sinne unauffälligen Egmont-Aufnahme zu tun haben: statt Überbetonung von Extremen gibt es hier wohligen Schönklang und gute Orchesterleistungen – Ein Album zum „Am-Stück-Durchhören“. So etwas kann stellenweise etwas altmodisch wirken und ist gewiss nicht dazu angetan, „Originalklang“-Enthusiasten zu begeistern. Eher schon haben wir es hier mit einer modernen Alternative zu der in die Jahre gekommenen Karajan-Aufnahme von 1969 zu tun. Und das ist für manche ja vielleicht sogar die erfreulichere Nachricht als wenn dies die neueste Einspielung im Grenzbereich der aktuellsten Strömungen der historischen Aufführungspraxis wäre.
[René Brinkmann, Januar 2025]