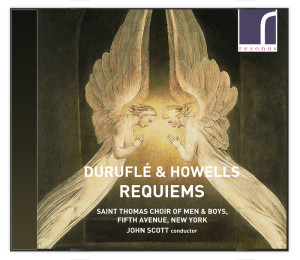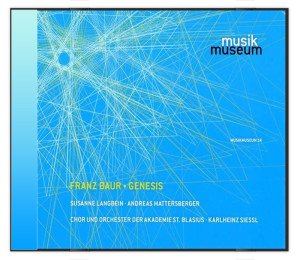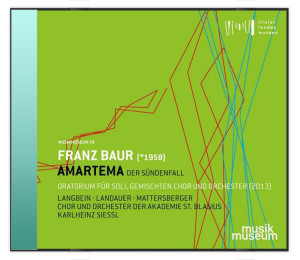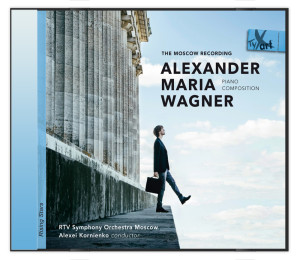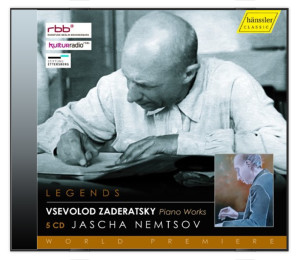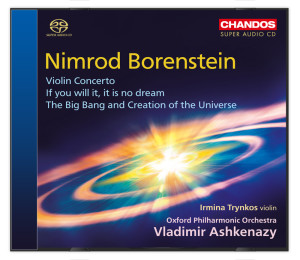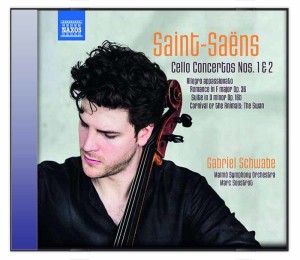Martin Scherber (1907-1974): Erste Symphonie – Goethelieder – Kinderlieder – 6 Lieder
Bratislava Symphony Orchestra, Adriano (conductor); Thomas Heyer, Tenor; Lars Jönsson und Hedayet Djeddikar (Klavier) Laura Cromm (Violine)
Sterling, CDS 1113-2
Wer sich heute bzw. während seines Lebens auf Bruckner oder Goethe oder gar Rudolf Steiner beruft, muss schon ein komischer Vogel oder Zeitgenosse sein: altmodisch, unmodern und ähnliche Schimpfworte dürften Martin Scherber (1907-74) zeitlebens begegnet sein. Allerdings war er ziemlich früh auf seinen eigensten Weg gelangt, eben auch mit Unterstützung der besagten drei Vorbilder und ihrer verschiedensten Anregungen. Als Komponist – ähnlich wie Jahrzehnte später der Schwede Anders Eliassohn – enthielt er sich der willentlichen Steuerung des Schöpfungsprozess, empfand er sich nur als Medium für das, was durch ihn Musik werden wollte, ein sehr ungewöhnlicher Standpunkt in einer Zeit des „Machens“ und all der gewalttätigen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts. Allein sein immer intensiverer Rückzug in sein eigentliches Innenleben – ohne sich dadurch sektiererisch abzukapseln – ermöglichte es ihm, sich ganz dem Werden der Musik zur Verfügung zu stellen. Seine drei Symphonie bezeichnete er nicht als „von“, sondern als „durch“ Martin Scherber entstanden! Tatsächlich sind diese drei jeweils einsätzigen, großdimentionierten Symphonien sein Lebenswerk, neben den auch andere Kompositionen wie Klavierstücke und auch Lieder überliefert sind, von denen eine gelungene Auswahl auf dieser CD zu hören und zu erleben ist – gesungen und gespielt vom Tenor Thomas Heyer und den Pianisten Lars Jönsson bzw. Hedayet Djeddikar sowie der Geigerin Laura Cromm. Und das sind keine Allerweltslieder, nein, musikalische Kostbarkeiten werden da hörbar, bei denen das Staunen und die Nichtselbstverständlichkeit in jedem Ton zu erleben sind. Das ist auch kein Wunder bei einem Komponisten, der die Eigenarten der deutschen Sprache in einigen musikalischen Werken in eine Form bringen wollte, die das Typische daran „zum Klingen“ bringt.
Seine Erste Symphonie ist – wie alle seine drei – einsätzig. Die Idee, dass eine ganze Symphonie – alle Bewegtheiten vom ersten Allegro über das Adagio und das Scherzo bis zum Finale – aus einer Grundidee, einem „Thema“ entstehen kann und soll, ist zwar schon älter, aber dennoch ein, besser d e r Ausgangspunkt für sogenannte „Metamorphosen-Symphonik“, die natürlich auch Bruckners Symphonien als Ausgangspunkt hat, aber – wie Christoph Schlüren im sehr ausführlichen Booklet ausführt – auch Verbindungen zu Sibelius oder auch zu Heinz Tiessen, einem ebenfalls vom heutigen Musikbetrieb völlig vernachlässigten Komponisten, nahelegt. Überhaupt ist es Schlürens Verdienst, Martin Scherber in schlüssig argumentierender Weise in Verbindung zu bringen mit seiner Zeit, seinen Zeitgenossen, der symphonischen Tradition und auch seinen Nachfahren. Das ist eben nur mit umfassender Kenntnis möglich und auch ein Verdienst dieser CD-Produktion. Die nur noch über den Freundeskreis von Scherbers Musik erhältliche Aufnahme der Zweiten Symphonie aus Russland ist mit Abstand am besten gelungen, während die Dritte unter Elmar Lampson (col legno) eine – ehrlich gesagt – nackte Katastrophe ist und dem Komponisten einen entsetzlichen Bärendienst erwiesen hat. Um so besser, dass nun diese Erste Symphonie-Einspielung aus Bratislava wieder etwas besser gelungen ist, man hat eben doch den Eindruck, dass da eine Musik ans Licht gelangt, deren Weite und Tiefe, deren Wirklichkeit erst noch zu entdecken und zu erleben ist.
Ganz anders seine Lieder, die mich sofort gefangen nehmen in ihrer Unmittelbarkeit und dem ureigenen Klang. Mich, der ich normalerweise dem klassischen Liedgesang sehr skeptisch gegenüberstehe – vor allem, wenn es um die Textunverständlichkeit der meisten klassischen Sänger und Sängerinnen geht. Allerdings ist im Fall von Thomas Heyer und seinen Begleitern da überhaupt keine Befremdung aufgekommen. Auch wenn der Tenor über alle Nuancen – auch des Dramatischen – verfügt, höre ich doch, wie sehr auch ihn diese Lieder dazu bringen, sich als „hohles Bambusrohr“ zu spüren, wie die für mich allerbeste Definition eines Künstlers heißt, nach dem Motto: „Sei wie ein hohles Bambusrohr, durch das der Wind geht.“
[Ulrich Hermann, November 2017]