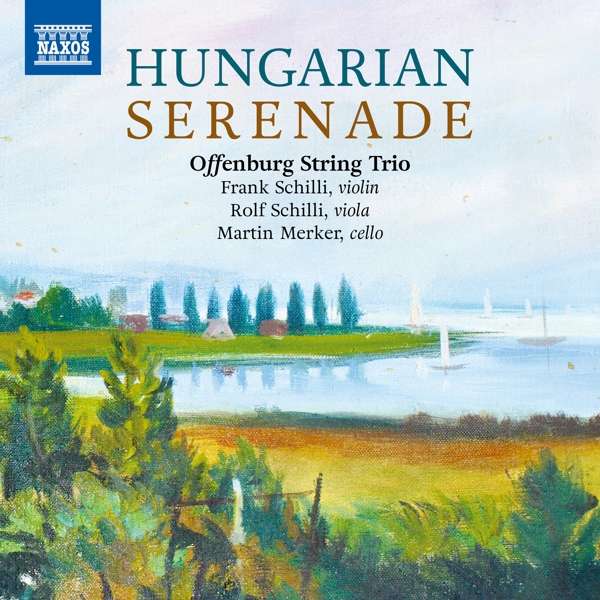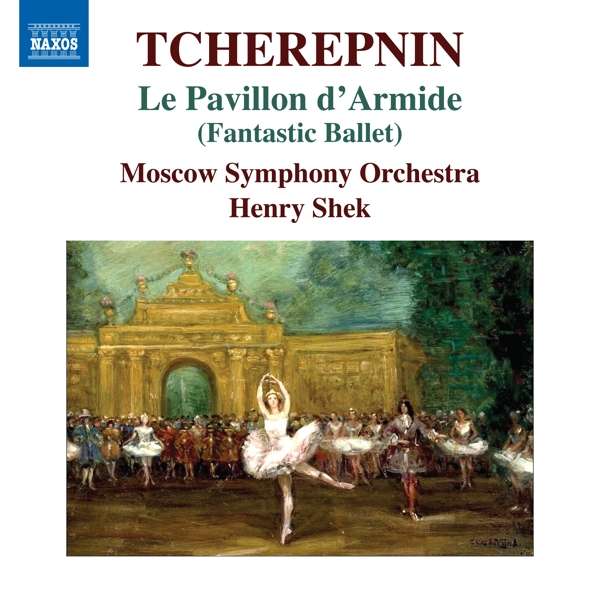Naxos 8.506039 (6 CD); EAN: 7 47313 60393 0

War die erste Gesamtaufnahme der 12 Symphonien von Heitor Villa-Lobos – wobei die Fünfte nach wie vor verschollen ist – auf cpo unter Carl St. Clair 2000 fertig eingespielt, hatte Naxos mit dem Spezialisten Isaac Karabtchevsky zwischen 2011 und 2017 auf 6 CDs nachgelegt, die nun endlich auch als preiswerte Box erhältlich sind. Eine immer noch ziemlich unterbelichtete, dazu hochbedeutende Nische in der Symphonik des 20. Jahrhunderts wird hier adäquat beleuchtet und der phantastische Zyklus ganz ausgezeichnet dargeboten.
Heitor Villa-Lobos (1887–1959) gilt immer noch unangefochten als der bedeutendste klassische Komponist Brasiliens. Der Grund dafür ist wohl weniger die Tatsache, dass er so an die tausend musikalische Werke schrieb, was im 20. Jahrhundert schon eher Seltenheitswert hat (der mit ihm befreundete Darius Milhaud wäre noch ein Kandidat mit ähnlich umfangreichem Schaffen). Vielmehr ist es die geglückte Verbindung von aus Europa überlieferten kompositorischen Standards und folkloristischem, teils indigenem Material, welches er anscheinend bereits in seiner Jugend zu sammeln begonnen hatte: Zwischen 1905 und 1913 bereiste er intensiv das Landesinnere, wobei Details dieser Exkursionen völlig im Dunkeln liegen und Villa-Lobos‘ eigene Aussagen darüber wenig glaubwürdig erscheinen. Neben seinem bedeutenden Klavierwerk – weit mehr als nur das Artur Rubinstein gewidmete Rudepoêma, mit dem der Pianist den Brasilianer in Europa bekannt machte, nun zunehmend auch diesseits des Atlantiks gespielt – und der keineswegs umfangreichen Gitarrenmusik, sind es vor allem einige der Bachianas Brasileiras – Stücke, mit denen der Bach-begeisterte Komponist neoklassizistische Elemente in seine ansonsten eher national ausgerichtete Musik integrierte –, die bei uns zum Repertoire gehören.
Dagegen ist sein Schaffen für groß besetztes Symphonieorchester – einige der Chôros, etwa Nr. 8, 9 und 11, vor allem jedoch die 12 Symphonien – immer noch weitgehend unbekannt. Tatsächlich darf man davon ausgehen, dass der größtenteils autodidaktisch gebildete Villa-Lobos in diesem traditionell formal recht festgezurrten Genre nicht sein Hauptinteresse sah. Trotzdem ist dieser Werkzyklus überwiegend von außerordentlicher Qualität: Die Symphonien Nr. 1–5, noch mit spätromantischen Einflüssen, aber bereits recht eigenständig und nationalistisch, entstanden noch vor 1920, danach gibt es eine Lücke von 24 Jahren. Ab Symphonie Nr. 6 wandelt sich deren Stil hörbar recht deutlich, wird konzentrierter; die Instrumentation ist weniger hypertroph, ohne an Farbigkeit zu verlieren – ein genialer Instrumentator war der Komponist ohnehin. Die großformatige, über 60-minütige Symphonie Nr. 10 Ameríndia sticht schon ein wenig heraus, da im Untertitel von Villa-Lobos selbst als Oratorium bezeichnet: das einzige Werk mit zusätzlichen Vokalkräften. Die anderen Symphonien folgen sämtlich der klassischen Viersätzigkeit.
Die Symphonien Nr. 3–5 waren als Triptychon geplant: Ihre Titel lauten A Guerra (Krieg), A Vitória (Sieg) und A Paz (Frieden). Die Partitur der Fünften ist leider verschollen, und obwohl das Material bis in die späten 1960er in Katalogen des Ricordi-Verlags angeboten wurde, allerdings Bestellversuche immer ins Leere liefen, geht die Meinung der Musikwissenschaft mittlerweile doch in die Richtung, dass das ambitionierte Werk – über das Villa-Lobos in Interviews mehrmals berichtete – wohl nie so geschrieben wurde, oder sogar Ideen bzw. Teile davon Eingang in die 10. Symphonie gefunden haben könnten.
Die „Gesamtaufnahme“ auf cpo von 1997–2000 mit dem RSO Stuttgart unter dem texanischen Dirigenten Carl St. Clair war jedenfalls ein Meilenstein, dürfte sie doch für die meisten der Villa-Lobos-Symphonien nicht nur als Ersteinspielung gelten, sondern häufig auch die erst zweite Aufführung überhaupt darstellen. Die Einzel-CDs der Produktion sind längst vergriffen, aber als Box ist diese nach wie vor erhältlich. Im Gegensatz zu St. Clair ist der brasilianische Dirigent Isaac Karabtchevsky (Jahrgang 1934) natürlich ein „alter Hase“, was die Musik Villa-Lobos‘ betrifft. Er studierte in Deutschland u.a. bei Wolfgang Fortner und Pierre Boulez, war etwa langjähriger Chef beim Orquestra Sinfônica Brasileira in Rio de Janeiro und hat für die Neuaufnahme des Symphonienzyklus bei Naxos das Orchestermaterial nochmals gründlich revidiert. Mit dem Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) konnte das derzeit wohl beste Orchester des Landes gewonnen werden, das die elf vorhandenen Symphonien zwischen 2011 und 2017 eingespielt hat. Seit Ende 2020 sind auch diese 6 CDs als preisgünstige Box zu erwerben, wodurch der Rezensent sich nochmals beide Versionen dieser selten dargebotenen Stücke anhören mochte.
Die international hochbeachtete Neuproduktion wird in fast allen Besprechungen über die Maßen gelobt – die Stuttgarter Aufnahme hat aber durchaus auch ihre Meriten. Was die Durchsichtigkeit des Orchesterklanges angeht, sind die Stuttgarter dem Orchester aus São Paulo tatsächlich sogar überlegen. Dass man hier – gerade in den ersten vier Symphonien – mehr Details hören kann, liegt sicher nicht nur an der vorzüglichen Aufnahmetechnik von cpo und SWR, sondern erscheint sozusagen als Hauptanliegen des Dirigenten Carl St. Clair – verständlich bei absolutem Neuland für ihn wie das Orchester. Die somit hervorragend gelungene Balance innerhalb des Orchesters ist aber allein noch keineswegs Garant für eine global differenzierte Dynamik eines Satzes oder einer ganzen Symphonie. Schon hier zeigt sich, was den Stuttgartern fehlt: die Übersicht. St. Clair hangelt sich doch über weite Strecken am Notentext entlang, seine lokale Erbsenzählerei und die präzise Klangabstufung in der momentanen Vertikale kann nicht verdecken, dass ihm die oft ungewöhnliche Architektur des brasilianischen Komponisten (Rondo-Elemente bereits in den Kopfsätzen usw.) fremd bleibt, sich der große Zusammenhang kaum erschließt, geschweige denn musikalisch vorausgedacht, geplant werden kann. Und obwohl es natürlich auch gewaltige Klangmassierungen bei Villa-Lobos gibt, – namentlich in der 3. u. 4. Symphonie, wo nicht nur die brasilianische Nationalhymne, sondern dazu noch Fragmente der Marseillaise intoniert werden – verliert sich der Texaner dann allzu leicht in diesen Effekten. Karabtchevsky setzt hier die Instrumentation ganz punktuell wirkungsvoll ein (große Trommel!), ohne die Struktur zu übertünchen; so bleibt Spannung stets erhalten und die Musik verkommt nie zur reinen Klangorgie.
Zum Feinsten in Villa-Lobos‘ Symphonik gehören zweifellos die langsamen Sätze. Sie beinhalten nicht nur tief empfundene, dabei keineswegs kitschige Melodik, sehr persönliches südamerikanisches Klangkolorit, sondern sind darüber hinaus architektonisch absolut überzeugend. Im Gegensatz zu den meist sehr knapp gehaltenen Kopfsätzen mit ihren oft für den europäischen Geschmack etwas abrupten Schlüssen haben die Binnensätze (auch die Scherzi) einen klaren Aufbau, benötigen dafür aber immer einen langen Atem; Steigerungen müssen wohl dosiert werden, um wahrhaftig zu wirken. Hier zeigt sich ganz deutlich die musikalische Überlegenheit Karabtchevskys, dem dies alles wunderbar gelingt: der große Bogen und echter Schmerz in den langsamen Sätzen, die oft eruptive Rhythmik der Scherzi, obwohl gerade diese noch am ehesten an traditionellen europäischen Vorbildern (Beethoven!) gereift scheinen, zumindest in den späten Symphonien. St. Clair mit seinen teilweise zu breiten Tempi droht hier, den Zusammenhang aus den Augen zu verlieren, die elegischeren Abschnitte in Einzelereignisse zerfallen zu lassen. Höhepunkte erscheinen dadurch bedingt recht aufgesetzt. Bei der 10. Symphonie benötigt er fast 13 Minuten länger als Karabtchevsky, was die recht komplizierten Chorabschnitte ganz unorganisch überdehnt – dies wirkt dann nur noch zäh.
Schließlich kann das Klangbild der Aufnahme aus São Paulo durchaus gefallen: Das räumliche Panorama ist gewaltig, dabei aber keineswegs matschig, sondern kraftvoll differenziert. Die Chöre in der Ameríndia-Symphonie klingen stets natürlich. Lediglich die männlichen Solisten haben offensichtlich bei beiden Aufnahmen Probleme mit den häufigen Wechseln zwischen Text und Vokalise bzw. Melisma, singen stellenweise unbeholfen grobschlächtig. Auch Karabtchevsky kann zwar aus den noch teils unausgegorenen Gehversuchen Villa-Lobos‘ in den beiden ersten Symphonien keine Meisterwerke machen – dafür wird die echte Meisterschaft ab der Sechsten trotz aller auf den Hörer neuartigen Eindrücke überdeutlich: Diese Musik hätte, derart sensibel gespielt, eigentlich das Zeug, auch die europäischen Konzertsäle zu erobern. Die 10. Symphonie mit ihrem ohnehin ganz eigenen Reiz kann es an Pracht mit anderen großen Vokalsymphonien ebenfalls aufnehmen. Zudem sind die als Ballett bekannt gewordene, hochenergetische symphonische Dichtung Uirapuru – ganz typisch für den frühen, „wilden“ Villa-Lobos – sowie die Kantate Mandu-Çarará mit wirkungsvollem Kinderchor und überbordender rhythmischer Intensität (anscheinend erstmals auf CD) willkommene Zugaben. Wer die Stuttgarter Einspielung bereits hat, kann mit der Naxos-Box sehr günstig ein „Update“ erwerben, das eine erneute Auseinandersetzung mit den Villa-Lobos-Symphonien mehr als rechtfertigt. Für Neulinge ist Karabtchevskys Darbietung klar die erste Wahl.
Vergleichsaufnahme: Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Carl St. Clair (1997-2000, cpo 777 516-2, 7CD)
[Martin Blaumeiser, April 2021]