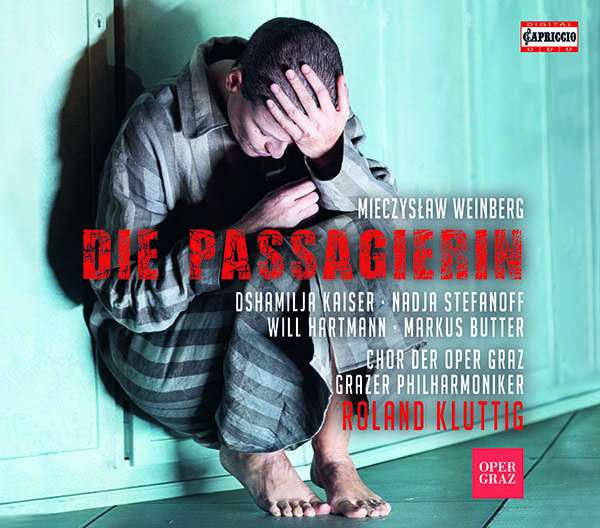Drei Ersteinspielungen würdigen die fast vergessenen Komponisten Leo Blech und Hans Sommer
Leo Blech: „Alpenkönig und Menschenfeind“, 2 CD’s
Capriccio; Bestellnr.: C5478, EAN: 845221054780
Leo Blech: „Complete Orchestral Works“
Capriccio, Bestellnr.: C5481, EAN: 845221054810

Das Theater Aachen feiert im kommenden Jahr den 200. Geburtstag und arbeitet seine Vergangenheit schon im Vorfeld auf. Dafür stehen zwei Meldungen: 2023 wird die Büste von Herbert von Karajan wegen seiner Nähe zum nationalsozialistischen Regime aus dem Foyer entfernt. Ein Jahr früher erhält Leo Blech die Ehrenmitgliedschaft, die ihm 1937 aufgrund seiner jüdischen Herkunft entzogen wurde, posthum wieder zurück. Beide Dirigenten begannen von Aachen aus ihre Karriere. Doch während Karajan ohne Unterbrechung zum Pultstar mit Kultstatus aufstieg, wurde der 1871 in der Domstadt geborene Blech, der als Chefdirigent der Staatsoper seit 1913 im Berliner Musikleben eine führende Rolle spielte, 1937 zwangspensioniert. Nach Jahren im Exil kehrte er 1949 in gleicher Position an sein altes Haus zurück, doch nach seinem Tod 1958 wurde er vergessen. Erst 2015 erinnerte der Verlag Hentrich & Hentrich im Rahmen der Reihe Jüdische Miniaturen an den Musiker, der sich neben seiner Dirigententätigkeit auch als Opernkomponist hervortat. Zunächst in Aachen mit zwei tragischen Einaktern, dann in Dresden mit der volkstümlichen Idylle Das war ich!, mit der ihm der Durchbruch gelang. Deren Erfolg wurde 1903 noch übertroffen von der ebenda uraufgeführten Oper Alpenkönig und Menschenfeind nach Ferdinand Raimunds Wiener Zauberspiel. Sie steht in der Tradition der spätromantischen Märchenopern und der Nachfolge von Blechs Lehrer Engelbert Humperdinck. Die Handlung: der seine Familie tyrannisierende Rappelkopf wird von einem guten Geist mittels eines Zaubertricks – er nimmt die Identität des Griesgrams an, der wiederum in Gestalt des guten Onkels erleben muss, wie unerträglich er sich allen gegenüber verhält, – auf den rechten Weg geführt. Das Stück bietet musikalische Abwechslung: volkstümliche Melodien treffen auf Wagnerreminiszenzen, sinfonische Tonmalereien – etwa der Sonnenuntergang oder das Alpenglühen –, auf eine Genreszene mit Tanz und Blasmusik, und auch ein operettenhaftes Couplet ist dabei. Das Stadttheater Aachen hat Alpenkönig und Menschenfeind anlässlich von Leo Blechs 150. Geburtstag wieder zur Aufführung gebracht und in fast gleicher Besetzung auf CD verewigt. Das Ensemble bewegt sich sicher zwischen spielopernhafter Natürlichkeit und charaktervoller Gesangskultur. Genannt seien stellvertretend Sonja Gornik und Anne-Aurore Cochet, deren Stimmen sich im eröffnenden lyrischen Frauenduett homogen verbinden und die Baritone Ronan Collett und Hrólfur Saemundsson, die der zentralen Schwurszene zwischen Alpenkönig und Menschenfeind dramatische Konturen geben. Auf den Spuren seines historischen Vorgängers schwelgt GMD Christopher Ward mit dem Sinfonieorchester Aachen in den illustrativen Naturschilderungen, zaubert Stimmungen und subtile Klangfarben. Ergänzt wird die Gesamtaufnahme durch eine CD mit Blechs kompletten Orchesterwerken aus seiner Frühphase. Ward dirigiert die sinfonischen Dichtungen, die ihren Namen Waldwanderung, Trost in der Natur und Die Nonne alle Ehre machen, mit gleicher Kompetenz und Leidenschaft wie die Oper. Abgerundet wird diese Einspielung durch zwei Chöre, Sechs Kinderlieder und das Solo Wie ist doch die Erde so schön in der unerwartet konservativen Instrumentation von Bernd Alois Zimmermann.

Hans Sommer: „Orchestral Songs“
Pentatone, 1 CD, Bestellnr.: 5187 023, EAN: 8717306260237

Zu den deutschen Tonschöpfern, die lange von der Fachwelt vernachlässigt wurden, zählt auch Hans Sommer (1837–1922). Er begann seine berufliche Laufbahn als Mathematikprofessor und schuf seine erste Komposition als bereits anerkannter Wissenschaftler. Daneben engagierte er sich für die Rechte von Künstlern und trat als Mitbegründer GEMA für den Urheberschutz ein. Sommers Oeuvre umfasst vorwiegend Vokalmusik, darunter 10 Opern, von denen nur Rübezahl und der Sackpfeifer von Neiße in modernen Zeiten aufgeführt wurde. Zu seinen wichtigen Werken gehören Orchesterlieder, vergleichbar mit denen seines jüngeren Vorbilds Richard Strauss, der Sommer schätzte und förderte. Etliche von ihnen gibt es mittlerweile in verschiedenen Einspielungen. Das Label Pentatone aber hat eine Auswahl vorwiegend mit CD-Premieren veröffentlicht, die alle Schaffensperioden umfasst. Sie sind stilistisch in der Spätromantik verwurzelt und natürlich auch von Wagner beeinflusst. Ihre Qualitäten bringt ein kundiges, mit Liedgesang vertrautes Vokalquartett ans Licht. Der Tenor Mauro Peter trägt die Heine-Vertonung Nachts in der Kajüte mit Emphase vor, Innigkeit verströmt Sopranistin Mojca Erdmann in den volkstümlichen Weisen aus der Oper Lorelei. Vokale Variabilität und beste Diktion offenbaren der Mezzo Anke Vondung und der Bariton Benjamin Appl in den Stücken auf Goethe-Gedichte. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Leitung von Guillermo Carcia Calvo steuert die exquisite Instrumentalbegleitung bei. Die gelungene CD endet kammermusikalisch intim. Im Zyklus Hunold Singuf für Klarinettenquintett versieht Appl die ersten drei Strophenlieder mit vielen Nuancen, bevor alle zusammen das Trinkchanson Istud Vinum zum fröhlichen Rausschmiss anstimmen.
[Karin Coper, Juli 2024]