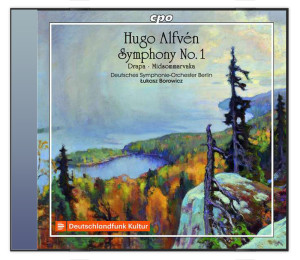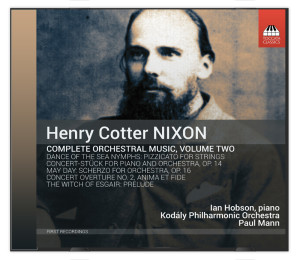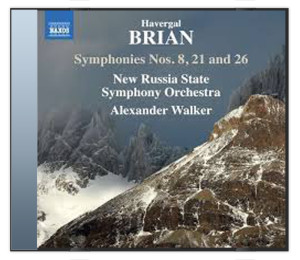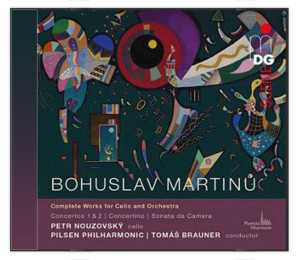Der schweizerische Geiger Sebastian Bohren ist schon lange mit Pēteris Vasks Fantasie für Violine und Streichorchester „Vox Amoris“ vertraut. Als er sie nun mit den Chaarts Chamber Artists einspielte, dachte er noch gar nicht an ein großes Medienecho. Der visionären Kraft dieser Stücke, ihrer melodischen Direktheit und Bildkraft kann sich kaum jemand – egal ob Hörer oder Interpret – entziehen. Also wuchs auch Sebastian Bohrens Unterfangen zu einem größeren Projekt. Mit den Chaarts Chamber Artists wurde „Vox Amoris“, (2009) eingespielt – für eine Neuaufnahme des viel gefragten Violinkonzertes „Distant Light“ (1997) konnte das Georgische Kammerorchester Ingolstadt gewonnen werden. Gija Kanchelis „Chiaroscuro“ komplettiert die Neuaufnahme zu einem bemerkenswerten Dreiklang. Dass Sony diese drei Stücke nur als Download veröffentlichte, sehen sowohl der Komponist als auch der Interpret nicht als Einschränkung.
Stefan Pieper hat bei Komponist und Interpret nachgefragt.
Stefan Pieper: Sind Sie glücklich damit, dass Sony Music Ihr neues Release nur als Download veröffentlicht?
Sebastian Bohren: Ja, das war sogar meine Initiative. Die Grundidee war, diese Musik speziell für Streaming Portale anzubieten. Es gibt ja bereits CD-Veröffentlichungen, unter anderem auch eine auf ECM mit Gidon Kremer. Aber nichts davon war bislang als Download verfügbar. Deswegen schließt meine Live-Einspielung hier eine echte Lücke. Und obwohl es das neue Release nicht als physische CD gibt, habe ich auch die optische Gestaltung nicht dem Zufall überlassen. Ich habe viel Zeit investiert, damit der Gesamtauftritt sehr hochwertig daher kommt. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen.
Pēteris Vasks: Ich bin im Internet auf die neuen Liveaufnahmen mit Sebastian Bohren gestoßen. Es ist schön, dass man diese Musik jetzt auch in den elektronischen Medien entdecken und hören kann. Mir gefällt seine Interpretation von Vox Amoris sehr gut, ebenso wie er Distant Light interpretiert. Sein Spiel transportiert eine Botschaft, und darum sollte es in diesen Kompositionen ja gehen.
Stefan Pieper: Können Sie schon etwas über die Resonanz sagen?
Sebastian Bohren: Ich hatte befürchtet, dass eine rein digitale Veröffentlichung bei den Rezensenten nicht gut ankommt, die es nach wie vor kritisch sehen, wenn etwas nur online ist. Aber dann hat sich alles sehr positiv entwickelt. Es gab eine ausgesprochen gute Resonanz von Petris Vasks.
Stefan Pieper: Herr Vasks, was macht Sebastian Bohren anders als Gidon Kremer?
Pēteris Vasks: Bei Sebastian Bohren klingt vieles weicher und inniger, während Gidon Kremer eher auf die tragischen, dramatischen Gesten setzt. Für mich ist es immer interessant zu hören, wenn ein Interpret etwas findet, was für mich eine positive Überraschung ist. Ich komponiere die Noten, aber die Musik beginnt erst durch die Interpretation zu leben. Wenn Sebastian Bohren diese Musik zum Leben erweckt, vor allem, wenn er Vox Amoris spielt, habe ich das Gefühl, dass diese Musik speziell für ihn komponiert worden ist. Er ist sehr jung und voll mit Liebe und Idealismus. Das hört man einfach hier heraus.
Stefan Pieper: Herr Bohren, was für einen persönlichen Bezug haben Sie zu dieser Musik?
Sebastian Bohren: Der Anfang meiner solistischen Karriere war immerhin mit dem Stück Vox Amoris – und ich erhielt immer gute Rückmeldungen, wenn ich es gespielt habe. Das Stück haben auch bereits viele andere Geiger ins Repertoire aufgenommen!
Stefan Pieper: Obwohl das ja eigentlich kein Standardrepertoire ist?
Sebastian Bohren: Also für mich persönlich schon! Ich habe mich immer schon für diese Musik interessiert und wollte sie spielen. Distant Light habe ich dann etwas später gelernt.
Stefan Pieper: Was verbindet diese Stücke miteinander? Was sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
Sebastian Bohren: Distant Light ist wie ein ausgewachsenes Violinkonzert. Es hat längere Kadenzen und ist geigerisch sehr virtuos. Es transportiert eine ganz andere Grundstimmung als Vox Amoris: Es ist dunkler – und das hoffnungsvolle Licht ist immer nur weit entfernt wahrnehmbar. Vox Amoris ist dagegen ein einziger großer Liebesgesang.
Pēteris Vasks: Vox Amoris und Distant Light unterscheiden sich von ihrer Stimmung und Dramatik voneinander. Das Violinkonzert ist das dramatischere Stück von beiden. Da ist die Stimmungsamplitude größer und tragischer. Auch ein fabelhafter Interpret wie Sebastian Bohren kann seine Deutung dieser Werke noch ausbauen. Er kann die Dramatik noch weiter entwickeln. Aber ich bin jetzt schon sehr begeistert von seinem Spiel und freue mich sehr über diese Aufführungen!
Stefan Pieper: Trotzdem ist auch Distant Light sehr weit weg von einem üblichen Violinkonzert mit dieser typischen Dialogstruktur zwischen Soloinstrument und Orchester. Alles ist viel konzentrischer um die Violine zentriert und die Geige ist gewissermaßen das emotionale Epizentrum. Wie sehen Sie das?
Sebastian Bohren: Pēteris Vasks drückt sich kompositorisch in seiner ganz eigenen, sehr direkten Sprache aus. Aber man verkennt diese Musik immens, wenn man diese bewusste Einfachheit mit Einfältigkeit gleichsetzt. Mir sagte einmal ein Kenner von moderner Musik, er könne mich nur bemitleiden, da wäre doch erst nach mehreren hundert Takten das erste Vorzeichen drin. Diese Musik aber als Kitsch anzusehen, ist ein großes Missverständnis! Vasks hat eine evidente Fähigkeit für das Melodische, Expressive. Man muss diese Musik in dem Kontext verstehen, aus dem sie kommt. Niemals geht es darum, sich hier als Spieler in Szene zu setzen. Stattdessen soll man die Musik bescheiden spielen, mit möglichst viel Authentizität!
Pēteris Vasks: Distant Light ist im Kern ein Konzert, auch wenn es schon mannigfaltige Verwendung fand, etwa für Choreografien im Tanztheater. Bei Vox Amoris sehe ich nicht so sehr eine typische Konzertform. Ich bin frei. Ich denke eigentlich gar nicht darüber nach, welche Form habe ich hier erfüllt und welche nicht. Es ist doch eigentlich gar nicht von Belang, etwa nachzuzählen, wie viele Kadenzen es hier in einem Stück und wie viele im anderen gibt. Ehrlich gesagt – ich weiß einfach nicht, warum hinterher die eine oder die andere Form herauskommt. Ich kann es nicht erklären und lege auch keinen Wert darauf. Wenn ich in einer Arbeitsphase bin, dann strömt die Musik einfach wie ein Fluss, den ich natürlich kontrolliere. Trotzdem. Ich mache mir doch nicht zu aller erst über eine Form Gedanken. Ich habe mich teilweise mit Gidon Kremer auseinandergesetzt, der mir verschiedene Möglichkeiten aufzeigte. Das hat mich weiter ermutigt, mehr für die Violine zu komponieren. Ansonsten ist das Cello mein absolutes Lieblingsinstrument. Ich habe jetzt zwei Cellokonzerte, ebenso Bratschenkonzerte und auch Solostücke für Kontrabass komponiert, den ich selber spiele.
Stefan Pieper: Mit was für Herausforderungen ist der Solist in diesen Stücken konfrontiert?
Sebastian Bohren: Vor allem muss man eine technische Affinität zu diesen melodischen Elementen haben und einen weiten Bogen spannen können. Das sind Grundvoraussetzungen. Es muss irgendwie aus dem Inneren empfunden sein. Es braucht eine Form der Reinheit. Es geht darum, von Anfang an vernünftige Entscheidungen zu treffen – vor allem, was das Timing anbelangt! Man muss intuitiv erfassen, welche Tonart Hoffnung oder Verzweiflung bedeutet. Vor allem das muss zum Ausdruck kommen! Man muss hier eine Vielzahl von verschiedenen Farben auf der Geige erzeugen. Es geht um das Verhältnis von viel und wenig Druck, von viel und wenig Vibrato auf der Geige.
Stefan Pieper: Wie ist es um die Interaktion mit dem Orchester bestellt?
Sebastian Bohren: Bei Distant Light ist es eine etwas größere organisatorische Herausforderung als bei Vox Amoris. Der Solist muss gut Bescheid wissen, wann spielt er mit wem. Dies funktioniert meiner Meinung nach ohne Dirigent am besten. Ich denke, man muss einen Zustand erreichen, wo sich alle gemeinsam drauf einlassen. Man braucht ausreichend Probezeit, außerdem müssen alle Beteiligten die richtige Sensibilität haben und sich mit dem Stück identifizieren.
Stefan Pieper: Können Sie Ihre grundsätzlichen musikalischen Ideale formulieren?
Pēteris Vasks: Die Musik muss vor allem singen. Mir sind in meinen Kompositionen starke Gesangslinien wichtig, die etwas erzählen. Hinter allem, was ich komponiere, soll eine Botschaft stehen. Ich liebe unsere fantastisch schöne Welt, aber ich bin auch oft sehr traurig über die Gegenwart. Dieser ganze, die Welt immer mehr beherrschende Materialismus ist nicht gut.
Stefan Pieper: Was kann Musik dagegen tun?
Pēteris Vasks: Musik hat zuallererst eine emotionale Komponente und natürlich auch eine intellektuelle. Ich denke an mein Publikum. Auch darin gehe ich einen konsequenten Weg. Es ist unser aller gemeinsames Projekt, durch die Musik die Welt etwas besser zu machen. Das birgt die idealistische Hoffnung, dass Dinge vielleicht wieder etwas besser ins Gleichgewicht zueinander kommen.