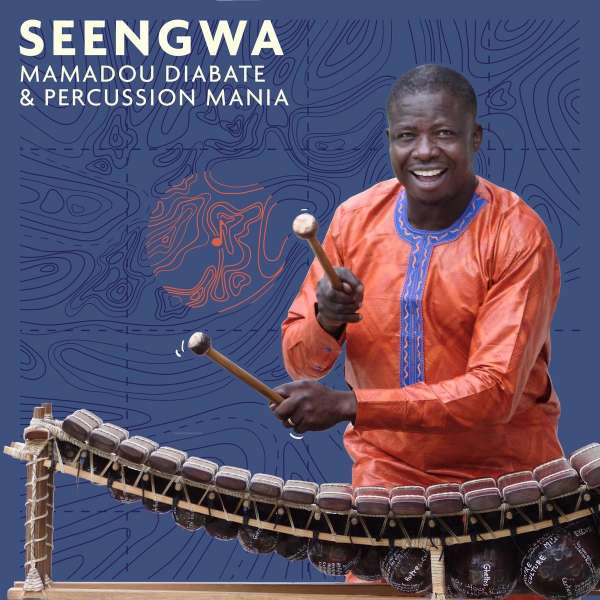Interview mit dem Pianisten Mathias Weber, dem künstlerischen Leiter des Hamburger Érard Festivals
Von 23. 10. bis 30. 10 findet in Hamburgs Laeiszhalle das 6. Érard-Festival statt. Die aktuelle Festivalausgabe ehrt den frankobelgischen Komponisten César Franck anlässlich seines 200. Geburtstags. Dafür konnte die Érard-Gesellschaft jenen orginalen Érard-Flügel nach Hamburg holen, auf dem Franck viele seiner Werke komponiert hat – unter anderem auch sein f-Moll Klavierquintett, das in Hamburg in gleich zwei Fassungen zur Aufführung kommt. Das in Hamburg stattfindende deutsch-französische Érard-Festival, veranstaltet von der durch Stephanie Weber ins Leben gerufene Érard-Gesellschaft, ist die wohl bedeutendste Institution im deutschsprachigen Raum, die das Kulturgut dieser legendären französischen Flügel lebendig hält. Mathias Weber, Pianist und künstlerischer Leiter des Festivals schöpft aus dem linearen und feinen Klangcharakter dieser Instrumente immer wieder neues künstlerisches Potenzial für kammermusikalische Begegnungen.
The New Listener: Warum haben Sie César Franck ins Zentrum des Érard Festivals gesetzt?
Mathias Weber: Das ist vor allem dem glücklichen Umstand geschuldet, dass wir den Original-Flügel von César Franck zur Verfügung gestellt bekamen. Mehr noch: Auf diesem Érard-Flügel hat César Franck sein f-Moll Klavierquintett, welches in der Laeiszhalle zur Aufführung kommen wird, komponiert. Und auch Franz Liszt, dessen Klavierkonzert Nr. 2 unter anderem auf dem Programm steht, ist ja „der“ Érard-Künstler schlechthin. Beide Komponisten sind durch den Klang dieses Instruments originär beeinflusst worden.
Bei den ersten beiden Konzerten steht César Francks Klavierquintett f-Moll gleich zweimal auf dem Programm – einmal im Original zusammen mit dem Schumann Quartett und danach im viel größer besetztem Format mit dem Oldenburgischen Staatsorchester.
Genau. Dem Original steht eine von mir kreierte Orchesterversion gegenüber. Mich interessierte hier das Spiel mit den Rollenverteilungen. Durchaus wird in der Orchesterversion dem Klavier einiges „weggenommen“ und an ein ganzes Orchester weitergegeben. Deswegen ist diese neue Fassung von mir kein Klavierkonzert im üblichen Sinne. Das Klavier agiert eher wie ein obligates Soloinstrument. Ich habe das Stück so bearbeitet, dass es eben nicht genuin klaviermäßig ist, sondern stattdessen mehr Gleichberechtigung entsteht. Das kommt auch äußerlich dadurch zum Ausdruck, dass der Dirigent bei dieser Aufführung vor dem Klavier steht.
Wie sind Sie vorgegangen bei dieser Neufassung?
Nach einer meiner Aufführungen des Franck-Quintetts kommentierte ein Musikerkollege: Das klingt ja wie ein Orchester, was mich dazu brachte, das Quintett zunächst für ein solches zu bearbeiten. Aber dadurch fehlte wieder etwas. Vor allem wurde mir klar, dass das rein figurative Element des Klaviersatzes nur im Orchester allein nicht darstellbar ist. Also habe ich das Quintett von Franck zu einer „Sinfonie für Orchester und Klavier“ weiterentwickelt.
Welche Rolle spielt Franz Liszt im Programm?
Mit Franz Liszts Klavierkonzert A-Dur und der sinfonischen Dichtung Les Préludes wollen wir auf die Verwandtschaft César Francks mit Franz Liszt anspielen.
Welche Aspekte standen für César Franck im Vordergrund, wenn er sich an Franz Liszt orientierte?
Der Klavierpart bei César Franck ist ja auffallend beweglich, so dass hier eine Inspiration durch Franz Liszt nahe liegt. Aber trotz solcher Einflüsse hat César Franck etwas ganz eigenständiges daraus gemacht. Durch die fantasievolle Verwendung eines Grundgedankens konnte sowohl bei Liszt als auch bei Franck eine monumentale Großform entstehen.
Am 30. Oktober spielen Sie zusammen mit dem Ensemble Acht – auf dem Programm stehen zwei Septette von Ludwig van Beethoven und Nepomuk Hummel. Worauf können wir uns hier freuen?
Hummels Septett d-Moll op. 74 ist von Franz Liszt herausgegeben worden und man kann es zu den bedeutendsten Stücken der Kammermusik nach Beethoven rechnen. Es ist ein sehr dramatisches, viersätziges Stück. Man könnte den Charakter dieser Musik als „janusköpfig“ oder doppelbödig bezeichnen. Formal ist es eigentlich ein Klavierkonzert und trotzdem zugleich ein Kammermusik-Stück. Die Besetzung „sechs Instrumente plus Klavier“ geht ja schon ins Orchestrale. Daher ist der Klaviersatz auch sehr konzertmäßig. Aber trotzdem ist es kein Klavierkonzert, da die anderen Instrumente thematisch viel zu sagen haben. Vom Ausdruckscharakter her steht diese Musik auf einer Schwelle zwischen den Zeiten. Ich sehe hier eine Symbiose von Mozart´scher Leichtigkeit und dämonischer Romantik. Durchaus stand hier auch E. T. A. Hoffmann Pate. Zugleich bezieht sich die Komposition in ihrem dritten Satz auf Beethovens vierten Satz seines Es-Dur Septetts. Hier einen Vergleich zu ziehen, ist doppelt lehrreich: Beethoven bleibt in seiner Komposition in der Form drin, wo Hummel sie stärker aufbricht – allein das macht die Gegenüberstellung dieser beiden Werke in einem Konzert zu einem spannenden Stück musikalischer Zeitgeschichte.
Welchen Austausch gab es zwischen Beethoven und Hummel?
Hummel war ein Freund von Beethoven und die beiden haben sich sehr geschätzt. Angeblich hat sich Beethoven auch für Hummels Frau interessiert. Das fand Hummel aber nicht so nett und wollte deswegen nicht auf Beethovens Beerdigung spielen. Aber Hummels Frau hat trotzdem darauf bestanden, dass er es tue.
Was macht Ihre persönliche Faszination für die Flügel aus dem Hause Érard aus?
Meine Leidenschaft für den Érard-Flügel resultiert aus einer gewissen Verrücktheit. Aber ich habe hier den perfekten Klang für mich gefunden.
Gab es dafür ein Erweckungserlebnis?
Ja, es war wie eine Offenbarung, als ich zum ersten Mal diesen Klang gehört habe. Ich bin in einem Klaviergeschäft eher zufällig darauf gestoßen. Ich wusste schon, dass die Érard-Flügel interessant sind. Auch Richard Wagner hatte so einen und deswegen dürften sie wohl nicht ganz so schlecht sein. Als ich nun in diesem Klaviergeschäft war, habe ich einen Érard aus dem Jahr 1858 zum ersten Mal bewusst gehört. Der war noch nicht mal richtig restauriert. Aber ich habe ihn gespielt und gedacht, das ist es! Ich habe noch diverse andere Instrumente demonstriert bekommen, aber bin immer wieder zum Érard zurück gegangen.
Man sagt, dass Érard-Flügel durch die Technik der „doppelten Repetition“ die ersten modernen Flügel sind. Was macht dieses Prinzip aus?
Man konnte dadurch einfach viel schneller spielen. Der entscheidende Unterschied ist, dass der Hammer nicht mehr komplett zurückfällt, sondern auf halber Strecke gehalten wird. Die ganze moderne Spielweise, die sich seit Liszt und Mendelssohn etabliert hat, wäre ohne die doppelte Repetition nicht denkbar. Auch jeder moderne Flügel hat sie heute noch.
Wo hingegen zeigt sich die Überlegenheit des Érard-Flügels?
Steinway hat als erster Klavierbauer die tiefen Saiten überkreuz gespannt, womit er eine Revolution vollzogen hat. Das führte zu deutlich mehr Wucht in den Bässen. Der Reiz des Érard besteht darin, dass hier die Saiten weiterhin linear, also überall nebeneinander gespannt sind. Dadurch klingt der Érard viel klarer und genau diese Klarheit und Linearität macht meine künstlerische Faszination für dieses Instrument aus. Mit einem „Kreuzsaiter“ kann man polyphone Bass-Führungen längst nicht so differenziert abbilden. Alles ist immer eine Frage des Standpunktes. Rachmaninoff wird auf einem modernen Konzertflügel immer eine viel mächtigere Wirkung entfalten als auf einem Érard. Aber Ravel klingt wiederum auf einem Érard umso faszinierender.
[Das Interview führte Stefan Pieper]