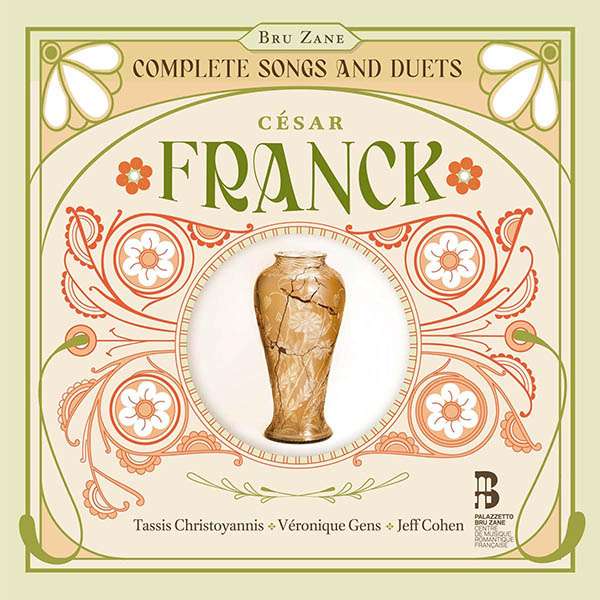Im Rahmen der Brucknertage dirigierte Rémy Ballot in der Basilika des Stiftes St. Florian das Altomonte-Orchester und die St. Florianer Chorakademie in Aufführungen des 146. Psalms und der Symphonie d-Moll, der „Annullierten“. Das Ballot-Quartett und Martin Nöbauer, Klavier, spielten auf Schloss Tillysburg Bruckners Streichquartett, das Streichquartett Nr. 3 von Augustinus Franz Kropfreiter und das Klavierquintett von César Franck. Die Aufführung der Ersten Symphonie Bruckners von den Brucknertagen 2022 ist bei Gramola auf CD erschienen.

Viel Gutes gibt es aus St. Florian von den diesjährigen Brucknertagen zu berichten. Da wäre zunächst die Meldung, dass eine weitere Folge von Rémy Ballots Bruckner-Zyklus auf CD herausgekommen ist: Mit der Aufführung der Ersten Symphonie durch das Altomonte-Orchester St. Florian, von der auf diesen Seiten vor einem Jahr berichtet wurde, liegen nun bei Gramola alle nummerierten Symphonien Bruckners unter Ballots Leitung vor. Zwar gibt Gramola als offizielles Veröffentlichungsdatum den 13. Oktober 2023 an, doch kann man die Neuerscheinung bereits im St. Florianer Stiftsladen erwerben:
Gramola 99283; EAN: 9 003643
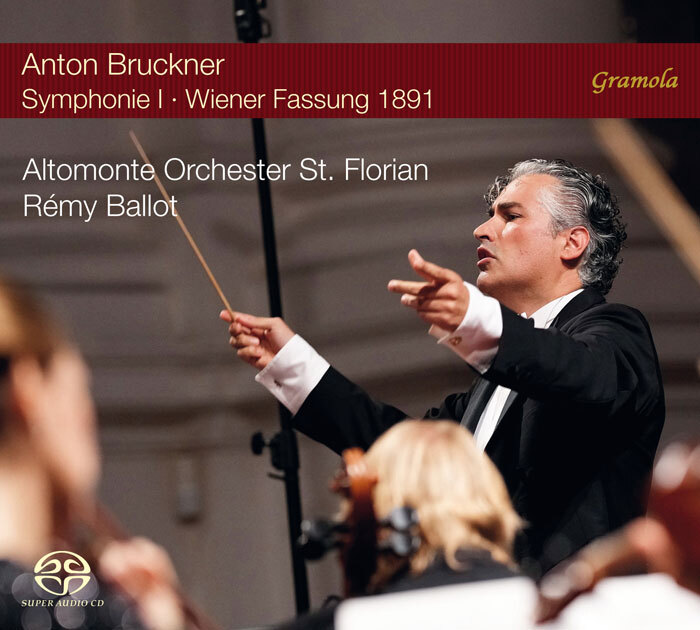
Meinen Kommentar von 2022 zusammenfassend, möchte ich an dieser Stelle nur betonen, dass diese Aufnahme der Wiener Fassung Maßstäbe hinsichtlich der Darstellung des organischen Zusammenhangs setzt und sie deshalb jedem empfehlen, der sich für Bruckners Erste interessiert.
Auf dem Programm der beiden diesjährigen Symphoniekonzerte am 18. und 19. August standen die annullierte d-Moll-Symphonie von 1869 (fälschlich „Nullte“ genannt) und der 146. Psalm für Soloquartett, Chor und Orchester, ein bislang viel zu wenig beachtetes Meisterstück aus Bruckners „vorsymphonischer“ Zeit, das entweder am Ende der St. Florianer oder zu Beginn der Linzer Jahre, höchstwahrscheinlich vor 1858 entstanden ist. Erneut dirigierte Rémy Ballot das Altomonte-Orchester St. Florian. Als Chor stand diesmal die St. Florianer Chorakademie zur Verfügung (Einstudierung durch Edgar Wolf und Martin Zeller). Die Soli sangen, wie bereits 2022, Regina Riel (Sopran), Gerda Lischka (Alt), Markus Miesenberger (Tenor) und Michael Wagner (Bass).
Die Aufführung der Symphonie war eine Premiere, denn zum ersten Mal wurde aus der kritischen Neuausgabe des Werkes gespielt, die der amerikanische Musikwissenschaftler und Kontrabassist David Chapman im Rahmen der Neuen Anton Bruckner Gesamtausgabe vorgelegt hat. Chapman selbst hielt im Rahmen eines Symposiums einen Einführungsvortrag zur Quellenlage des Werkes und ging, wie auch Christa Brüstle und Markus Neuwirth in ihren Beiträgen, der Frage nach der korrekten chronologischen Einordnung in Bruckners Schaffen nach. Bekanntlich halten sich bis in die heutige Zeit Gerüchte, die auf falschen Annahmen aus der Frühzeit der Bruckner-Forschung beruhen, nach denen das Werk vor der Ersten Symphonie entstanden und 1869 lediglich einer Revision unterzogen worden sei. Die Referenten widerlegten diese Annahme schlüssig und zeigten, dass Bruckner die Symphonie wenige Jahre lang als seine Nr. 2 betrachtete, sie aber spätestens zurückzog, als er die heute als Zweite gezählte Symphonie vollendet hatte.
(Auf dem Symposium fiel übrigens einmal wieder das von Carl Dahlhaus in einer höchst unglücklichen Stunde geprägte Wort von der „toten Zeit der Symphonie“, die sich zwischen Schumanns Dritter [1850] und Brahmsens Erster [1876] erstreckt habe, mithin also auch alle Symphonien Bruckners bis einschließlich der Fünften umfasse. Zwar distanzierten sich die Symposiumsteilnehmer von diesem Begriff, doch feierte er im Programmheft der Symphoniekonzerte nicht nur fröhliche Urständ, die angebliche „tote Zeit“ wurde gar noch ausgedehnt. Man las dort nämlich: „Bekanntlich ist die Kompositionsgattung der Symphonie nach dem ‚Koloss‘ der IX. Beethoven in den Hintergrund verdrängt. Lediglich Brahms [dessen Erste Symphonie ein Jahr nach Bruckners Fünfter fertig wurde], Schuman [sic!, gemeint ist natürlich nicht William] und Mendelssohn widmen sich ihr.“ Was hätte Dahlhaus angesichts einer solch lustigen Zusammenfassung seiner Idee wohl gesagt?)
Natürlich hat die Streichung aus dem offiziellen Werkbestand der Rezeption der d-Moll-Symphonie nicht gut getan. Zwar wurde sie seit ihrer Uraufführung unter Franz Moißl 1924 in Klosterneuburg und der Erstveröffentlichung der Partitur durch Joseph Venantius von Wöss regelmäßig gespielt und seit den 50er Jahren dann auch für die Platte aufgenommen, die Literatur neigt jedoch dazu, in dem Werk Fehler und Schwächen zu finden. Das fing bei Rudolf Louis und Alfred Orel an, die die „Annullierte“ für ganz misslungen hielten und ihr gar Bruckners Studiensymphonie in f-Moll vorzogen. Auch die Fürsprecher der d-Moll-Symphonie schränken ihr Lob oft ein, sind sich aber untereinander nicht einig, welche Sätze sie besser, welche schlechter finden sollen. So ließ Moißl einige Monate vor der eigentlichen Premiere bereits das Scherzo und das Finale öffentlich spielen, weil er meinte, diese seien den ersten beiden Sätzen deutlich überlegen und würden für einen besseren ersten Eindruck sorgen. Robert Haas, der Leiter der ersten Gesamtausgabe meinte dagegen, dass es womöglich die Unausgegorenheit des letzten Satzes gewesen sei, die Bruckner davon habe absehen lassen, mit dem Werk an die Öffentlichkeit zu gehen. Robert Simpson, der große Symphoniker, dem wir das wertvolle Buch The Essence of Bruckner verdanken, hebt in ebendiesem Buch den ersten Satz als meisterliches Stück ohne Fehl und Tadel hervor und nennt die übrigen Sätze weniger bedeutend, aber hörenswert. Er hat dann an zahlreichen Einfällen auch aus diesen Sätzen sichtlich seine Freude. Für den ihn wenig überzeugenden Mittelteil des Andantes macht er Bruckners Freund Moritz von Mayfeld verantwortlich, dessen Ratschlag sich der Komponist hier angeblich gebeugt habe. Als Beispiel für eine besonders positive Sicht auf die d-Moll-Symphonie sei der schlesische Fugenmeister Gerhard Strecke genannt, welcher in seiner Autobiographie (in dem bei Laumann erschienenen Band Zeitgenössische Schlesische Komponisten) schreibt, Bruckner wäre vielleicht noch bedeutender, hätte er „die kontrapunktische Linie aus der Nullten, der I. und der V. Sinfonie konsequent verfolgt“ – das mit Fugati reichlich gespickte Finale der „Annullierten“ dürfte die Hauptursache dieses Lobes sein.
Was tut man angesichts so vieler verschiedener Meinungen? Man hört ihnen zu, macht sich aber von der Sache ein eigenes Bild! Dazu boten die Konzerte in der Stiftsbasilika eine Gelegenheit, die man nicht anders denn als optimal bezeichnen kann. Den örtlichen Bedingungen wurde hier mit echter künstlerischer Umsicht Trotz geboten, denn ein idealer Raum für Orchesteraufführungen ist diese Kirchenhalle nicht. Gute Konzerte müssen ihr abgerungen werden. Man hat mit einem langen Nachhall zu rechnen, der beständig droht, die Konturen des Erklingenden zu verwischen; dabei füllt der Klang die Kirche kaum einmal recht aus und wirkt dadurch tendenziell mager. Wahrlich, dieser Raum fordert die Musiker und bestraft jeden Fehler! Anders gesagt: Er wirkt erzieherisch – man muss nur die Winke verstehen! Richtig genutzt, wird diese Kirche zu einer Brutstätte orchestraler Vortragskultur. Da der Hall jeder hastigen, gehetzten Aufführung sofort den Untergang bereitet, lernt man hier, sich Zeit zu lassen und dem Klang nachzuspüren. Dem Verschwimmen kann man nur durch klare Artikulation und sichere Phrasierung gegensteuern, wozu genaue Kenntnis der harmonischen Verhältnisse, der kontrapunktischen Strukturen und der Entwicklung des musikalischen Verlaufs nötig ist. Solche Deutlichkeit in der Darstellung wird dann auch helfen, die Musik durchs ganze Kirchenschiff zu den Hörern zu geleiten. Je polyphoner die Musik ist, desto kultivierter muss sie vorgetragen werden. Jede Leichtsinnigkeit rächt sich hier.
Es war nun interessant zu sehen, wie Rémy Ballot mit den klanglichen Gegebenheiten umging. Der Verfasser dieser Zeilen hatte zwei Tage vor dem ersten der beiden Symphoniekonzerte die Gelegenheit, einer Probe zuzuhören, bei der der Dirigent mit dem Orchester die Ecksätze der Symphonie durchging. Der Kopfsatz, der in der Aufführung später rund 18 Minuten dauerte, wurde zu Probenbeginn bis zum Repriseneintritt einmal durchgespielt, danach widmete man sich anderthalb Stunden lang jedem einzelnen Abschnitt des Satzes, um die Feinheiten abzustimmen. Ballot ließ dabei das Orchester gruppenweise Linie gegen Linie spielen und setzte den Gesamtklang aus den einzelnen Stimmen zusammen. So wurde das Gefühl der Musiker für die Rolle ihrer jeweiligen Stimme im Zusammenhang des Ganzen beständig gestärkt, namentlich wenn sich ein melodischer Faden von einer Stimme zur nächsten zieht. Die einzelnen Sektionen hörten schließlich aufeinander wie die Mitglieder eines Kammerensembles. Indem Ballot ihnen die Struktur des Tonsatzes verdeutlichte, schuf er einen Klang, der sich durch Achtsamkeit auszeichnet: Hauptstimmen treten deutlich als solche hervor, nehmen aber auf Nebenstimmen Rücksicht, sodass diese stets durchklingen, das Bassfundament ist als Stütze des Geschehens durchweg präsent. Beim Aufbau der großen Brucknerschen Steigerungen unterstützen sich die Klanggruppen gegenseitig, sie versuchen nicht, einander zu übertönen, es entsteht mithin auch in den stärksten Tutti-Momenten nie der Eindruck von Lärm. Der Kirchenraum wird durch plastisches Musizieren gefüllt, nicht durch brutale Lautstärke.
Hört man dann das Ergebnis dieser Probenarbeit im Zusammenhang, so fällt auf, wie sicher der Verlauf der Musik realisiert wird. Ballot weiß in jedem Augenblick, an welcher Stelle der Entwicklung er mit seinen Musikern gerade angelangt ist: wann lokale Höhepunkte anzusteuern, wann Ruhephasen geboten sind, schließlich wie die Hauptklimax eines Satzes als solche darzustellen ist. So erscheint im ersten Satz der d-Moll-Symphonie der choralartige Schlussteil der Exposition deutlich als das Ziel, auf das sich die gesamte vorherige Musik zubewegt hat. Die Durchführung wächst ohne Hast aus der Ruhe am Ende der Exposition heraus, und bei aller Kraft, die sich in den großen Crescendi sammelt, die folgen, so bleibt doch immer noch genügend Energie, in der Coda einen Sturm zusammenzubrauen, um ihn in den letzten Takten voll zu entfesseln. Durch solchen formbewussten Vortrag gewann besonders der langsame Satz, den die meisten Kommentatoren am wenigsten günstig beurteilen. Die heikelste Passage ist hier fraglos der Durchführungsteil, der lange an einem knappen rhythmischen Motiv vom Expositionsende festhält und dieses ausgiebig sequenziert. Das kann kurzatmig und mühsam wirken. Wenn aber die Harmoniefortschreitungen mit so viel Verständnis und solcher Liebe zum Detail dargestellt werden, wie hier unter Ballots Leitung geschehen, so weiß ich nicht, welche Schwäche man dem Satz noch nachsagen könnte. Er ist doch ein wunderbares, inspiriertes Stück Musik! Ausdrücklich danken muss man Ballot auch dafür, dass er die Achteltriolen der Einleitung des Finales im gleichen Tempo hat spielen lassen wie die 3/4-Takte des Scherzos – und damit einen satzübergreifenden Zusammenhang realisiert hat, der, wie der Großteil der Einspielungen dieser Symphonie beweist, den meisten Dirigenten entgeht. (Bruckner gibt durch das D-Dur zu Beginn des Finales, das wie ein Nachklang des Scherzo-Schlussakkords wirkt, einen weiteren Wink!) Das Finale wurde dann ein Fest für Kontrapunktfreunde, denn man konnte den vielen Engführungen, denen das Hauptthema unterworfen wird, perfekt folgen. Gegen Ende tat Ballot gut daran, die durchführungsartige Sektion in der Reprise des Seitensatzes nicht zu überhetzen, sodass die einzelnen Wendungen der rasanten Achtel- und Achteltriolenketten präzise ausmusiziert wurden und die Spannung über den ganzen chaotisch-cholerischen Abschnitt hinweg eher noch zunahm. Dies kam der etwas kurz geratenen D-Dur-Periode am Schluss zugute, die hier einmal nicht wie der angeklebte, konventionelle Jubel erschien, als der sie unter weniger begabten Händen herauszukommen pflegt, sondern wie der wirkungsvolle Zielpunkt einer symphonischen Entwicklung. Insgesamt betrachtet zeigte sich, dass die Symphonie einen heimlichen Helden hat: den Choral, der in diesem Werk zum ersten Mal im symphonischen Schaffen Bruckners unverhüllt das Wort ergreift und sich beinahe wie eine Berliozsche Idée fixe durch die Symphonie zieht. Den entsprechenden Stellen im ersten, zweiten und vierten Satz wurde mit viel Sinn für die vokale Herkunft dieser Musizierform Rechnung getragen. Das Orchester sang als instrumentaler Chor.
Auch einen wirklichen Chor weiß Ballot zu starken Leistungen anzuspornen, wie die der Symphonie vorangehende Aufführung des 146. Psalms bewies. Die überwiegend aus Laien zusammengesetzte St. Florianer Chorakademie leistete sehr tüchtige Arbeit, namentlich in den als Doppelchor angelegten Abschnitten des Werkes, in welchen die Wechselgesänge plastisch herauskamen. Der Dirigent achtete sorgsam darauf, dass das Orchester den Chor nirgends übertönte, und versäumte doch nirgends, die Feinheiten der Instrumentation, die auch dieses vor allen selbstständigen Orchesterwerken Bruckners entstandene Stück bereits reichlich enthält, zur Geltung zu bringen. Ballots Fähigkeit, mit langem Atem musizieren zu lassen, kam insbesondere der Schlussfuge zugute, einem recht ausgedehnten Stück über ein liedhaft-eingängiges „Alleluja“-Thema, das kaum von Zwischenspielen unterbrochen und kontrapunktischen Kunststücken nur ansatzweise unterzogen wird. Die Solostimmen überzeugten wieder mit der vom letzten Jahr her bekannten Qualität. Hervorgehoben seien ein dreistimmiger Abschnitt, der Regina Riel (Sopran), Gerda Lischka (Alt) und Markus Miesenberger (Tenor) völlig ausgewogen gelang, sowie das kurze Bass-Solo, das Michael Wagner mit majestätischer Würde vortrug. Allgemein muss man für eine so schöne Aufführung dieser im Konzertleben sehr vernachlässigten, längsten Brucknerschen Psalmvertonung dankbar sein, denn das halbstündige Werk ist viel mehr als ein bloßes historisches Dokument aus Bruckners Frühzeit. Es ist eine Meisterleistung eigenen Rechts: Voller markanter Themen und abwechslungsreicher Harmoniefolgen, farbig instrumentiert, handwerklich souverän gearbeitet, enthält der Psalm im Keim bereits nahezu alles, was später auch für den Symphoniker Bruckner typisch wird. Die instrumentalen Eröffnungstakte des langsamen Anfangssatzes erscheinen aus der Rückschau wie Vorboten späterer Adagios. Der dunkle, wuchtige Klang, mit welchem der junge Komponist das erwähnte Bass-Solo untermalt, wird in zahlreichen blechbläserdominierten Stellen der Brucknerschen Symphonien seine Nachfolger finden. Hört man dieses Werk, so wird klar, dass Richard Wagner, dessen Werke er erst später kennen lernte, vor allem insofern für Bruckner ein Vorbild war, als dass er an seinem Beispiel lernen konnte, Mut zu sich selbst zu haben, zu den eigenen kühnen Einfällen zu stehen und sich nicht mit hergebrachten Regeln zu begnügen. Natürlich hat Bruckner sich dann von Wagners Kühnheiten auch zu eigenen inspirieren lassen, aber die Grundlage, auf der er unter Wagners Einfluss weiterarbeitete, hatte er selbst gelegt, und der 146. Psalm legt davon beredtes Zeugnis ab.

Zwei Tage vor dem ersten der chorsymphonischen Konzerte fand am 16. August auf Schloss Tillysburg, das St. Florian gegenüber auf der anderen Seite des Ipfbachtals liegt, ein Kammerkonzert statt, womit zum ersten Mal im Rahmen der Brucknertage außerhalb St. Florians musiziert wurde. Das Schloss war eine glückliche Wahl, denn es verfügt über einen geräumigen Konzertsaal mit guter Akustik. In diesem steht ein Flügel der Firma Heitzmann aus dem Jahr 1863, auf welchem mit großer Wahrscheinlichkeit bereits Anton Bruckner gespielt hat, der das Schloss regelmäßig aufsuchte, um dort Klavierunterricht zu erteilen. Dieser Flügel erklang nun in dem Klavierquintett von César Franck, dem Bruckner bekanntlich 1869 auf seiner Konzertreise nach Nancy und Paris begegnete, und der über Bruckners Fähigkeiten als Orgelimprovisator des Lobes voll war. Diesem Werk gingen zwei Streichquartette voran: das einzige Streichquartett Bruckners, das er 1862 komponierte und (viel zu bescheiden) nie anders denn als bloße Studienarbeit betrachtete, und das Dritte Streichquartett von Augustinus Franz Kropfreiter, dem langjährigen St. Florianer Organisten und Regens Chori, dessen 20. Todestag wir im September begehen und der nach Bruckner zweifellos die bedeutendste Persönlichkeit in der Musikgeschichte des Stiftes ist. Es spielte das Ballot Quartett, bestehend aus Rémy Ballot und seiner Ehefrau Iris an den Violinen, Stephanie Kropfreiter, der Großnichte des Komponisten, an der Viola, und Jörgen Fog am Violoncello. Am historischen Flügel war der junge Pianist Martin Nöbauer zu hören, der im April dieses Jahres den Internationalen Klavierwettbewerb Classic on Danube gewonnen hat. Die Aufführungen überzeugten durch die gleiche Sorgfalt, durch die sich auch die Orchesteraufführungen auszeichneten (Iris Ballot, Stephanie Kropfreiter und Jörgen Fog spielten unter Rémy Ballots Leitung im Altomonte-Orchester). Jedes Mitglied des Quartetts ist eine hochkultivierte Musikerpersönlichkeit, die auf ihre Mitspieler zu hören versteht und gleichermaßen vermag, die Führung zu übernehmen, zu begleiten und sich in einen Tutti-Klang einzuordnen. Man bekommt von diesem Ensemble keinen manierierten Einheitsklang geboten, wie man ihn von Formationen hört, die sich pauschal entweder auf einen quasi-orchestralen oder auf einen fein ziselierten Vortrag festlegen. Die Spielweise dieses Quartetts orientiert sich an den jeweiligen Gegebenheiten des Tonsatzes, der mit großem Einfühlungsvermögen dargestellt wird. Auch Martin Nöbauer erwies sich im Franck-Quintett als hervorragend begabter Kammermusikspieler, der sich nicht zu Ungunsten der Streicher in den Vordergrund spielt, sondern mit ihnen beständig interagiert, sodass Klavier und Streichquartett hier in schöner Einigkeit zueinander fanden. Was das Programm des Abends betrifft, so sah man natürlich der Aufführung des Kropfreiter-Quartetts mit der größten Neugier entgegen, denn dieses noch recht junge Werk (es entstand 2001 als eine der letzten Arbeiten des Komponisten) liegt bislang in keiner Aufnahme vor und hat noch keine weite Verbreitung gefunden. Verdient hätte es beides! Augustinus Franz Kropfreiter war zweifellos ein Künstler von ausgesprochener Eigenart. Er liebte starke Kontraste und kontrapunktische Strukturen, sodass es nicht Wunder nimmt, dass das Dritte Quartett allen vier Instrumenten lohnende Aufgaben bietet. Die Harmonik ist mit scharfen Dissonanzen reichlich gewürzt, dennoch steht alles auf solidem tonalem Fundament. Die vier Sätze sind knapp gefasst, das ganze Werk dauert nur ungefähr eine Viertelstunde. An der Spitze steht ein zwischen langsamen und raschen Tempi mehrfach wechselnder Satz, wobei die raschen Abschnitte fugiert gestaltet sind. Der langsame Satz beginnt mit einem Bratschensolo, findet dann zu dichter Polyphonie und endet mit einem Trio der drei Oberstimmen, dem sich erst im letzten Ton das Violoncello wieder hinzugesellt. Das Scherzo zeigt Kropfreiters humoristische Begabung: Im Verlauf des Satzes beschleicht den Hörer immer stärker das Gefühl, dass sich in dieser Musik ein bestimmtes Lied versteckt. Dann ist es soweit: Der „Liebe Augustin“ erscheint einen kurzen Moment lang nahezu notengetreu und verschwindet umgehend wieder in den raschen Figurationen. Kropfreiter hat sich, durch das Lied selbstironisch auf seinen eigenen Namen anspielend, oft Scherze dieser Art erlaubt. Das Quartett schließt mit einem lebhaften, ruppigen Finale. Das Ballot-Quartett wird bald ein weiteres Streichquartett Kropfreiters zur Aufführung bringen. Eine intensivere Pflege dieser Musik wäre in der Tat sehr zu wünschen.
[Norbert Florian Schuck, August 2023]