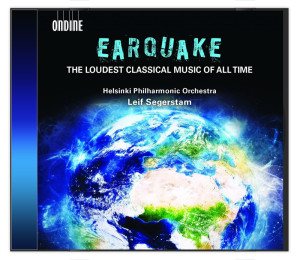Am 15. und 17. Dezember 2023 spielte das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von John Storgårds im Großen Musikvereinssaal Wien die Midnight Sun Variations der finnischen Komponistin Outi Tarkiainen, Ludwig van Beethovens Violinkonzert D-Dur op. 61 und Carl Nielsens Symphonie Nr. 5 op. 50. Als Violinsolist war Augustin Hadelich zu hören.
Die Welt ist voll mit hervorragenden Geigerinnen und Geigern, Virtuosen, die keine technische Schwierigkeiten kennen; Beherrscher ihres Instruments, wie es sie in dieser Zahl vielleicht noch nie gegeben hat. Jedoch gibt es in der absoluten Spitze, wo die technische Meisterschaft bereits allein im Dienst der Kunst steht, nur ganz wenige, die ein Werk nicht nur brillant darstellen können, sondern wirklich etwas zu sagen haben, hinter das Werk zurücktreten und ihr Instrument als Künstlerinnen und Künstler beherrschen.
Zu dieser außergewöhnlichen Kategorie gehört Augustin Hadelich, der in diesen Tagen, begleitet vom Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester, in Wien mit dem Violinkonzert von Ludwig van Beethoven zu hören war – nach wie vor und für alle Zeiten das Konzert, mit dem man entweder den Olymp besteigt oder an ihm scheitert.
Sein phänomenales Spiel berechtigt zu jener seltenen Hoffnung, einmal wieder einen absoluten Geiger hören zu können, jemanden, der sich musikalisch und künstlerisch jenseits des Instrumentalen bewegt.
Fast war es also perfekt, doch fehlte die letzte und absolute Eindeutigkeit der Meisterschaft. Dies war zunächst, unabhängig vom Solisten, der Temponahme im ersten Satz geschuldet, und zwar nicht als Problem des musikalischen Pulses, sondern in seiner Organisation als Metrum: der Dirigent John Storgårds konnte oder wollte sich nicht entscheiden, ob er vier oder zwei schlagen sollte, vielmehr bevorzugte er es, sich frei dem jeweiligen musikalischen Augenblick anzupassen, die Kontinuität des Metrums damit einer gewissen instinktiven Willkür überlassend. Das entspricht eventuell einer modernen Ansicht des Dirigierens, ist im Ergebnis jedoch eine der Möglichkeiten, an der perfekten Balance eines Werkes wie dem Violinkonzert von Beethoven zu scheitern.
Details, die Zeit gebraucht hätten, um ihre vollkommene Schönheit zu entfalten, wie zum Beispiel der Pianissimo-Wendepunkt beim Einsatz der Trompeten am Ende der Durchführung, fielen diesem metrischen Mäandern zum Opfer. Hier muss leider auch bemerkt werden, dass dies, neben der typischen Routine und mutmaßlich mangelnden Probenzeit, die für ein Solokonzert grundsätzlich im Normalbetrieb vorgesehen ist, dazu führte, dass die ansonsten hervorragenden Tonkünstler ausgerechnet bei Beethoven ihr wirkliches Potenzial klanglicher und musikalischer Differenziertheit nicht entfalten konnten.
Der zweite Satz entbehrte dann in einer schönen Linearität leider des harmonischen In-die-Tiefe-Hörens und wurde so bereits am Beginn der Tiefe und einzigartigen Wirkung der frühen Erweiterung der harmonischen Perspektive beraubt, als es von G-Dur mit einem ganz kurzen Anklang von e-moll direkt auf den vermeintlichen Ruhepunkt auf Fis-Dur geht – weiter entfernt und scheinbar der Schwerkraft enthoben geht es kaum. Es ist dies ein Moment, dessen heute noch erhör- und erlebbaren Radikalität des seelischen Ausdrucks in dieser Aufführung nicht stattfand und dadurch nach nichts und wieder nichts klang: flach und ziellos, wie es eben passiert, wenn man nur auf die Melodie hört. Das innige Spiel des Solisten konnte das fehlende innere Momentum nicht mehr ausgleichen, die weiteren Töne und Klänge wurden nur noch schön aneinandergereiht anstatt zu einem Ganzen vereint.
Dem vollkommenen Gelingen des letzten Satzes stand dann ein etwas zu rasches Tempo im Wege, so dass die aus der erforderlichen inneren Ruhe entstehende Farbigkeit und Lebendigkeit des 6/8-Takts der geigerischen Brillanz geopfert wurde, was unter anderem dazu führte, dass die entwaffnend schöne Dialogstelle zwischen Fagotten und Solovioline zu vordergründig geriet und in ihrer Sensibilität nicht funktioniert hat.
Alles in allem hörenswert, teilweise beglückend, nur eben mit der leisen Einschränkung, dass Solist, Dirigent und Orchester letztlich im künstlerischen Konjunktiv blieben, letztere aufgrund von Routine und Augenblickswillkür; ersterer, künstlerisch auf diese Weise von letzteren unmerklich gebremst.
Denn alle in allem nur latent erscheinende Ungehörtheiten und Unbedachtsamkeiten summierten sich in ihrer Wirkung, so dass das Publikum für jetzt nur die Gewissheit eines großen Versprechens hören konnte, das nicht deutlich genug betont werden kann: Augustin Hadelich ist in der Tat als ein wunderbarer, technisch überwältigend makelloser Geiger eine wirklich große Hoffnung auf eine Form von künstlerischer Reife, wie man ihr nur selten, und in der jüngeren Vergangenheit kaum, begegnet. Sein Wachsen wird sich fortsetzen und noch wunderbare Früchte tragen.
Der Konzertnachmittag wurde ansonsten eingerahmt von zwei in Wien selten zu hörenden Werken, eröffnet von den „Midnight Sun Variations“ von Outi Tarkiainen, uraufgefürt 2019, sowie der 5. Symphonie von Carl Nielsen.
Das Werk von Outi Tarkianen besticht durch klare Formgebung und sehr differenzierte und klarer Instrumentation. Es will nicht, was es nicht kann, und kann oder will auch nicht den Einfluss des finnischen Übervaters Jean Sibelius verleugnen, man könnte sogar sagen, dass die Komponistin im Sinne der Tonmalerei und pastoralen Adaption der fernen nordischen Welten ihm Reverenz erweisend eine legitime Nachfolgerin des Meisters ist. Und schon Ravel empfahl einst einem jungen Komponisten, sich in der Imitation eines Vorbilds zu üben, da nur in der unbewussten Abweichung vom Original zu hören sei, ob der junge Komponist etwas zu sagen habe. Dies ist bei Tarkianen zweifellos der Fall, womit zu hoffen ist, dass es auch in Wien möglich sein wird, die weitere vielversprechende Entwicklung dieser Komponistin mitverfolgen zu können.
Die kraft- und effektvolle 5. Symphonie von Carl Nielsen entfaltete nach der Pause ein eindrückliches Psychogramm einer Zerissenheit zwischen ebenfalls pastoraler Stimmung und einer traumatisierenden Störung dieses Idylls. Auffallend ist, wie Nielsen einige motivische Details bis zur Redundanz repetiert, es im Ganzen jedoch im ersten Satz trotzdem schafft, zu einer geschlossenen Form zu finden. Der zweite Satz bleibt leider hinter dieser Geschlossenheit zurück und hinterlässt die Frage, ob er der Form entbehrt, oder, was wahrscheinlicher ist, ob die Aufführenden nur nicht in der Lage waren, diese entstehen zu lassen. Nielsen konnte hier, jedenfalls nach diesem Höreindruck, nicht an den großen Wurf seiner 4. Symphonie anknüpfen, sondern unterwirft sich hier unter Inkaufnahme der Gefahr, dieses Werk der Zeitlosigkeit zu entziehen, einer Ästhetik, die nicht immer die seine zu sein scheint.
Der Dirigent John Storgårds war nun aber in seinem Element und brachte das hier furios aufspielende Niederösterreichische Tonkünstlerorchester zur orchestralen Exzellenz.
[Jacques W. Gebest, Dezember 2023]