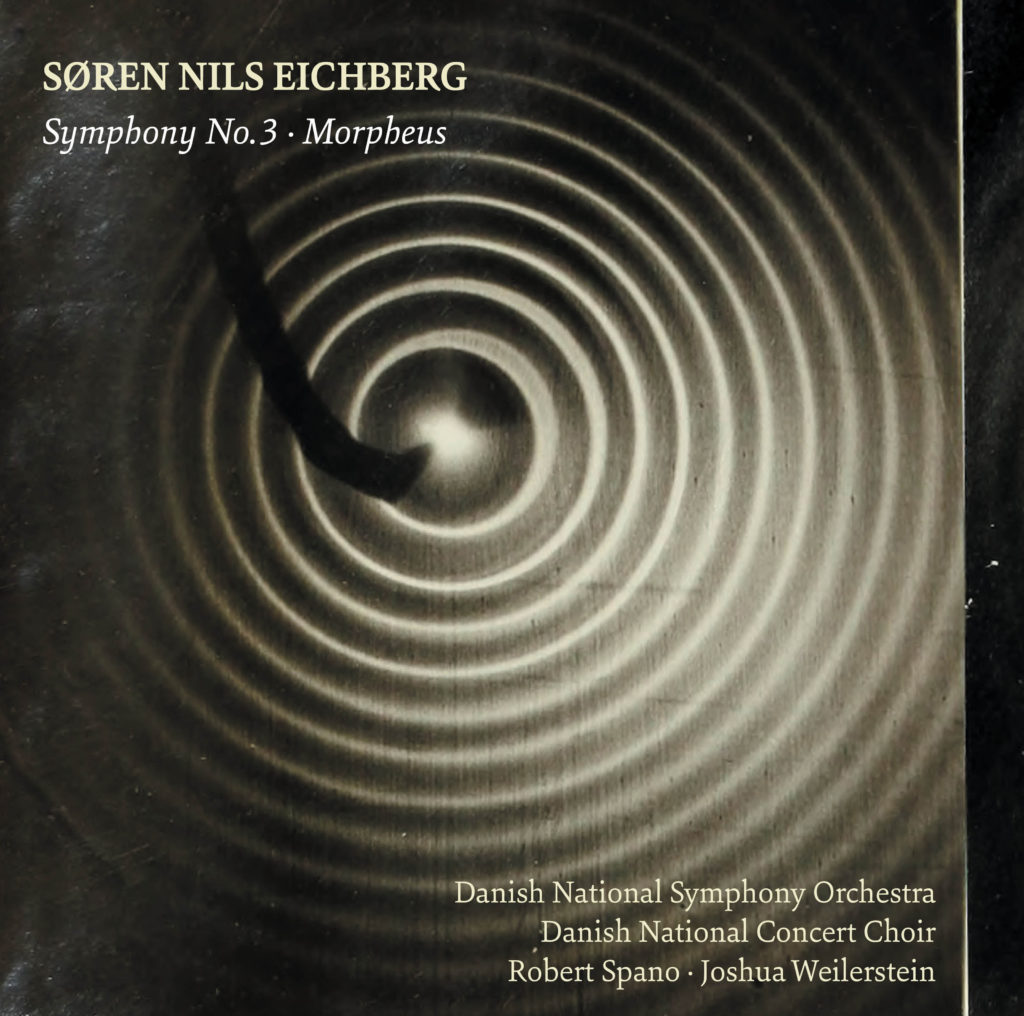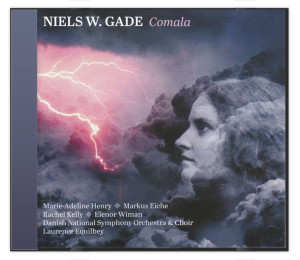DG 486 3471 (3CD); EAN: 0028948634712

Der Italiener Fabio Luisi leitet das Danish National Symphony Orchestra seit 2017 und hat nun mit diesem seit jeher eng dem Werk Carl Nielsens verpflichteten Klangkörper einen neuen Zyklus von dessen sechs Symphonien auf Deutsche Grammophon eingespielt. Die Vokalisen in der „Sinfonia espansiva“ gestalten Fatma Said und Palle Knudsen. Kann die neue Box unter den mittlerweile zahlreichen Gesamtaufnahmen bestehen?
Von den im Zeitraum von 1892 bis 1925 entstandenen sechs Symphonien Carl Nielsens (1865–1931) brauchte selbst die berühmteste – Nr. 4 „Das Unauslöschliche“ – sehr lange, bis sie halbwegs ins feste, internationale Repertoire gefunden hat. Erst seit wenigen Jahren spielen selbst engagierte studentische Orchester dieses anspruchsvolle Werk. Dennoch setzen es auch die großen Profi-Institutionen nicht wirklich häufig auf ihre Programme – von den übrigen fünf Symphonien des dänischen Meisters, die sämtlich mit außergewöhnlichen Qualitäten aufwarten können, ganz zu schweigen. Dass Herbert von Karajan 1981 die Vierte mit den Berlinern für DG – sehr schön – eingespielt, aber praktisch nie im Konzert aufgeführt hat, spricht für sich.
Trotzdem existieren mittlerweile gut 20 Gesamtaufnahmen der 6 Nielsen-Symphonien, alleine vier mit dem Danish National Symphony Orchestra (identisch mit dem Dänischen Rundfunk-Symphonieorchester – DRSO). Deren erste aus den 1950er Jahren wurde noch von verschiedenen Dirigenten gestemmt (Erik Tuxen, Thomas Jensen und Launy Grøndahl), später folgten Zyklen mit Herbert Blomstedt (1975, EMI) und Michael Schønwandt (1999–2000, Danacord). Begonnen 2019, kurz vor dem Corona-Ausbruch, wollte man dann wohl auch dem seit 2017 amtierenden italienischen Chefdirigenten Fabio Luisi die Gelegenheit geben, sich mit diesen höchst individuellen Werken auseinanderzusetzen.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Ergebnis fällt sehr uneinheitlich aus. Betrachtet man die Spielkultur des DRSO, so ist es eigentlich selbstverständlich, dass in den bald 50 Jahren seit Blomstedts EMI-Aufnahme die technische Qualität nochmals hörbar gewachsen ist. Und natürlich kennt das Orchester alle Symphonien Nielsens wahrscheinlich besser als jeder Dirigent: Sie gehören definitiv zu dessen Aushängeschildern.
Blomstedt hat dann Ende der 1980er mit der San Francisco Symphony eine der bis heute maßstabsetzenden Einspielungen präsentiert (Decca). Gerade bei diesem Vergleich – seine Kopenhagener ‚Box‘ wurde kürzlich wieder von Erato als Streaming-Version aufgelegt – erkennt man, inwieweit selbst ein hochgradig befähigter Dirigent an diesem Repertoire noch wachsen kann – und muss! Etwa auf diesem Level bewegte sich auch Schønwandts Lesart: klar, unprätentiös, ohne „Macken“ oder persönliche Eitelkeiten – das DRSO zelebrierte Nielsens Musik dabei makellos.
Vielleicht überraschend, dass gerade berufene Sibelius-Interpreten wie Paavo Berglund (unterkühlt), Colin Davis (völlig überhetzt und oberflächlich) oder John Storgårds (langweilig) Nielsens Symphonik überhaupt nicht gerecht wurden. Bei Fabio Luisi wäre man geneigt, anzunehmen, dass Nielsen seinen Repertoire-Vorlieben – man denke an die guten Franz Schmidt Einspielungen – entgegenkommen sollte. Nielsen hingegen verweigert sich jeglichen Profilierungsneurosen: Wenn ein Dirigent versucht, diese Musik zu „pushen“, rächt sich das ausnahmslos. Manches wirkt so sofort geschwollen, gewollt; der Charakter eines Satzes leidet schon unter geringen „aufgesetzten“ Tempomodifikationen, beträfen die das Grundzeitmaß oder zu auffällige agogische Freiheiten.
Zunächst das Positive: Abgesehen von der – wie bei Schønwandt – durchgehend souveränen Orchesterleistung, gelingen Luisi einige Sätze rundum zufriedenstellend: Dazu zählt – bis auf den eindeutig zu flotten 3. Satz, der eher Brahmssche Intermezzo-Qualitäten haben könnte – die 1. Symphonie; diese bereits ein toller Gattungsbeitrag. In der 2. Symphonie Die 4 Temperamente verlangt ja der Titel verbatim nach sehr klar modellierten „Charakterzügen“; der Choleriker zu Beginn wird noch gut getroffen. Der Phlegmatiker ist analog zum „Scherzo“ – Nielsen verwendet den Begriff nie – der Ersten zu hastig. Der melancholische dritte Satz wird dafür ein wenig zu breitgetreten, der Höhepunkt übertrieben. Das Finale geht ziemlich schief und der Sanguiniker kommt plump wie ein Dorftrottel daher: Undifferenziert rammt Luisi den Hauptrhythmus in den Boden. Blomstedt (Decca) oder Sakari Oramo (BIS) demonstrieren, welch tänzerische Offenbarungen hier stattfinden könnten.
Wie zuvor versteht Luisi auch in der Sinfonia espansiva (Nr. 3) zumindest einen Satz gar nicht – wiederum das Finale. Zu breit, zu laut: Der ganze Hymnus bläht sich so unehrlich auf. Das können die überaus ansprechenden, freilich marginalen Vokalisen im zweiten Satz – mit der fantastischen Fatma Said und Palle Knudsen – nicht aufwiegen. Sehr gut funktionieren die ersten drei Sätze der durchgehenden Unauslöschlichen – organisch im Aufbau und prägnanter als im Rest werden Sinn und Zweck der verschiedenen Themen klar. Das Finale mit seinem berühmten Paukenduell – das nur oberflächlich an Artillerie des Ersten Weltkriegs erinnern soll – nimmt Luisi für den Geschmack des Rezensenten um Einiges zu schnell. Karajan liegt hier goldrichtig; ein Übermaß an äußerlicher Virtuosität dient dem anschaulich vorgetragenen „Lebenskampf“ nicht wirklich. Unerträglich dann wieder Luisis völlig aus dem Ruder laufende Verbreiterung ganz zum Schluss – da übertrieb allerdings selbst der bekanntlich bescheidene Herbert Blomstedt.
Die beiden letzten Symphonien Nielsens aus den 1920ern sind tatsächlich wesentlich moderner: Der Komponist geht damit viel weiter als der gleichaltrige, freilich zu dieser Zeit weitgehend verstummte Jean Sibelius. Die geheimnisvollen wie irritierenden Klangflächen bzw. Ostinati zu Beginn der Fünften erscheinen etwa bei Blomstedt wie der Zaubertrank des Miraculix – unverzichtbare Ingredienzien eines starken, zugleich ambivalenten Mysteriums. Bei Luisi sind das eher Störfelder, die es zu übertünchen gilt. Kontrapunktische Abschnitte werden zwar durchsichtig, jedoch der wieder hymnische Schlussteil – durchaus mit Anspielungen an die Vierte – zu schreierisch, im Detail nicht annähernd ausbalanciert.
Die zunächst sehr verstörende 6. Symphonie – nichts ist da „semplice“ – mit ihren eigentümlichen, hohen Schlagwerkakzenten wirkt bei Luisi zwiegespalten. Nach einem schönen Kopfsatz kommt die Humoreske schon ordentlich schräg daher, was sie ja zweifellos ist; echten Humor sucht man dabei leider vergebens. Dasselbe gilt für den Variationssatz, vor allem erneut für dessen künstlich aufgepumpten Schluss. Insgesamt enttäuscht in Luisis Darbietungen eine deutlich zu pauschale Dynamik: Die Bläser überdecken sehr häufig die Streicher und alles ist über Strecken schlicht zu laut. Hier schaffen mehrere Kollegen einen konsequenteren Aufbau der Klangschichtungen.
Aufnahmetechnisch kommt die DG-Veröffentlichung zwar bei Weitem nicht an Oramos klanglich sensationelle drei BIS-SACDs heran, ist trotzdem ordentlich. Nur gibt es grenzwertig viel Hall, wodurch natürlich einige laute und komplexe Stellen etwas matschig und verschwommen ankommen. Der Rezensent fragt sich, ob DG mit der Abmischung von Dolby Atmos® Produktionen in simples Stereo noch generell Probleme hat: Besonders negativ fiel dies z. B. bei Richard Strauss‘ Orchesterwerken unter Andris Nelsons auf.
Fazit: Luisis Dirigate stellen keinen Fortschritt zur Schønwandt-Aufnahme des DRSO – mittlerweile in Lizenz bei Naxos erhältlich – dar: Der Maestro steht des Öfteren der Musik im Wege. Das Orchester setzt selbstverständlich bravourös Luisis Ideen um; die stören allerdings eher, als dass sie bestimmte Aspekte von Nielsens Symphonik klarstellen oder glaubwürdig unterstreichen würden. Im DG-Katalog ergibt sich so immerhin ein gewichtiges Upgrade zur ziemlich missratenen Gesamtaufnahme Neeme Järvis, die mit ganz heißer Nadel gestrickt war – Turbo ohne Sinn und Verstand. Blomstedts zweiter Zyklus aus San Francisco bildete offensichtlich in seiner durchdachten Profiliertheit den Nährboden für aktuellere, sehr gelungene Neueinspielungen. Neben Schønwandt bleiben dies insbesondere die Dacapo-Produktion mit New York Philharmonic unter Alan Gilbert sowie Sakari Oramos aufnahmetechnisch gleichermaßen absolut konkurrenzloser Zyklus aus Stockholm.
Vergleichsaufnahmen: San Francisco Symphony, Herbert Blomstedt (Decca 460 985-2 & 460 988-2, 1987-89); Göteborgs Symfoniker, Neeme Järvi (DG 00289 477 5514, 1990–92); Danish National Symphony Orchestra, Michael Schønwandt (Naxos 8.570737-39 [3 Einzel-CDs], 1999–2000); New York Philharmonic, Alan Gilbert (Dacapo 6.200003, 2011–14); Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Sakari Oramo (BIS-2028, BIS-2048 & BIS-2128, 2012–14) – [Nr. 4] Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan (DG 445-518, 1981)
[Martin Blaumeiser, August 2023]