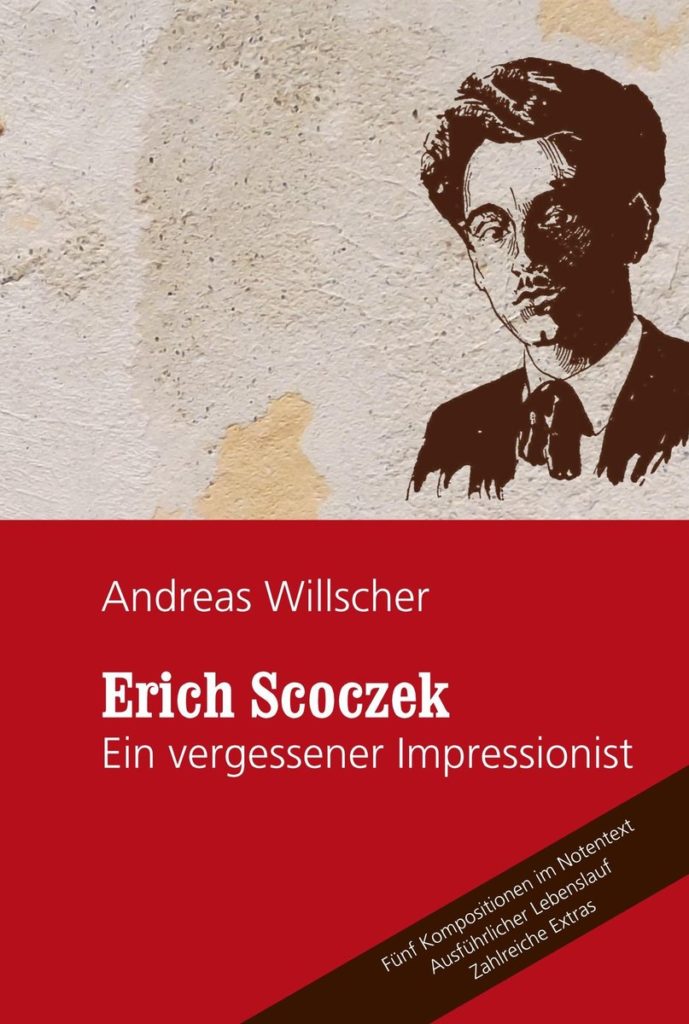An einem kühlen Abend, dem wahrscheinlich letzten Rückfall des diesjährigen Winters, strebten vereinzelte Menschen mit eiligen Schritten durch dunkle Gassen, die Hände in den Seitentaschen der Mäntel, den Kopf eingezogen zwischen Kragen und Schultern. Das gemeinsame Ziel war ein etwas versteckt liegender Saal am Rande des 1. Wiener Bezirks; ein repräsentatives Haus, ein Palais aus der Gründerzeit, von derem einst selbstverständlichen Stolz kündend. In diesem Palais ein Saal, holzgetäfelt, anheimelnd, auch heute noch geschmacklich zu ertragen, findet eine vergangene Zeit peu à peu ihre neue Gegenwart.
Die vergangene Zeit ist die von Stefan Zweig besungene „Welt von gestern“, eingängig geschriebene Pflichtlektüre für alle, die verstehen wollen, warum in Wien manche Pflastersteine noch heute singen können, und des Buches Raunen von einem aufgelassenen Konzertsaal, dem legendären Bösendorfer-Saal in der Herrengasse, wo sich heute das einst erste Hochhaus Wiens befindet, damals, vorher, lang dahin, einer der Klavier- und Kammermusiktempel der Welt. Das letzte Konzert in jenem Saal wurde einst vom Rosé-Quartett gespielt, dessen Primarius der Schwager von Gustav Mahler war, und dessen Tochter Alma Rosé, nur um sich die letzte Schrecklichkeit des Vergehens jener Welt einmal mehr in Erinnerung zu rufen, in Auschwitz um ihr Leben gebracht wurde, wo sie – einer der absoluten Gipfel des Zynismus – das Mädchenorchester zu leiten hatte, das zumindest den Musikerinnen in einigen Fällen, wie Anita Lasker-Wallfisch und Esther Bejarano, das Überleben ermöglichte.
Die nun langsam entstehende Gegenwart ist der in seiner zweiten Saison befindliche Bösendorfer-Zyklus im Haus der Ingenieure in der Eschenbachgasse; und dieses Unterfangen der Klavierfabrik Bösendorfer ist aus vielen Gründen ein Glücksfall.
Die damalige Schleifung des alten Bösendorfer-Saales koinzidierte mit dem Bau und der Eröffnung des Wiener Konzerthauses, das ein Monopol zweier Konzerthäuser festigte, die zwar zu den akustisch immer noch feinsten, und natürlich überhaupt bedeutendsten, berühmtesten und schönsten (Wiens, und damit) der Welt gehören, nicht umsonst größter lokaler Stolz und Sehnsuchtsort der großen weiten Musikwelt, jedoch auch das in Wien immer schon jenseits des Starkults umtriebige und herzenskünstlerische Musikleben zu annullieren die Tendenz hatte. Anders gesagt: außerhalb der beiden großen Häuser und ihrer Konzertreihen fand und findet sich kaum ein Platz für die zahlreichen wunderbaren Künstlerinnen und Künstler, die es überall gibt, und den Bedarf der Menschen nach Musik, der von der Öffentlichkeit ausreichend wahrgenommen wird, und in dem das Publikum die Möglichkeit hat, zum Fachpublikum zu reifen, das sein Gehör an der Musik schult und nicht die Augen am neuesten angesagten Stern am wetterwendischen Musikhimmel.
Die große Wahrnehmung fehlt dem Bösendorfer-Zyklus sicher noch, wobei die Idee eines Geheimtipps durchaus ihren bleibenden Reiz hat, doch nimmt er in einer Stadt, in der nichts so hoch geschätzt wird wie Tradition, mit historischem Recht seine eigene Geschichte wieder auf, berichtet und bezeugt von Stefan Zweig („…Als die letzten Takte Beethovens verklangen, vom Rosé-Quartett herrlicher als jemals gespielt, verließ keiner seinen Platz… Man verlöschte die Lichter, um uns zu verjagen. Keiner der vier- oder fünfhundet Fanatiker wich von seinem Platz. Eine halbe Stunde, eine Stunde blieben wir, als ob wir es erzwingen könnten, durch unsere Gegenwart, dass der alte geheiligte Raum gerettet würde.“) und öffnet einen neuen Raum, eine neue Möglichkeit, außerhalb der Wiener Traditionshäuser Klavier- und Kammermusik auf höchstem Niveau zu hören. Bevor sich diese Zeilen also der Protagonistin des Abends zuwenden, sei also nachdrücklich und mit deutlicher Empfehlung auf die Existenz dieser Konzertreihe, die es schafft, als Projekt aus der Vergangenheit heraus Gegenwart zu schaffen, hingewiesen.
Nun zum Konzert selber, ein Klavierabend der Pianistin Martina Filjak, die, aus Kroatien stammend in Wien studierte und 2009 in Cleveland einen der wichtigsten Klavierwettbewerbe überhaupt in mehreren Kategorien gewann. Die Vita im Programmheft gab dem Publikum bereits die vorauseilende Möglichkeit zur Einschätzung ihrer Qualitäten, indem hier, einer allgemeinen Unsitte folgend, der Beschreibung der Karriere vorschusslorbeerend die Wertung durch in diversen Rezensionen gesammelte ausgesuchte Adjektive vorangestellt wurde. Dieser Salbe hätte es gar nicht bedurft, denn vom ersten Moment an zeigte Martina Filjak, aus welchem Holz sie geschnitzt ist: eine hochmusikalische und absolute Beherrscherin ihres Instruments, und künstlerisch und stilistisch in der Lage, einen großen Bogen vom Barock in die Gegenwart treffsicher zu spannen.
Beim Wort Barock müssen wir gleich innehalten. Händel und Bach auf einem modernen Flügel: ja geht denn das? – Ja, es geht, denn zuerst ist diese Musik, Händel’s Suite Nr. 7 in g-moll und die Chromatische Fantasie und Fuge in d-moll von Bach, zwar nicht für einen modernen Flügel geschrieben worden, und Originalklang-Anhänger mögen sich auch lieber aus Prinzip abwenden, als sich einer nicht neuen Erkenntnis zu öffnen: es ist in dieser Musik etwas Allgemeingültiges, etwas wie ein Tongebäude, ein Tonsatz, dessen Struktur und Bewegung per se überinstrumental ist, und eben auch auf einem modernen Instrument verwirklicht werden kann. Musik wird nicht vom Klang gemacht, sondern vom Menschen, und ein musikalischer Geist kann, wie hier Martina Filjak, diese Musik darstellen.
Der Pianistin gelang das sehr gut, ihre Fähigkeit zur gesanglichen Stimmführung im piano und in langsamen Sätzen ist außergewöhnlich, lässt ständig neu aufhorchen und machte besonders die Suite von Händel zu einem hellhörigen Erlebnis. Bach’s Fantasie erlag ein wenig, wie vorher schon die großgestigen Momente bei Händel, einer gewissen déformation professionelle, einer Art von großgestigem Pianismus, der dem letzten Gelingen des Ganzen etwas den Atem nahm; die Künstlerin ließ sich von diesem Momentum zu Ungunsten des sonst so gefassten Klangs mitreißen, was auch der Komplexität der Fuge nicht zugute kam, im Ganzen aber doch überstrahlt von der intimen Gesanglichkeit ihres Spiels.
Nach der Pause folgte der „Faschingsschwank aus Wien“ von Robert Schumann. Die Musik von Schumann ist technisch immens herausfordernd und der musikalische Zugang zu ihr manchmal sperrig, doch straft er jene in Wien Ansässigen Lügen, die immer noch dem Wahn erlegen sind, dass die größte Musik ausschließlich in Wien entstanden sei (ja, es gibt sie noch, diese Ansässigen, und wir verstehen uns untereinander ganz wunderbar). Das Werk und seine Aufführung bildete den künstlerischen Höhepunkt des Abends. Martina Filjak war hier ganz und gar in ihrem Element. Das Werk fordert pianistisch alles, ist ungeheuer komplex und kann nur mit entsprechendem Zugriff, großer Kraft und bei gleichzeitiger pianistischer Sensibilität, einer wirklichen Fähigkeit zur Gesanglichkeit bewältigt werden. Über alle diese Qualitäten verfügt die Pianistin auf höchstem Niveau, und das Publikum hörte und staunte.
Nach diesem Werk flachte die Kurve insofern ab, als sich die folgenden Werke von Skrjabin und Liszt beim besten Willen künstlerisch nicht auf der Schumann’schen Höhe befinden. Martina Filjak erläuterte die Entstehung des „Präludium und Nocturne“ von Skrjabin, einem Werk, das der Jüngling (op. 9) unter dem Eindruck des angstvollen Schreckens über eine Sehnenscheidenentzündung der rechten Hand für Klavier linke Hand komponierte. Ein etwas sentimentales, hörbar zum Selbstmitleid neigendes Werk, das im Werden jedoch zu einigem Schwung und starker Eindringlichkeit wächst, wiederum von der Pianistin linker Hand mit einem solchen Können zum Leben erweckt, dass das Staunen über sie das Mitleid für das Selbstmitleid des Komponisten bei weitem überlagerte. Liszt’s „Réminscences de Lucia Lammermoor“ sind dann ein virtuoses, salonhaftes Gewerke, das als wiederum souverän-phantastisch gespielte Zugabe durchging, jedoch seine beim Komponisten so oft zu ertragende Leere nicht verheimlichen konnte. Abermals reifte die Erkenntnis, dass Schumann eben doch der bessere Liszt ist.
Ein kleines Wunder folgte mit der Zugabe, denn Martina Filjak, ausdrücklich dankbar für das Format der Konzertreihe, den schönen und akustisch sehr angenehmen Saal, den hervorragenden Bösendorfer-Flügel (das darf erwähnt werden, obwohl der Rezensent dafür kein Geld von Bösendorfer erhält), der die klanglichen Facetten, zu denen die Pianistin bei diesem vielfältigen Repertoire fähig war, ermöglichte, sowie das im Hören gebannte geneigte Publikum, das von der Pianistin im Handumdrehen zum Fachpublikum gemacht wurde, gab und schenkte uns Arvo Pärt’s „Für Alina“. Der Pianistin abermals erstaunliche Fähigkeit zum gesanglichen Spiel, zum Klingenlassen an der Grenze zur Hörbarkeit, siegte im leisesten pianissimo über den parallel wahrnehmbaren Lärm eines zufällig auf der Straße vor dem Saal haltenden Autos, aus dessen Boxen Bässe sinnlos wummerten, die es jedoch, wie damals das abgedrehte Licht, nicht schafften, diese Gegenwart zu stören.
[Jacques W. Gebest, April 2024]