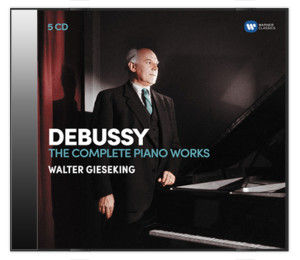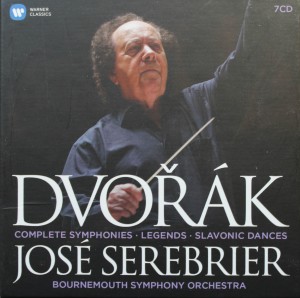Warner Classics, 0190295191702; EAN: 1 90295 19170 2

Als „Phoenix Concerto“ hat nun ein teils aus Fragmenten rekonstruiertes Violinkonzert des polnischen Komponisten Ludomir Różycki von 1944 das Licht der Welt erblickt. Als „Füllstück“ enthält die Warner CD des Geigenvirtuosen Janusz Wawrowski und dem Royal Philharmonic Orchestra unter Grzegorz Nowak dann allerdings einmal mehr das Tschaikowsky-Konzert.
Mit relativ hohem Werbeaufwand und von etlichen – zumeist polnischen – Institutionen gesponsert, hat der Violinist Janusz Wawrowski (*1982) auf Warner nun die Einspielung eines bisher größtenteils als verschollen angesehenen Violinkonzerts von Ludomir Różycki (1883–1953) vorgelegt. Różycki, mit den etwa gleichaltrigen Komponisten Karłowicz und Szymanowski eine der Hauptfiguren des Jungen Polen in der Musik, studierte zunächst in Warschau, später dann noch bei Humperdinck in Berlin, wo er sich mit seinem großen Vorbild Richard Strauss anfreundete. Vor allem mit Opern und symphonischen Dichtungen feierte er nicht nur in Polen beachtliche Erfolge. 1944 verlor er jedoch während des Warschauer Aufstands einen Großteil seiner Manuskripte in den Flammen seines Hauses. Bis zu seinem Tod versuchte er mit unbändiger Energie, die vernichteten Werke zu rekonstruieren, was nur zum kleineren Teil gelang.
Für das im Sommer 1944 entstandene Violinkonzert lag zwar bereits ein Klavierauszug und ein unvollständiger Orchestersatz vor, Rekonstruktionen von Jan Fotek und Zygmunt Rychert blieben allerdings erfolglos. Erst durch Wawrowskis Entdeckung des Manuskripts des Klavierauszugs sowie vor allem von 87 Takten eines eigenhändigen Partiturfragments des Komponisten, gelang es Ryszard Bryła nun, eine konsistente Aufführungsversion des – wie bereits das 2. Klavierkonzert von 1941/42 – nur zweisätzigen Werkes zu erstellen. Wawrowski kümmerte sich dabei um eine spielbare – Różycki war von Hause aus Pianist und mit virtuoser Geigentechnik recht wenig vertraut – Fassung des Soloparts. Das viersprachige Booklet gibt darüber angemessen Auskunft, ohne in Details zu gehen.
Das 7-minütige Andante lebt vom über weite Strecken dem Solisten übertragenen elegischen Gesang. Ob die mehr oder weniger direkten Anspielungen an den für Paweł Kochański typischen Stil bei dessen Ausarbeitung des Soloparts von Szymanowskis 1. Violinkonzert so bereits von Różycki intendiert sind oder doch mehr Wawrowskis Idee, lässt sich natürlich ohne Kenntnis der originalen Quellen nicht entscheiden. Daneben erinnert das Violinkonzert öfters an Korngolds Gattungsbeitrag: Im zweiten Satz (16 Minuten) finden sich gewisse Annäherungen sowohl an amerikanische Unterhaltungsmusik als auch Instrumentationsideen, die später dauerhaft in die Filmmusik eingegangen sind. Insgesamt ist das Stück – besonders durch seine stellenweise arg bunte, aufgedonnerte Orchestrierung – für ein Konzert fast etwas zu „operettig“ und im Grunde nur brillanter Edelkitsch; als Entdeckung hingegen nicht uninteressant. Die Interpreten – Wawrowski wird vom Royal Philharmonic Orchestra unter Grzegorz Nowak begleitet – geben hier ihr Bestes. Aufnahmetechnisch vertritt die Veröffentlichung die Position, den Solisten nicht bewusst in den Vordergrund zu setzen; ein eigentlich natürliches Klangbild, das der Rezensent in aller Regel goutiert, welches sich beim folgenden Stück aber als Fehlgriff erweist.
Völlig enttäuschend gerät leider die Darbietung des Tschaikowsky-Konzerts: Selbstverständlich beherrscht Wawrowski den Solopart technisch und klanglich perfekt, doch derart emotional flach und – vor allem durch Nowaks völlig teilnahmsloses, ohne jedwede Agogik stattfindendes Heruntergenudle des Orchesterparts – langweilig habe ich dieses Werk tatsächlich von Profis noch nie gehört. Man kennt zwar solche äußerst tempokonstanten Tschaikowsky-Lesarten von manchen russischen Dirigenten, namentlich Jewgeni Mrawinski – die damit bewusst auf Konfrotationskurs zu verbreiteten, überromantisierenden westlichen Deutungen gingen; aber hier passiert gerade im Kopfsatz zwanzig Minuten lang praktisch überhaupt nichts – nicht mal in der Kadenz. Die Canzonetta ist zumindest klanglich sensibel, jedoch selbst die große Kantilene des Soloparts bleibt verhangen und blutleer – man fühlt sich quasi wie unter Zombies. Wenigstens im Finale nehmen Violinist und Dirigent ein straffes Tempo; alles erscheint da engagierter und wird immerhin eine ganz brauchbare Show.
Fazit: Eine bemerkenswerte Wiedererweckung – freilich keine Sensation – eines nicht allzu substanzreichen Violinkonzerts in der Nachfolge der Spätromantik und eine wirklich überflüssige Tschaikowsky-Wiedergabe, die den Hörer völlig kalt lassen dürfte.
[Martin Blaumeiser, September 2021]