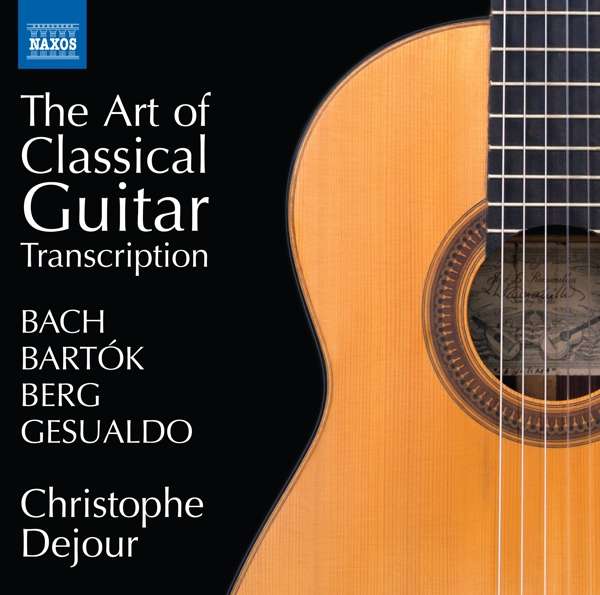NEOS 11630 (7CDs), LC 15673; EAN: 4 260063 116308

Wohl kein Ort der Welt scheint nach 1945 so mit dem Begriff der „Musikalischen Moderne“ verknüpft wie Darmstadt mit seinen berühmt-berüchtigten Ferienkursen. Von den etwa tausend bei den dortigen Begleitkonzerten aufgeführten Klavierwerken hat jetzt das Label NEOS auf sieben CDs eine kluge Auswahl als „Darmstadt Aural Documents – Box 4 · Pianists“ vorgelegt, die dem Hörer gut die mannigfaltigen ästhetischen Positionswechsel der letzten siebzig Jahre demonstriert. Dabei hatte die Klaviermusik, vergleichbar mit dem Streichquartett in früheren Epochen, immer eine Schlüsselfunktion inne. Unter den Aufnahmen etlicher für die Interpretation von neuer Klaviermusik prägender PianistInnen – darunter viele CD-Erstveröffentlichungen – finden sich auch einige echte Schätze, gerade aus den Anfangsjahren. Das komplette Programm der Box findet man hier.
In der Reihe Darmstadt Aural Documents widmet sich die vierte Veröffentlichung bei NEOS (nach Orchesterwerken, John Cage und Ensemblemusik) endlich der Darmstädter Auseinandersetzung mit der Klaviermusik. Die 7-CD-Box enthält 54 Werke von 49 verschiedenen Komponisten mit insgesamt über 8½ Stunden Musik. Im Gegensatz zur großen Anthologie Musik in Deutschland 1950-2000 (RCA), die dem Hörer Stücke oft nur häppchenweise vorsetzt, sind hier zum Glück aus mehreren Teilen bestehende Werke immer vollständig zu hören. Das unerwartet dünne Booklet enthält neben der Trackliste zunächst nur ein Vorwort sowie einen schönen Text von Stefan Fricke, der die historische Position des Klaviers nach dem Zweiten Weltkrieg und deren Veränderung beleuchtet. Nachfolgend versucht Michael Zwenzner zwar, die meisten der vorgestellten Werke innerhalb ihres konkreteren ästhetischen Kontexts zu verorten – tatsächliche Werkbeschreibungen zu den einzelnen Stücken fehlen aber. Dies kann und soll diese Besprechung natürlich nicht nachholen.
Die Verteilung der Musik auf die 7 CDs entspricht so sicher nicht ganz ihrer anteiligen historischen Bedeutung für Darmstadt. CD1 enthält Klavierwerke vor 1950 – hier findet man neben Arnold Schönbergs opp. 19 u. 23 und einigen zu Unrecht vergessenen Raritäten (Wolpe, Sessions, Apostel) z.B. auch die Klaviersonate von Béla Bartók (1926), was zunächst verwundern mag, da diese heute allenfalls gemäßigt modern erscheint. Man muss sich allerdings vor Augen führen, dass die erste Aufgabe der Darmstädter Ferienkurse darin bestand, dem interessierten Publikum und den (jungen) Komponisten nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst die Musik zugänglich zu machen, die während des Dritten Reichs schlicht verfemt war (Stichwort: Entartete Musik). Auch in der Aufführungsstatistik etwa der Münchner Musica-Viva-Konzerte während der 1950er-Jahren hatte Bartók einen erstaunlich hohen Stellenwert. CD2 ist allerdings etwas unbefriedigend: Auf nur einer CD erscheinen die Werke der 50er und 60er-Jahre unterrepräsentiert, da gerade diese zentrale Bedeutung für die weitere Entwicklung, insbesondere auf Reflexionsebene, in Darmstadt hatten – nicht zuletzt dadurch, dass die Kurse bis 1970 noch jährlich stattfanden (danach im Zweijahreszyklus). Hier bedauert man auch die Entscheidung der Herausgeber, Werke für zwei Klaviere ganz herauszunehmen. Die komplexesten Werke dieser Zeit sind oft gerade für diese Besetzung konzipiert. CDs 3-6 präsentieren jeweils ca. ein gutes Jahrzehnt (1970-2010). Die zweite Hälfte von CD6 und CD7 sind dann Stücken gewidmet, bei denen das Klavier modifiziert ist (andere Stimmung, Präparation, Hinzunahme von Tonbändern oder Live-Elektronik, computergenerierte Klänge etc.), oder aber der Pianist noch andere Aktionen – etwa als Sprecher – ausführen muss bzw. gänzlich fehlt (Player Piano).
Darmstadt stand jahrzehntelang nicht nur für einen wichtigen Aufführungsort Neuer Musik – das war Donaueschingen bereits seit den Zwanzigerjahren – sondern vor allem auch für den Ort kritischer Reflexion unter Komponisten und Musikwissenschaftlern. Bezeichnend ist hier allerdings das fast dogmatische Festhalten an einem bestimmten, sicher auch ideologisch geprägten Fortschrittsbegriff, wie ihn etwa Theodor W. Adorno und Heinz-Klaus Metzger vertraten. Dieser fordert eine rational herstell- und analysierbare Materialstimmigkeit („Materialfortschritt“), die auf der anderen Seite musikalische Begrifflichkeiten wie etwa „Ausdruck“ völlig ignoriert und so auch – besonders deutlich im Fall von Pierre Boulez‘ 3. Klaviersonate – quasi das „Fehlen des Autors“ geradezu heraufbeschwört.
Vielleicht lässt sich diese (Fehl?)entwicklung anhand der ersten beiden CDs für den Hörer gut nachvollziehen. So finden wir hier eine Darbietung von Anton Weberns Variationen op.27 durch den Uraufführungspianisten Peter Stadlen, dem der Komponist 1937 mit auf den Weg gegeben hatte, das hochkonstruktive Werk quasi romantisch und mit Rubato vorzutragen. Erstaunlich angesichts der Tatsache, dass schon die erste Phrase nicht nur ein Palindrom in zeitlicher Richtung, sondern auch noch in der Vertikalen spiegelsymmetrisch ist. Tatsächlich folgt der Pianist in seiner Wiedergabe von 1948 dieser Aufforderung überzeugend. Und wenn man Stadlens Interpretation von Schönbergs op. 23 (das letzte Stück, der Walzer, ist das erste offizielle Zwölftonwerk Schönbergs) mit der staubtrockenen, rationalen Aufnahme von Schönbergs eigentlich expressionistischen Sechs kleinen Klavierstücken op. 19 unter den Händen von Eduard Steuermann – seinerseits Widmungsträger der Webernschen Variationen – aus dem Jahre 1957 vergleicht, wundert man sich nicht schlecht über den ästhetischen Wandel des Klavierspiels, der da stattgefunden hat. Wenn Weberns hermetische Kunst einer konsequenten Materialbeschränkung von den „Darmstädtern“ (insbesondere Boulez und Stockhausen) quasi zur Prämisse erklärt wurde, so war der Weg zur seriellen Musik unaufhaltsam. Dass diese dann (Ligeti erklärt dies bereits in einem frühen Aufsatz mit unweigerlich auftretender Entropie) irgendwie immer „gleich“ klingt, führte sehr schnell – bereits ab 1955 – zu einer Abkehr von simpler Reihentechnik, aber dafür zu noch komplexeren Ableitungen des Ausgangsmaterials unter dem Gesetz der Zahl – teilweise aber bereits unter Einbeziehung von Zufallsentscheidungen, die man in Darmstadt durch John Cage kennengelernt hatte. Auf CD2 finden sich hintereinander gleich zwei Schlüsselwerke dieser Periode: Karlheinz Stockhausens Klavierstück XI (gespielt vom legendären David Tudor) und Pierre Boulez‘ Troisième Sonate. Letztere ist ein work in progress geblieben; von den fünf geplanten Sätzen – hier: Formanten – sind nur zwei im Druck erschienen (Trope und Constellation/Miroir). Die übrigen Sätze wurden nie fertig. Die vorliegende Aufnahme ist ein ganz besonderes Tondokument, da sie nicht nur die stupenden Fähigkeiten von Boulez auch als Pianist zeigt. Er spielt hier eine vorläufige (bei den unveröffentlichen Formanten noch sehr rudimentäre) fünfsätzige Fassung. Immerhin erscheint es bei der ganzen Gehirnakrobatik hinter dieser Komposition als menschlich, dass selbst der Komponist es nicht schafft, sauber einen Weg durch das von ihm erschaffene Labyrinth zu finden: Boulez lässt – offensichtlich aus Versehen – etliche Wege in Miroir (das später gedruckte eine Notenblatt misst 3,47m x 59,6 cm!) aus, die er eigentlich obligatorisch spielen müsste. Dem oben erwähnten John Cage ist zwar eine eigene CD in der Reihe der Darmstadt Aural Documents gewidmet; in der Klavierbox fehlen aber leider auch die anderen wichtigen Vertreter der New York School (so Morton Feldman oder Earle Brown), die wichtige Bezugspunkte für Darmstadt geliefert haben.
Bei CD2 empfehle ich dringend, den CD-Player auf jeweils ein Werk zu programmieren und dies eventuell mehrfach anzuhören. Beim ersten Hören ist sonst die Gefahr in der Tat groß, sich schon im nächsten Stück – eines anderen Komponisten! – zu befinden, ohne etwas davon gemerkt zu haben. Ob so Werken wie der 3. Boulez-Sonate (über die es ein halbes Dutzend umfängliche Dissertationen gibt) etwas abzugewinnen ist, sei jedem Hörer selbst überlassen.
Es ist interessant, dass gerade das Klavier mit seinem monochromen Klang über die Jahre so wichtig für die Vertreter der seriellen Schiene geblieben ist, obwohl es auch die Schwächen dieses Komponierens mehr als deutlich zu Tage treten lässt. Vielleicht ist das Klavier aber auch – schon als Möbelstück geradezu das Repräsentationsobjekt des Bürgertums – einfach historische Reibungsfläche par excellence; man denke nur an die geradezu genüsslichen Klavierdestruktionen nicht erst der Fluxus-Bewegung.
In Darmstadt hielt man länger als irgendwo sonst an seriellen Konzepten fest. Wer damit nicht konform ging, wurde oft schlicht hinausgeekelt (etwa Hans Werner Henze). So entstand eben nicht nur ein Ort gegenseitiger künstlerischer Befruchtung, sondern auch zerbrochener Freundschaften und unerledigter Diskurse – später etwa um den Begriff einer musikalischen Postmoderne, die manchem von vornherein als regressiv galt. Als selbst Adorno die aktuelle Entwicklung kritisch hinterfragte (in seiner Schrift Vers une musique informelle, 1961), erntete er überwiegend „zementierte“ Reaktionen.
Trotzdem hinterließen auch die „Abweichler“ in Darmstadt unweigerlich ihre Spuren: Als vielleicht typische Beispiele für die musikalische Postmoderne der 70er- bzw. 80er-Jahre höre man z.B. Wolfgang Rihms Klavierstück Nr. 5 „Tombeau“ (Neo-Expressionismus?) und Wilhelm Killmayers Klavierstück Nr. 7 (unverschämter Weise mit tonalen Zitaten, die einzigen in der Box). Nachdem die Postmoderne-Diskussion Anfang der 1990er urplötzlich abbrach, komponierten etliche Jüngere anscheinend ein wenig unbeeinflusster von „Trends“, gerade bei der Klaviermusik allerdings oft in quasi ironisch gebrochener Weise – und auch der „Komplexismus“ ist bis heute keineswegs aus Darmstadt verschwunden.
Ob manche der in der Box vorgestellten Werke nach 1970 irgendwann – und wenn auch nur aus historischen Gründen – Repertoirestücke werden, wird erst die Zeit entscheiden. Lob verdienen auf jeden Fall die Ausführenden: Sowohl die Beispiele virtuoser Entgrenzungen (Xenakis, Boucourechliev, Ferneyhough, Sciarrino, Rothman…) als auch sich solchem verweigernde Gegenpole (Febel, Tanaka, Lang…) werden hier absolut überzeugend dargeboten – nicht von ungefähr darf ein Großteil der hier tätigen Pianisten als creme de la creme bei der Bewältigung Neuer Musik gelten. Wirklich überragend – auch gerade im Vergleich mit späteren Einspielungen – seien stellvertretend Alois Kontarsky mit Xenakis‘ Evryali und Claude Helffer mit Boucourechlievs Six études d’après Piranèse genannt.
Besonderes Augenmerk wurde bei der Auswahl für die Box auch auf solche Werke gelegt, bei denen das übliche Gespann – Pianist(in) plus wohltemperiert gestimmter Konzertflügel – verworfen wird. Hier finden sich einerseits Stücke, die den normalen Tonvorrat in Richtung Mikrotonalität verändern oder erweitern (Roland Kayns Quanten, Jean-Etienne Maries Trois pièces brêves, Pascal Critons Thymes) – andererseits solche, die den Pianisten völlig ignorieren (Player Piano bzw. Computerrealisationen mit und ohne Live-Elektronik bei Barlow und Zuraj) oder aber zusätzliche Aktionen wie Singen oder Sprechen von ihm abfordern (Aperghis, Baltakas). Stockhausens Luzifers Traum oder Klavierstück XIII (1981) ist ja eigentlich auch eine Opernszene: aus Samstag aus »Licht«.
Man sollte hoffen, dass die Quintessenz des Ganzen nicht so schlimm ist, wie sie Steffen Krebber (*1976) in seinem witzigen faire signe (für Automatenklavier und einen Lautsprecher) von 2014 ironisch zu ziehen scheint. Das Stück beginnt – vom Tonband – mit dem Text: „Es lohnt sich nicht zuzuhören, weil spätere Kunst sicher besser sein wird. Bitte verlassen Sie den Saal!“
Aufnahmetechnisch ist die Box nicht zu beanstanden. Der Digital-Transfer gerade auch vieler älterer, monauraler Aufnahmen (beginnend 1948) ist gut gelungen, die zeitüblichen Störungen wurden weitgehend herausgefiltert – bei ein, zwei Aufnahmen war wohl etwas Jitter nicht zu beheben. Einige der Einspielungen zeigen neben ihrem historischen Wert die jeweiligen Interpreten auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Möglichkeiten – zudem hört man gleich drei Komponisten (Boulez, Castiglioni und Lachenmann) in der eher seltenen Rolle als Pianisten mit ihren eigenen Werken. Dass viele der dargebotenen Werke bisher gar nicht in anderer Form auf CD zugänglich waren, spricht alleine schon für eine Kaufempfehlung – allerdings eher nur für hartgesottene Fans moderner Musik. Dies ist alles andere als leichte Kost!
[Martin Blaumeiser, August 2016]