cpo 555 482-2; EAN: 7 61203 54822 4
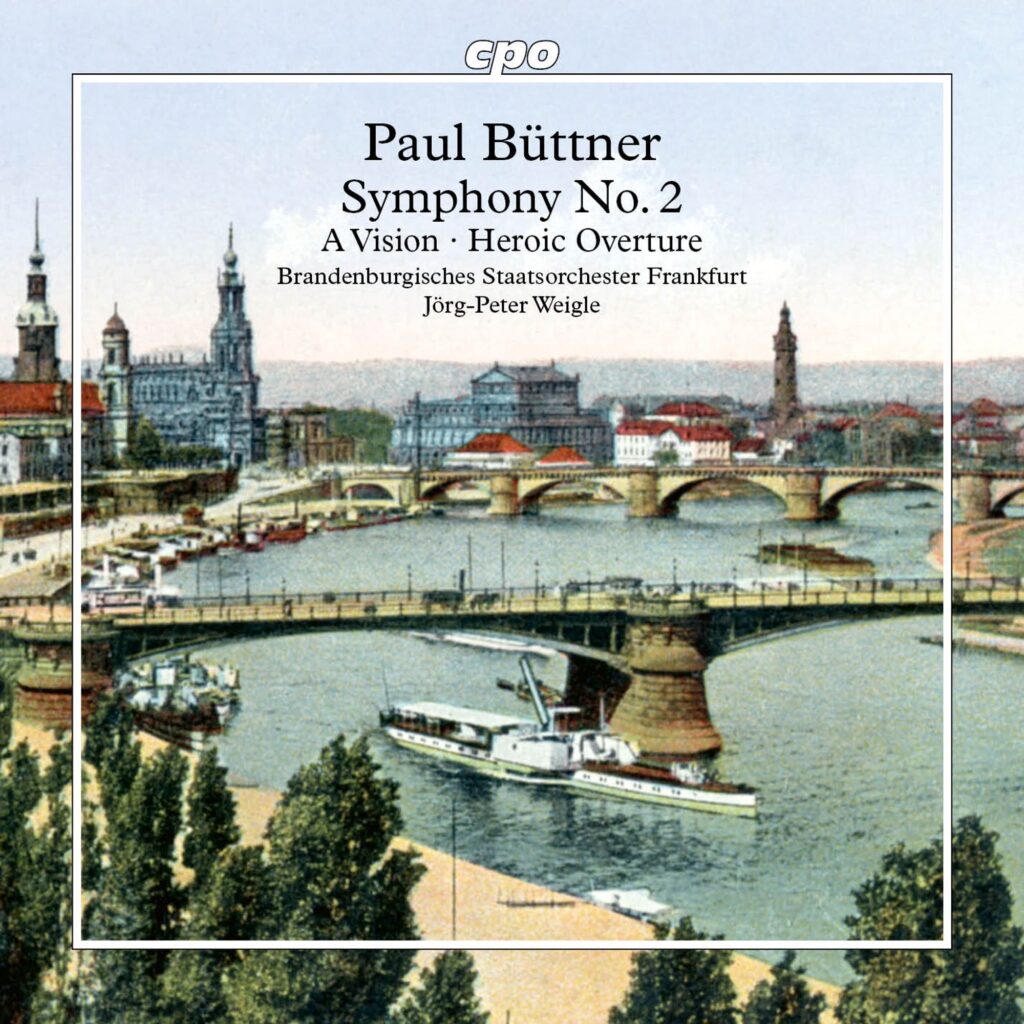
Das Osnabrücker Label CPO stellt drei Orchesterwerke des Dresdner Komponisten Paul Büttner vor. Die zweite seiner vier Sinfonien und die Vision liegen damit erstmals auf CD vor, gekoppelt mit der Heroischen Ouvertüre. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt wird geleitet von Jörg-Peter Weigle.
Zwar dürfte der Name des Komponisten Paul Büttner (1870–1943) den meisten Musikfreunden nach wie vor eher wenig bekannt sein, aber immerhin kann man mittlerweile doch von einer veritablen kleinen Büttner-Renaissance sprechen, die sich im Wesentlichen innerhalb der letzten fünf Jahre ereignet hat. Dass dies ist so, hat sehr viel mit dem Dirigenten, Musikjournalisten und unermüdlichen Initiator musikalischer Entdeckungen abseits der Konventionen Christoph Schlüren zu tun: Schlürens Label Aldilà Records war es, das zunächst seine Triosonate für Streichtrio (mit dem Trio Montserrat) und dann eine Streichorchesterversion seines (einzigen) Streichquartetts herausgebracht hat; beide CDs sind auf dieser Seite besprochen worden. Und erneut Schlüren zeichnet auch für den Begleittext der vorliegenden CPO-Neuerscheinung verantwortlich.
Um einmal mehr in aller Kürze die biographischen Eckdaten zu umreißen: Paul Büttner, geboren und auch verstorben in Dresden, war ein Schüler Draesekes am Dresdner Konservatorium, wo er später (mit Unterbrechungen) auch selbst wirkte, zunächst als Chorgesangslehrer, dann außerdem als Lehrer für Musiktheorie, ab 1918 auch u. a. für Komposition und Orchesterdirigieren und schließlich ab 1924 als dessen künstlerischer Leiter. Seinen relativ späten Durchbruch als Komponist erlebte Büttner 1915 mit der Uraufführung seiner Dritten Sinfonie im Leipziger Gewandhaus unter der Leitung von Arthur Nikisch, zu einem Zeitpunkt also, als er bereits mit der Komposition seiner vierten und letzten Sinfonie begonnen hatte. Sozialdemokrat, in der Arbeiterbewegung engagiert und mit einer jüdischen Pianistin verheiratet, wurde er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten aller Ämter enthoben. Nach dem Krieg wurde sein Schaffen bis zu einem gewissen Grad in der DDR gepflegt, auch auf Initiative seiner Frau Eva, und seine Vierte Sinfonie auf Schallplatte eingespielt. In Westdeutschland hat Büttners Musik nach dem Krieg keine Rolle gespielt, und spätestens seit der Wende, auch in der DDR wohl eher schon etwas früher, ist es still um ihn geworden.
Büttners Schaffen ist nicht sehr umfangreich; die Orchestermusik nimmt darin einen prominenten Platz ein. In ihrem Zentrum stehen vier Sinfonien, von denen allesamt Aufnahmen aus DDR-Zeiten vorliegen. Auf Schallplatte veröffentlicht wurde indes wie erwähnt nur die Vierte Sinfonie, und diese Aufnahme wurde 2001 vom schwedischen Label Sterling auf CD wiederveröffentlicht, nun gemeinsam mit der Heroischen Ouvertüre – lange Zeit der einzige erhältliche Tonträger mit Musik Büttners. Insofern legt CPO mit dem neuen Programm das insgesamt zweite Album mit Orchesterwerken Büttners vor, wobei die Heroische Ouvertüre zum zweiten Mal auf CD erscheint, Präludium, Fuge und Epilog. Eine Vision meines Wissens hier zum ersten Mal überhaupt eingespielt wird und die Zweite Sinfonie ihre Erstveröffentlichung auf Tonträger erfährt – Pionierarbeit also.
Büttners Sinfonie Nr. 2 G-Dur, entstanden 1902, hat Karl Laux als „die frühlingshaft helle unter den vier Geschwistern“ bezeichnet, eine treffende Beschreibung eines in der Tat von heiteren, beschwingten, mitunter geradezu euphorischen Tönen dominierten Werks, das ohne wirklichen langsamen Satz auskommt und fast durchgängig in seiner „hellen“ Grundtonart G-Dur gehalten ist (nur die langsame Einleitung zum Finale sorgt für dunkler getönte Kontraste). Eher ungewöhnlich für ein Sinfonieallegro dabei die Vortragsanweisung „affetuoso“ im ersten Satz, die aber das sich schwärmerisch emporwindende Hauptthema doch passend charakterisiert. Dass Büttner eigentlich weder Brahms noch Bruckner wirklich nahesteht, sondern eher seinem Lehrer Draeseke und, ohne retrospektiv zu wirken, zum Teil deutlich an Beethoven anknüpft, zeigt ganz besonders das kräftig-zupackende Scherzo, während im Trio Büttners volkstümliche Seite zum Tragen kommt. Für die von Laux aufgezeigten Ländler-Anklänge fehlt hier eigentlich der Dreiertakt, ich würde bei der besagten tänzerischen Episode eher an eine kleine Polka denken, auf jeden Fall an eine ländlich-pittoreske Tanzszene, allerdings inmitten eines von erheblichem Momentum vorangetriebenen echt sinfonischen Scherzos.
Das Finale ist hier in der sogenannten „erweiterten Fassung“ eingespielt, wobei nicht völlig klar ist, ob es sich dabei um die Erstfassung oder die Revision des Satzes handelt. Beide Varianten sind denkbar, also eine nachträgliche Straffung oder aber Büttners Absicht, dem nach der langsamen Einleitung folgenden Kehraus-Finale mehr Gewicht zu verleihen. In der Tat lässt das bunte Treiben dieser Introduzione, Variazioni e Finale durchaus an Haydn denken, auch der schon genannte volkstümliche Tonfall scheint immer wieder durch. Dabei ist die Struktur des Satzes tatsächlich nicht unkomplex, denn weder könnte man eine eindeutige Variationenfolge identifizieren noch ein schulbuchmäßiges Rondo: die Konturen vermischen sich, variiert wird hier eigentlich durchgängig. Dabei ist Büttner ein fabelhafter Orchestrator, in aller Regel auf Basis der klassischen Orchesterbesetzung, beim Auftragen von Farben also eher umsichtig und wohldosiert, Effekte wie in den burlesk-humorigen Schlusstakten der Sinfonie sehr bewusst disponierend. Dass die 36 Minuten dieser Sinfonie wie im Flug vergehen (so Schlüren im Beiheft), ist jedenfalls Tatsache, ebenso, dass etliche Themen und Motive dieses Werks so einprägsam geraten sind, dass sie noch lange im Gedächtnis des Hörers ihren Widerhall finden. Eine enorm kurzweilige, vergnügliche Sinfonie, obwohl zugleich so gewichtig, dass man nicht auf die Idee käme, sie in die Nähe eines Divertimentos zu rücken.
Die beiden weiteren Orchesterwerke auf der CD stammen aus den 1920ern, gehören also zu Büttners späten Orchesterwerken (danach folgte nur noch 1937 das Konzertstück für Violine und Orchester). Präludium, Fuge und Epilog. Eine Vision, 1922 komponiert, wurde ursprünglich unter dem Titel Sinfonische Phantasie. Der Krieg konzipiert; man darf das Werk also wohl als künstlerische Reaktion auf den Ersten Weltkrieg deuten, wobei Büttner hier ebenso wie in der Heroischen Ouvertüre allerdings auf konkrete Programme verzichtet hat – allzu direkte Deutungen erscheinen somit wenig angemessen. Dahinter verbirgt sich ein ohne Unterbrechungen gespieltes, psychologisch komplexes Triptychon. Das Werk geht von einer Atmosphäre des Ungewissen, latent Bedrohlichen aus, eine Art langsame Einleitung, die ein kreisendes Motiv vorstellt. Nach einer Weile lichten sich die Nebel, und es ertönt, glänzend orchestriert (hier kann man vielleicht sogar ein wenig ans Richard Strauss denken, mit dem Büttner freilich insgesamt wenig gemein hat), ein forscher kleiner Marsch; die Musik setzt sich sozusagen in Bewegung. Mit der Fuge an zweiter Stelle (ihr Thema greift das kreisende Motiv vom Beginn abgewandelt wieder auf) beginnt das dezidiert konflikthafte Zentrum des Werks. Nach einer Weile scheint die Rückkehr des Marsches eingeleitet zu werden, doch dies erweist sich als Täuschung, vielmehr folgt ein Moment brütend-düsteren Innehaltens, bevor die Fuge wieder beginnt und am Ende doch erneut nur in Agonie mündet. Der kurze Epilog öffnet dann die Tore zu helleren, versöhnlicheren Klängen, vielleicht eine Vision des Friedens in zarten Farben, bevor die letzte Minute des Werks auch dies wieder zurücknimmt und zur fatalistischen Atmosphärik des Beginns zurückführt, inklusive des kreisenden e-moll-Motivs, das das Werk in düsterer Stimmung beendet.
Die Heroische Ouvertüre, 1925 entstanden, ist nicht unbedingt das kämpferische, Heldentaten beschwörende Stück, das der Titel vielleicht suggeriert, sondern eher eine von frischem Optimismus dominierte, wirkungsvolle Konzertouvertüre. Eine kurze Einleitung in c-moll bereitet die Bühne für ein Allegro (in C-Dur), das von einem kraftvoll emporschnellenden Thema beherrscht wird, das gleichzeitig eine gewisse klassizistische Note besitzt und dafür sorgt, dass diese Ouvertüre auf den ersten Blick eventuell als das traditionellste der drei Werke anmuten mag. Gleichzeitig besitzt sie alles, was für Büttner typisch ist, insbesondere die unkonventionelle Behandlung der Form, denn ein klassisches Sonatenallegro ist sie keinesfalls, sondern transformiert ihr Material fortwährend, sodass sich das meiste eben nicht ohne weiteres wiederholt, sondern abgewandelt wiedererscheint oder gänzlich verschwindet (zwar völlig anders geartet, kamen mir dabei Boris Tschaikowskis Bemerkungen zu seiner Sewastopoler Sinfonie in den Sinn, die ihr Material ganz ähnlich einem Prozess fortwährenden Wandels unterzieht). Ich hege nach wie vor den Verdacht, dass es sich bei dem Thema, das in der vorliegenden Aufnahme ab 7:35 erstmals zu hören ist, um ein bekanntes Lied handeln könnte, es gelang mir bislang jedoch nicht, dies zu erhärten; auf jeden Fall aber zitiert Büttner kurz Carl Maria von Webers Lützows wilde Jagd. Bemerkenswert nicht zuletzt die mannigfaltigen motivisch-thematischen Verknüpfungen, die der vermeintlich kaleidoskopischen Anlage der Ouvertüre tatsächlich eine beträchtliche Stringenz verleihen.
Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter seinem (mittlerweile auch schon wieder) ehemaligen Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle liefert solide, routinierte Interpretationen von Büttners Musik. Dabei gelingen die drei Werke durchaus unterschiedlich gut: vergleicht man etwa die Aufnahme der Heroischen Ouvertüre mit der alten Einspielung unter Hans-Peter Frank, so ist Weigles Lesart zwar die „korrektere“ (wohingegen Frank gewisse Kürzungen vornimmt), aber auch die weniger inspirierte. Das Feuer, das Frank etwa zu Beginn des Allegro zu entfachen versteht, findet man bei Weigle nicht, die Streichertremoli, die bei Frank die Musik vorantreiben, wirken hier eher beiläufig. So verliert die Ouvertüre an Spannung und wirkt letztlich blasser, als sie eigentlich ist. Deutlich besser gerät die Vision, vielleicht auch angesichts ihrer offensichtlicheren Dramatik und dunkleren Expressivität. Die Einspielung der Sinfonie bewegt sich zwischen diesen beiden Polen. Gerhard Pflügers alte Aufnahme aus dem Jahr 1951 (der die Neueinspielung natürlich bereits durch ein Mehr als Details aufgrund der wesentlich besseren Klangqualität überlegen ist) ist insgesamt die schwung- und elanvollere, auf der anderen Seite schafft Weigles gesetzteres Tempo u. a. im Trio des Scherzos Raum für ein gemütvolleres Ausloten der Volksmusikepisode, die bei Pflüger etwas gehetzt wirkt.
Schlürens umfänglicher, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe profund informierender und einordnender, die Charakteristika der Tonsprache Büttners eingehend diskutierender Begleittext ist dabei einmal mehr nachdrücklich zu empfehlen. Sehr erfreuliche (Neu-) Entdeckungen von Musik eines Komponisten, von dem man in den kommenden Jahren hoffentlich noch mehr zu hören bekommt – vielleicht ja sogar eine weitgehend komplette Werkschau der Kammer- und Orchestermusik.
[Holger Sambale, November 2025]