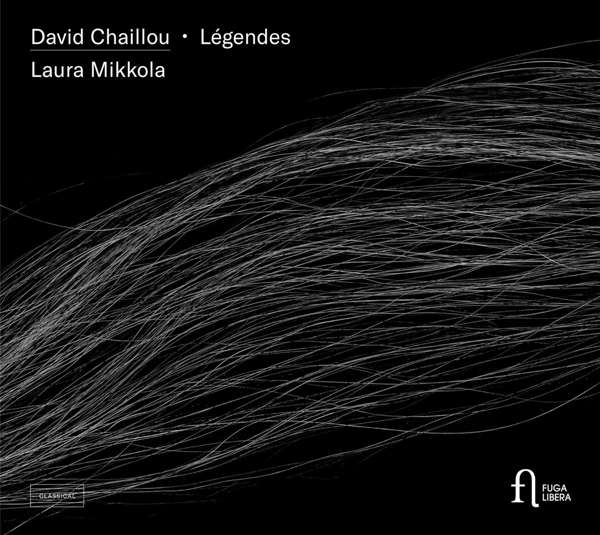Fuga Libera, FUG 831; EAN: 5400439008311
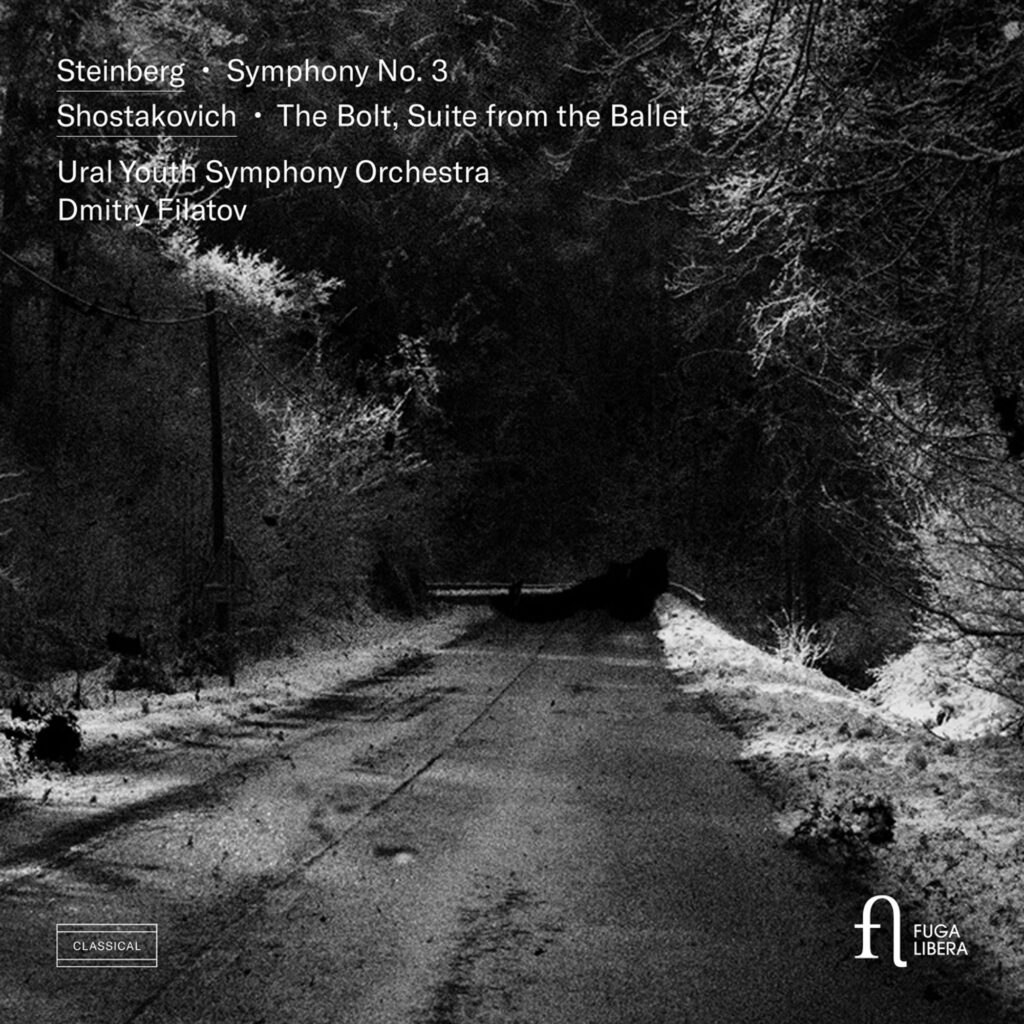
Den Namen Maximilian Steinberg hat wohl jeder schon einmal gehört, der sich mit russischer Musik des frühen 20. Jahrhunderts befasst hat. Man kennt ihn zumindest als Schüler, Schwiegersohn und Herausgeber Nikolai Rimskij-Korsakows, als Mitschüler Igor Strawinskijs und als Kompositionslehrer Dmitrij Schostakowitschs. Dass der 1883 in Vilnius geborene und seit 1901 in Sankt Petersburg ansässige Steinberg zu jenen Persönlichkeiten gehörte, die sich im Zentrum der musikgeschichtlichen Entwicklung Russlands bewegten und dort keine ganz unbedeutende Rolle spielten, lässt sich mithin nicht abstreiten. Zwar konnte Steinberg zu Lebzeiten als Komponist einige Erfolge im In- und Ausland feiern, doch geriet sein Schaffen nach seinem Tode 1946 weitgehend in Vergessenheit. Dass sich sein Schüler Schostakowitsch frühzeitig seinem Einfluss entzogen hatte und Strawinskij nicht gut auf ihn zu sprechen war, da er sich in jungen Jahren in den Augen Rimskij-Korsakows zugunsten Steinbergs zurückgesetzt sah, dürfte in den Nachkriegsjahrzehnten nicht dazu beigetragen haben, das Interesse an Steinbergs Musik zu steigern. Erst in der jüngeren Vergangenheit haben es Einspielungen seiner Werke ermöglicht, sich von seinen kompositorischen Fähigkeiten ein genaueres Bild zu machen – ein Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist, denn eine größere Zahl seiner Hauptwerke wartet bis heute auf ihre Erstaufnahme. Bis vor kurzem zählte noch Steinbergs 1928 vollendete Symphonie Nr. 3 g-Moll op. 18 zu diesen auf Tonträger nicht greifbaren Stücken. Im vergangenen Jahr wurde dies durch das Uralische Jugend-Symphonieorchester (Ural Youth Symphony Orchestra) unter der Leitung von Dmitrij Filatow (Dmitry Filatov) geändert: Sie nahmen die Symphonie gemeinsam mit der Orchestersuite aus Dmitrij Schostakowitschs Ballett Der Bolzen op. 27a für die belgische Musikproduktion Fuga Libera auf.
Steinberg komponierte insgesamt fünf Symphonien. Die ersten beiden entstanden noch vor dem Ersten Weltkrieg, die letzten drei datieren von 1928, 1933 und 1942. Steinberg gehört also, ähnlich dem ungefähr gleichaltrigen Mikolai Mjaskowskij, dem die Dritte Symphonie gewidmet ist, zu jenen Symphonikern, deren Schaffen die Zarenzeit mit der sowjetischen Epoche verknüpft. Von Steinbergs Frühwerk konnte man sich bereits seit der Jahrtausendwende ein gutes Bild machen, da die Göteborger Symphoniker unter Neeme Järvi damals für Deutsche Grammophon zwei CDs mit den ersten beiden Symphonien und weiteren frühen Orchesterwerken aufnahmen. Wenn dieses Projekt als Zyklus geplant gewesen ist, so kann man nur bedauern, dass er nicht vollendet wurde. Erst 2017 erschien wieder eine CD mit Steinbergscher Orchestermusik, als Martin Yates mit dem Royal Scottish National Orchestra für Dutton die Vierte Symphonie Turksib und das Violinkonzert einspielte, und damit erstmals Werke aus Steinbergs sowjetischer Schaffensphase präsentierte. Die nun erstmals aufgenommene Dritte Symphonie markiert in gewissem Sinne einen Wendepunkt in Steinbergs Entwicklung. Die frühen Symphonien stehen zwar fest in der Tradition des Mächtigen Häufleins und Alexander Glasunows und sind entsprechend von Elementen slawischer Folklore durchdrungen, doch sind sie keine folkloristischen Werke im engeren Sinne. Das ändert sich mitten in der Dritten Symphonie, wenn Steinberg, Nachkomme einer jüdischen Familie, dem langsamen dritten Satz das jüdische Volkslied El Yivneh Hagalil als Hauptthema zugrunde legt. Dieses findet auch im Finale Verwendung und darf die Symphonie apotheotisch gesteigert beschließen. In den beiden folgenden Symphonien geht Steinberg diesen Weg weiter und greift auf kasachische bzw. usbekische Volksmelodien zurück. Dass er damit durchaus konform mit den Wünschen der Propagandisten des „Sozialistischen Realismus“ ging, ist ihm in der Musikliteratur wiederholt verübelt worden.
Es scheint unter Musikhistorikern eine Tradition zu geben, Steinberg – der nie ein schlechtes Wort über seinen berühmten Kommilitonen verloren hat – als Kontrastfigur zu benutzen, um zu zeigen, wie großartig Igor Strawinskij ist und welch tristem Schicksal dieser entging. So meint etwa Stephen Walsh (Stravinsky: A Creative Spring), dass sich Steinberg zu einem „langweiligen, respektierten sowjetischen Komponisten und Lehrer“ entwickelt habe. Und für Richard Taruskin (Stravinsky and the Russian Traditions) ist Steinberg ein Komponist, „für den man kein besonderes Interesse entwickeln kann“, anhand dessen sich aber zeigen lasse, wie Strawinskij wohl komponiert hätte, wäre er in Russland geblieben. Er hätte dann nämlich ziemlich genau solche Sachen geschrieben wie Steinbergs Dritte Symphonie. Beim Lesen dieser Zeilen spürt man geradezu die Erleichterung des Autors, dass Strawinkij durch seine Emigration nach Paris darum herum gekommen ist, so etwas schreiben zu müssen…
Aber halt! Die Leute, die sich hier offenbar posthum an Steinberg dafür rächen wollen, dass Rimskij-Korsakow ihn Strawinskij vorzog, vergessen, dass die Begabungen Steinbergs und Strawinskijs, obwohl sie beide der gleichen Schule entstammten, unterschiedlich gewichtet waren und auf unterschiedliche Betätigungsfelder hinzielten. Um es kurz zu sagen: Strawinskij wurde ein Ballettkomponist, der auch Symphonien, Steinberg ein Symphoniker, der auch Ballette schrieb. Man höre sich einmal die jeweils ersten Symphonien beider Komponisten an! Strawinskijs Symphonie op. 1 ist ein gutes Werk in der guten Tradition seiner damaligen Vorbilder Rimskij-Korsakow und Glasunow, die auch in der gleichzeitig entstandenen Ersten Symphonie Steinbergs als Vorbilder erkennbar sind. Aber verglichen mit Steinbergs Symphonie wirkt diejenige Strawinskijs in der Entwicklung der musikalischen Gedanken deutlich weniger souverän, obwohl nach den Regeln auch hier alles korrekt ist. Für Strawinskij, dessen spätere Symphonien aus dem Geist seiner Ballettmusiken geboren sind und ganz anders klingen, war die traditionelle Symphonik ein Lehrbuchstoff, den er als Kompositionsschüler zu bewältigen lernte. Für Steinberg war sie die natürliche Umgebung, in der er sich fühlte wie der Fisch im Wasser. Strawinskij fand seinen Stil, indem er zur symphonischen Tradition in schroffe Opposition ging, aber warum hätte Steinberg mit ihr brechen sollen?
Wie die drei zuvor auf CD erschienenen Symphonien Steinbergs zeugt auch die Dritte von seiner außerordentlichen Begabung als Symphoniker. Mit den klassischen Formmodellen geht er durchweg phantasievoll um. Man höre nur, wie er im ersten Satz die Reprise unmerklich aus der Durchführung herauswachsen lässt und dann das Seitenthema, das in der Exposition als lyrisches Intermezzo erschien, kontrapunktisch über das Hauptthema schichtet und dadurch den Höhepunkt der musikalischen Handlung an eine sehr späte Stelle im Satz verlagert! Das Finale ist als zyklisches Fazit angelegt, wobei Steinberg weniger als acht Minuten benötigt, das mit Zitaten aus den Sätzen 1 und 3 gespickte Geschehen zur Abrundung zu bringen – Längen gibt es bei ihm nicht. Das Hauptthema des Finales ist zudem eine freie Umformung des Volksliedthemas aus dem dritten Satz; ein weiteres Thema, das fugiert verwendet wird, leitet sich deutlich vom Seitenthema des Kopfsatzes ab. In der Partitur stellt Steinberg es dem Dirigenten frei, die zwei Schlusstakte des dritten Satzes zu spielen, oder sie wegzulassen, um das Finale direkt anzuschließen. Dmitrij Filatow hat sich für den Attacca-Übergang entschieden, was der Dramaturgie des Werkes förderlich ist.
Mit Strawinskij verbindet Steinberg sein überragendes Instrumentationstalent. Der Orchesterklang der Dritten Symphonie ist fein abgestuft, farbensatt, konturenscharf und wirkt selbst im Tutti nie dick. An zahlreichen Stellen merkt man, dass man keine Symphonie des 19. Jahrhunderts mehr vor sich hat. Der in dieser Hinsicht „modernste“ Satz ist das Scherzo, ein leichtfüßiges, spielerisches Stück, das nichtsdestoweniger durch die ständigen unregelmäßigen Wechsel von 2/4- und 3/4-Takten recht unruhig wirkt und mit seiner oft kammermusikalisch anmutenden, durch Celesta, Harfe, Triangel und Glockenspiel stark aufgehellten Instrumentation kaum mehr „spätromantisch“ erscheint.
Mit dem dritten Satz kehrt das romantische Pathos freilich in die Symphonie zurück. Wie Steinberg das einfache, in melodischem Moll gehaltene Liedthema in einen durchaus mit Chromatik stark angereicherten Tonsatz einbettet, ohne dass der Charakter des Themas verloren geht und das Ganze harmonisch überladen wirkt, zeugt vom Einfallsreichtum wie vom guten Geschmack des Komponisten. Überhaupt ist Steinberg ein fesselnder Harmoniker: Seine Musik gründet sich auf einfache diatonische Verhältnisse, die er aber durch chromatische Zwischentöne stets interessant zu beleuchten weiß.
Filatow und das Uralische Jugendorchester leisten treffliche Arbeit dabei, diese Symphonie, die man in jeder Hinsicht ein Meisterwerk nennen kann, wieder zum Leben zu erwecken. Auf ihrer CD haben sie das Stück mit einem Werk von Steinbergs Schüler Schostakowitsch gekoppelt: der Suite aus dem Ballett Der Bolzen, das zur gleichen Zeit wie die Symphonie des Lehrers entstand. Musikalisch bietet sie einen starken Kontrast. Auch Schostakowitsch bedient sich folkloristischer Motive, allerdings in derb karikierender, grotesk zuspitzender Absicht, wobei er bewusst mit der Trivialität spielt – Tendenzen, die Maximilian Steinberg fremd waren. Steinberg blieb letztlich ein von den Idealen der vorrevolutionären russischen Musik geprägter Komponist, allerdings einer, der künstlerisch nicht erstarrte und lebenslang seinem Stil neue Seiten hinzuzugewinnen vermochte.
Nach Järvis Einspielungen dauerte es 16 Jahre, bis eine weitere Symphonie Steinbergs auf CD kam. Von dieser bis zur vorliegenden CD waren es immerhin noch sieben Jahre. Möge die Ersteinspielung der Fünften Symphonie Steinbergs, einer Symphonie-Rhapsodie auf usbekische Themen, nicht ähnlich lange auf sich warten lassen!
[Norbert Florian Schuck, September 2025]