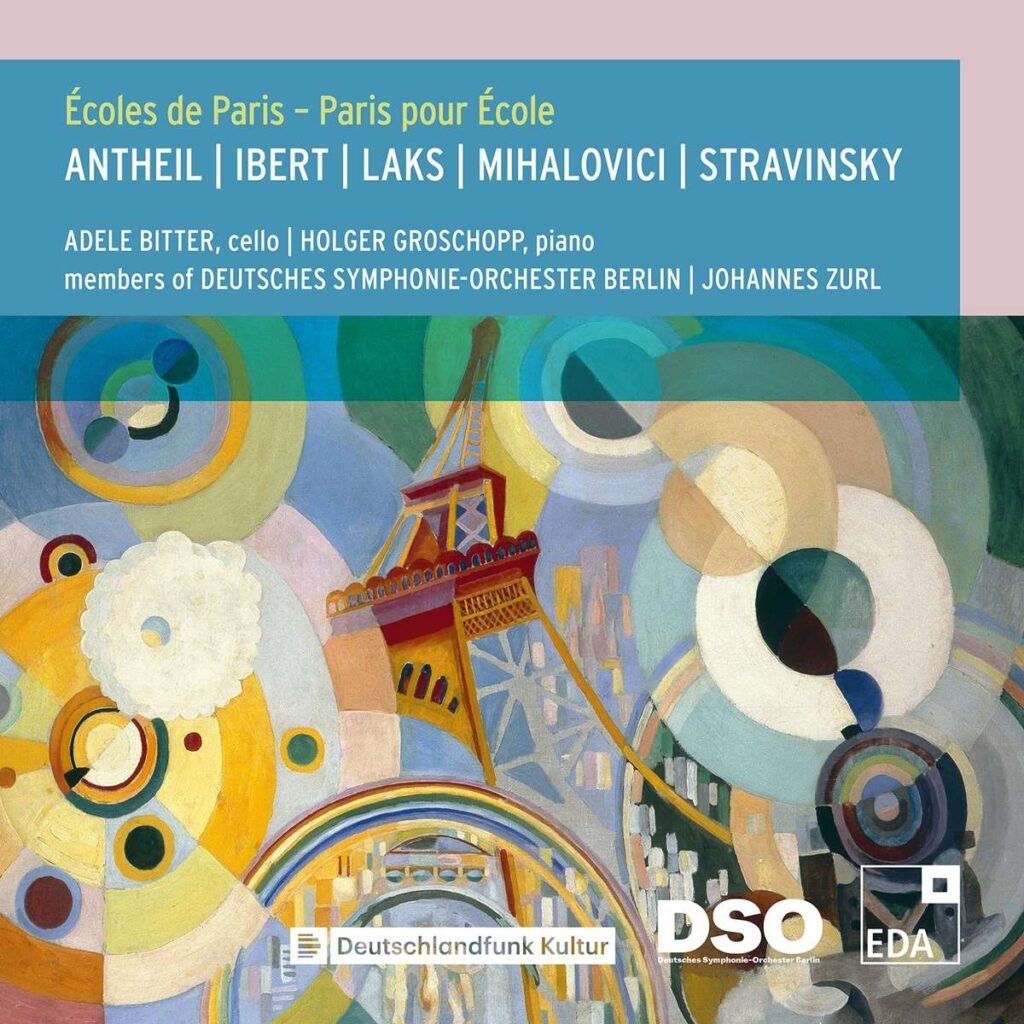Die Schwartzsche Villa in Berlin-Steglitz bot am 12. Juli 2024 den Hintergrund für eine musikalisch-literarische Zusammenkunft besonderer Art. Zwei Namensvettern trafen hier aufeinander, deren Schicksale erstaunliche Parallelen aufweisen, und luden zu einer Reise in die Vergangenheit Mitteleuropas ein, insbesondere derjenigen ihrer Heimat Böhmen: der Komponist Hans Winterberg (1901–1991) und Wenzel Winterberg, die Titelfigur des 2019 erschienenen Romans Winterbergs letzte Reise von Jaroslav Rudiš. Von Hans Winterberg erklangen drei Kammermusikwerke, vorgetragen von den Mitgliedern des Adamello Quartetts – Clemens Linder und Byol Kang (Violinen), Susanne Linder (Viola), Adele Bitter (Violoncello) – und dem Pianisten Holger Groschopp. Dazwischen las Jaroslav Rudiš ausgewählte Kapitel aus seinem Roman.
Hans Winterberg galt nach seinem Tode lange Zeit als ein weitgehend vergessener sudetendeutscher Komponist. Von seinen Werken war nichts im Druck greifbar, auch gab es keine kommerziellen Einspielungen. Nur durch eine Anzahl von Mitschnitten im Archiv des Bayerischen Rundfunks konnte man sich einen Eindruck von Winterbergs Musik verschaffen. Der künstlerische Nachlass lagerte, für die Öffentlichkeit unzugänglich, im Sudetendeutschen Musikarchiv in Regensburg. Den Anstoß zur Entdeckung Winterbergs gab Peter Kreitmeir, der Enkel des Komponisten, der ohne Kontakt zu seinem Großvater aufgewachsen war und sich 2010 auf dessen Spuren begab. Die Nachforschungen gerieten zu einer Archäologie böhmischer Kulturgeschichte, denn nicht nur wurde deutlich, dass Hans Winterbergs kultureller Hintergrund deutlich vielgestaltiger war als zunächst angenommen, auch kam ein Lebenslauf zum Vorschein, in welchem die Umbrüche des 20. Jahrhunderts deutliche Einschnitte hinterlassen haben.
Will man Hans Winterberg einer Nationalität zuordnen (er selbst hielt davon nicht viel und nannte „Nationalität“ einen „verqueren, rückständigen Begriff“), so tut man wohl am besten daran, ihn einen Böhmen zu nennen. In dieser Bezeichnung finden sich seine deutschen, tschechischen und jüdischen Wurzeln gleichermaßen aufgehoben, denn Winterberg war einer jener Böhmen, die deutsch, tschechisch und jüdisch zugleich waren: Er war deutschsprachig, jüdischen Glaubens und fühlte sich als Tscheche. Hans Winterbergs Lebensweg begann im 53. Regierungsjahr des Kaisers Franz Joseph im zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gehörenden Prag und endete in der Bundesrepublik Deutschland kurz nach der Wiedervereinigung. Er erlebte zwei Weltkriege, die Gründung der Tschechoslowakei, ihre Zerschlagung durch die Nationalsozialisten und ihre Wiedererrichtung, den Holocaust, dem mehrere seiner Verwandten, darunter seine Mutter, zum Opfer fielen und dem er selbst nur knapp entkam, und die Vertreibung der Deutschböhmen nach 1945. Da er sich vor dem Krieg als Angehöriger der tschechischen Nationalität hatte registrieren lassen (er schrieb sich selbst damals bevorzugt „Hanuš Winterberg“), blieb ihm die Ausweisung aus seiner Heimat erspart, doch verließ er die Tschechoslowakei bereits 1947 in Richtung Bayern, wo er sich als Lektor beim Bayerischen Rundfunk und als Lehrer am Münchner Richard-Strauss-Konservatorium betätigte.
Von diesem Lebenslauf wusste der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudiš nichts, als er einen Roman entwarf, dessen Protagonist ebenfalls den Namen „Winterberg“ tragen sollte – nach einer Kleinstadt im Böhmerwald nahe der bayerischen Grenze, die heute auf Tschechisch „Vimperk“ heißt. Interessanterweise spielt sich Winterbergs letzte Reise im Jahr 2017 ab, im gleichen Jahr also, in welchem Peter Kreitmeir die alleinigen Nutzungsrechte am Schaffen seines Großvaters, des Komponisten Winterberg, zugesprochen erhielt, woraufhin er die Verbreitung der Musik in die Wege leiten konnte.
Wenzel Winterberg, die Titelfigur von Rudišs Roman, ist kein Komponist, sondern ein Berliner Straßenbahnfahrer im Ruhestand, der als Deutschböhme in Reichenberg (Liberec) zur Welt kam. Zu Beginn der Romanhandlung ist Winterberg bereits 99 Jahre alt. Da nach einem schweren Schlaganfall sein Tod erwartet wird, stellt seine Tochter den Altenpfleger Jan Kraus ein, der sich darauf spezialisiert hat, Todkranke bei ihrer „Überfahrt“, wie er es nennt, zu begleiten. Doch als Kraus beiläufig erwähnt, aus Winterberg, Vimperk, zu stammen, kommt Winterberg ins Leben zurück und fühlt sich bald gesund genug, zu einer Reise nach Tschechien aufzubrechen, wohin er nach seinem Militäreinsatz im Zweiten Weltkrieg nicht mehr zurückgekehrt war. Kraus, Sohn eines deutsch-tschechischen Elternpaars und als junger Mann nach traumatischen Erfahrungen und einem Aufenthalt im Gefängnis ausgewandert, begleitet ihn widerwillig, obwohl er sich vorgenommen hatte, nie wieder seine alte Heimat zu betreten. Ein großer Teil der Handlung spielt sich in Zügen und auf Bahnhöfen ab. Winterberg will die Stätten seiner Jugend sehen, aber auch Orte besuchen, an denen sich einschneidende Ereignisse der Geschichte abgespielt haben: „Die Schlacht bei Königgrätz geht durch mein Herz“, lautet der erste Satz des mitten in der Handlung beginnenden Romans. Letztlich soll die Reise bis nach Sarajewo führen, nicht nur der fatalen Ereignisse von 1914 wegen, sondern auch weil Winterberg von dort das letzte Lebenszeichen seiner Jugendliebe Lenka, die als Jüdin vor den Nazis hatte fliehen müssen, erhalten hat. Kraus spricht nicht viel, doch da er der Ich-Erzähler des Romans ist, erhält man Einblick in seine Gedanken. Aus seiner Perspektive erlebt man die „historischen Anfälle“ mit, die Winterberg regelmäßig während der Reise heimsuchen. Sie äußern sich in geradezu manischen Rezitationen aus dem Baedeker-Reiseführer für Österreich-Ungarn von 1913, den Winterberg als seine „Bibel“ stets mit sich führt, sowie in ausgiebigen Kommentaren zum dort Geschriebenen. Dabei verschwimmen die weltgeschichtlichen Begebenheiten mit Winterbergs Biographie und dem Alltagsleben der Vor- und Zwischenkriegszeit. Die Gegenwart wird immer wieder an der Geschichte gespiegelt, nicht nur im Hinblick darauf, welche Gebäude aus früherer Zeit noch vorhanden sind, sondern auch hinsichtlich der Lebensgewohnheiten der Menschen, dargestellt etwa in Exkursen über Wirtshäuser, böhmisches Bier und die länderübergreifende Küche der alten Doppelmonarchie. Die Eisenbahn ist als Lebensader der Zivilisation permanent präsent: Die beiden Hauptfiguren sind ständig mit dem Zug unterwegs und begeben sich dabei wiederholt auf Abschweifungen – etwa nach Vimperk; auch kommt Winterberg in seinen historischen Anfällen immer wieder auf die Eisenbahn zu sprechen und erzählt von interessanten Begebenheiten wie der Lokomotivflucht der Sachsen während des Deutschen Krieges 1866 nach Eger; ein unausgesprochenes Motiv für die Reise ist Winterbergs gescheitertes Lebensprojekt, die Geschichte Mitteleuropas in einer Modelleisenbahnanlage darzustellen.
Winterbergs letzte Reise ist literarische Archäologie. Nach und nach wird nicht nur die Vergangenheit freigelegt, es entsteht auch ein Bewusstsein für ihre einzelnen Schichten, die sich ineinander verschachtelt haben und nun, ausgegraben, in direkte Beziehung zueinander und zur Gegenwart treten. So werden die Grenzen von Raum und Zeit neu gezogen, Vergessenes und Verdrängtes kommt wieder zu Tage, das Individuum erlebt sich als Teil des großen Zusammenhangs, als mitwirkender Akteur wie als als machtloses Subjekt der Geschichte.
Vorgetragen wird das alles in einem Stil, den man durchaus musikalisch nennen kann. Sowohl Winterberg als auch Kraus haben ihre feststehenden Wendungen, die den Roman refrainartig durchziehen, wobei sich die Sprache gerade in Winterbergs Monologen zu einer Beharrlichkeit steigert, die in ihrer Intensität an Thomas Bernhard gemahnt. Die aufgestaute Spannung löst sich allerdings immer wieder in komischen Situationen, die sich aus der Verschiedenheit der beiden Hauptcharaktere und ihren Kommunikationsproblemen ergeben. Viele Stellen des im Grunde sehr ernsten Buches – einmal schimpft Winterberg demonstrativ auf den böhmischen Humor –, geraten dadurch zu humoristischen Kabinettstücken.
Jaroslav Rudiš, der den Roman original in deutscher Sprache verfasst hat, las insgesamt fünf Kapitel vor, die sich über den ganzen Verlauf des Buches verteilen. Die Lesungen alternierten mit drei Kammermusikwerken Hans Winterbergs: der Sudeten-Suite für Klaviertrio, der Sonate für Violoncello und Klavier und dem als „Symfonie [sic] für Streichquartett“ bezeichneten Streichquartett Nr. 1. Das letztere Werk gelangte dabei zu seiner Uraufführung. Zu Lebzeiten des Komponisten war keine öffentliche Darbietung zustande gekommen. Nach seinem Tode ging die letzte Seite des Manuskripts verloren, weswegen Toccata Classics in seiner 2023 erschienenen Einspielung der Streichquartette Winterbergs auf dieses Stück verzichten musste. Vor kurzem tauchte allerdings die verschollene Seite inmitten anderer Papiere wieder auf, sodass einer Aufführung der „Quartett-Symfonie“ nichts mehr im Wege stand.
Hans Winterbergs Musik harmonierte erstaunlich gut mit Rudišs Erzählung. Ebenso wie dort ist in den Werken des Komponisten ein nervöser Unterton zu spüren, der in dissonanten Umkreisungen der tonalen Zentren und dem häufigen Einsatz ostinater rhythmischer Formeln seinen Ausdruck findet. In den raschen Sätzen des Streichquartetts und der Cellosonate, insbesondere dem toccatenartigen Finale der letzteren, liegt auch die Assoziation mit einer Zugreise gar nicht so fern. Und wie der literarische Winterberg in die Geschichte Böhmens eintaucht, so erscheint der Komponist gleichen Familiennamens als ein fest in der tschechischen Musiktradition verwurzelter Künstler. Die Sudeten-Suite erscheint mit ihren romantischen Topoi als ein eher untypisches Werk im Schaffen Hans Winterbergs. Allerdings wird gerade an diesem Stück seine Verbindung mit der Musik des 19. Jahrhunderts, insbesondere Bedřich Smetana, deutlich. Fluktuierende Klangflächen scheinen auf das Waldesrauschen Aus Böhmens Hain und Flur zu verweisen und die im letzten Satz dargestellten Elbe-Quellen ähneln kaum zufällig den Quellen der Moldau. Dieses Rauschen, diese landschaftlichen Töne gehören wie die Liebe zu tänzerischen Rhythmen zum Grundrepertoire der musikalischen Ausdrucksweise Winterbergs, auch wenn sie in den meisten seiner Kompositionen dissonant geschärft auftreten und sich mitunter in urban-mechanische Klänge verwandeln. Aber auch, wenn er die böhmische Landschaft verlässt, verleugnet er seine Herkunft nicht, nur wechselt das Idiom vom slawischen Tanz zum modernen Tanz der 1920er Jahre, von den Fluren Tschechiens zu den impressionistischen Landschaften der damaligen französischen Musik. In jedem der drei Werke, die sämtlich vorzüglich wiedergegeben wurden, präsentierte sich der Komponist von einer etwas anderen Seite. Das Streichquartett ließe sich als expressionisch, die Cellosonate als klassizistisch mit deutlichen expressionistischen Untertönen charakterisieren, wohingegen die Trio-Suite an nationalromantische Vorbilder anknüpft. Insofern bot der Abend auch einen guten Überblick über die stilistische Vielseitigkeit Hans Winterbergs.
Die gut besuchte Veranstaltung fand beim Publikum sichtlich Anklang, und man kann wohl sagen, dass alle Zuhörer, ob sie nun ursprünglich wegen der musikalischen oder der literarischen Komponente des Abends den Weg in die Schwartzsche Villa eingeschlagen hatten, von dieser Spurensuche in der Geschichte Böhmens bereichert zurückgekommen sind.
Jaroslav Rudiš: Winterbergs letzte Reise, 3. Auflage, München: btb Verlag, 2021, 544 Seiten. ISBN 978-3-442-71967-9
[Norbert Florian Schuck, Juli 2024]