eda records, EDA 55, EAN: 8 40387 10055 5
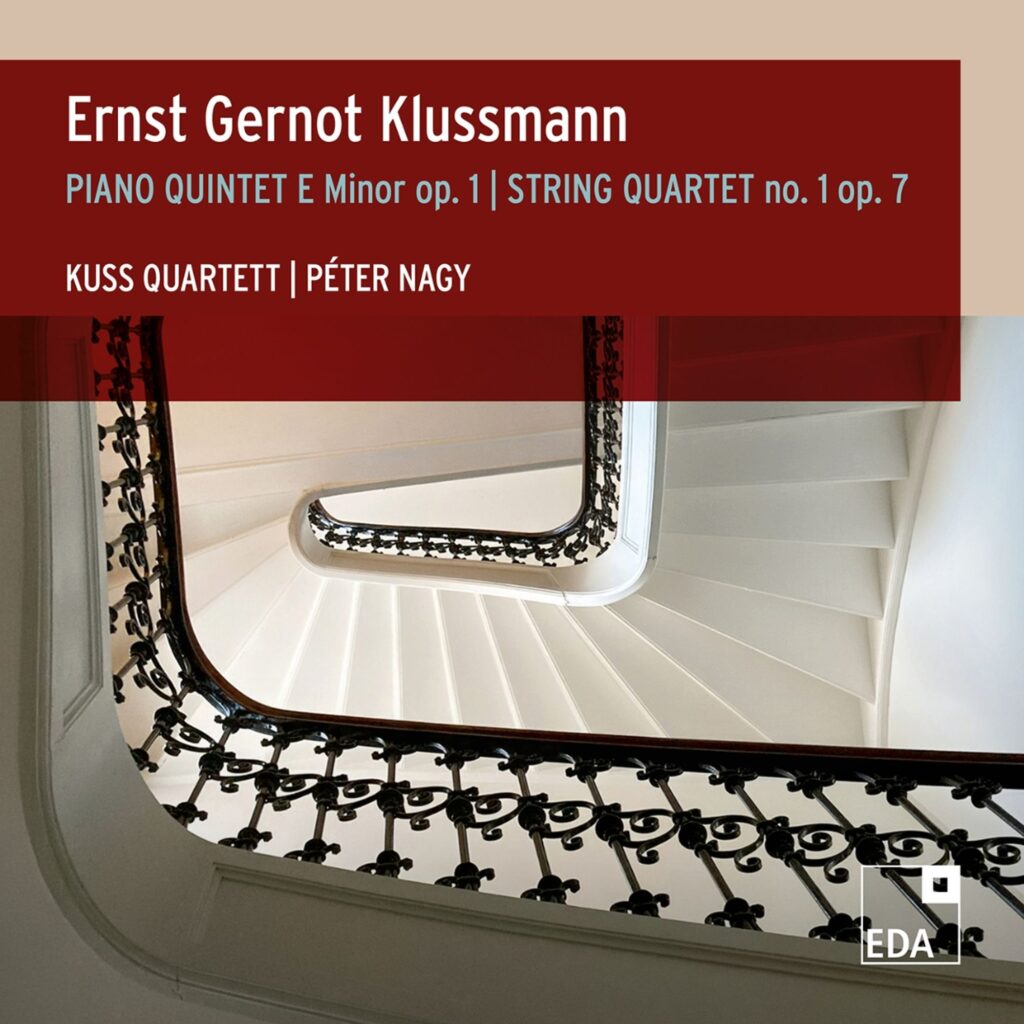
Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ruft die vorliegende Produktion mit dem Komponisten Ernst Gernot Klussmann (1901–1975) einen der Gründerväter der Institution in Erinnerung. Vorgestellt werden zwei frühe Kammermusikwerke, es spielen das Kuss-Quartett und der Pianist Péter Nagy.
Mit der vorliegenden Neuerscheinung des immer wieder mit musikalischen Pioniertaten aufwartenden Labels eda records – vormals unter dem Namen Edition Abseits bekannt – erlebt die Musik des Komponisten Ernst Gernot Klussmann ihre Premiere auf Tonträger. In der Tat: weder scheint es zu Lebzeiten Klussmanns zu einer Schallplattenproduktion gekommen zu sein, noch hat es bislang irgendeines seiner Werke in eine Anthologie oder dergleichen geschafft. Echtes Neuland also, und bereits ganz grundsätzlich einmal mehr ein Beleg dafür, welch unerhörte Fundgrube die Musik des 20. Jahrhunderts doch bietet mit einem schier überreichen Angebot an Könnern, deren Musik schlicht nicht wahrgenommen wird – in krasser Antithese zur nach wie vor verbreiteten Mär von der Begrenztheit des Repertoires der klassischen Musik.
Klussmann, geboren 1901 in Bergedorf, das damals noch nicht zu Hamburg gehörte, studierte zunächst privat Komposition und Orgel bei Felix Woyrsch (dessen Schaffen in den letzten Jahren erfreulicherweise an Aufmerksamkeit gewonnen hat) sowie Klavier u. a. bei Ilse Fromm-Michaels, selbst Komponistin. Anschließend zog es Klussmann an die Münchener Akademie der Tonkunst, wo er bei so eminenten Musikerpersönlichkeiten wie Joseph Haas (Komposition) und Sigmund von Hausegger (Dirigieren) studierte. Nach dem Abschluss seiner Studien 1925 fand er seine erste feste Anstellung in Köln und unterrichtete dort zunächst an der Rheinischen Musikschule und später an der Hochschule für Musik.
Zurück nach Hamburg ging er 1942, als das dortige Vogt’sche Konservatorium in eine Musikschule umgewandelt wurde, aus der dann eine Musikhochschule hervorgehen sollte. Die Leitung dieser Musikschule übernahm Klussmann. Da er 1933 in die NSDAP eingetreten war, wohl vorwiegend zum Schutz seiner Familie (seine Musik war in entsprechenden Kreisen bereits vorher als „entwurzelte Kunst“ bezeichnet worden), wurde er 1945 entlassen, 1948 nach langwierigen Berufungsverfahren jedoch wieder als Direktor eingesetzt. Als 1950 schließlich die avisierte Musikhochschule gegründet wurde, wurde Klussmann ihr stellvertretender Direktor und Professor für Komposition, was er bis zu seiner Pensionierung 1966 blieb. Er starb 1975 in Hamburg.
Sein Werkverzeichnis nennt 56 Opuszahlen, darunter nicht weniger als zehn Sinfonien; Vokalmusik spielt ebenfalls eine wichtige Rolle mit fünf Opern sowie Kantaten, Chorwerken und Liedern, zusätzlich Musik für Klavier und Orgel. Spätestens im letzten Jahrzehnt seines Lebens erlangte seine Musik kaum noch Beachtung: wie das Beiheft ausführt, verband Klussmann mit der Rundfunkausstrahlung seiner Sinfonie Nr. 6 op. 39 (1964) die Hoffnung auf eine Aufführung seiner mit der Sinfonie verwandten Oper Rhodope, aber letztlich ohne Erfolg: seine sämtlichen größer besetzten Werke der letzten Jahre blieben unaufgeführt. Ironischerweise gehörten private Rundfunkmitschnitte ebendieser Sinfonie bislang zu den wenigen Möglichkeiten, sich mit seiner Musik überhaupt zu befassen.
Das vorliegende Album stellt zwei Kammermusikwerke aus Klussmanns frühem Schaffen vor – in der Tat scheint sich seine Kammermusik ganz generell auf die ersten zwei Dekaden seiner kompositorischen Laufbahn zu konzentrieren. Mit dem Klavierquintett e-moll op. 1 begegnen wir Klussmanns überhaupt erstem „offiziellen“ Werk, entstanden 1925 wohl als Abschluss seiner Studien. Ein ambitioniertes, passioniertes, ausdrucksmächtiges Stück, dessen viersätzige Gliederung nicht von ungefähr an eine Sinfonie gemahnt, wahrhaft „orchestrale“ Kammermusik. Wie für ein Erstlingswerk nicht ungewöhnlich, orientiert sich Klussmann dabei relativ deutlich an spät- bis spätestromantischen Vorbildern, ohne sich allerdings in der Totalen einem bestimmten Komponisten oder einer spezifischen Richtung anzuschließen.
Das Hauptthema des 1. Satzes, vorgestellt von der 1. Violine, ist insofern für Klussmann eher untypisch, als dass es sich um eine auf relativ gängigem romantischem Vokabular aufbauende längere Melodielinie in erzählendem Tonfall handelt – bei einem Komponisten, dessen Musik bereits hier eher von kurzen, prägnanten Motiven geprägt ist. Das so beginnende Allegro impetuoso macht seinem Namen alle Ehre, geprägt von wuchtigem, vollgriffigem Klaviersatz und kraftvollen Repliken der Streicher sowie einem stark ausprägten Interesse an Kontrapunktik. Mir kam wiederholt das Heine-Zitat in den Sinn, das Hans Pfitzner seinem eigenen Erstling, der Cellosonate fis-moll op. 1, vorangestellt hat: „Das Lied soll schauern und beben“. Pfitzners Musik selbst hat dabei eher im zweiten Satz, einem intensiven, schwerblütigen Adagio in Des-Dur, ihre Spuren hinterlassen, wobei es auch hier an Momenten dramatischer Zuspitzung nicht mangelt.
Beinahe dämonisch mutet das folgende kurze Scherzo mit seinem von übermäßigen Dreiklängen durchzogenen Hauptthema an, die stampfende Dreierrhythmik ruft Bruckner in Erinnerung. Das ausgedehnte Finale beginnt mit einem fast hymnisch anmutenden Motiv, aus dem sich wiederum ein dezidiert kämpferischer Satz entwickelt mit (in der Thematik) noch relativ stark durch barocke Vorbilder geprägten polyphonen Elementen. Zwei Dingen gilt besonderes Augenmerk. Zum einen ist dies die Rolle der Tonarten, denn das Finale ist auch insofern ein sehr bewusst konzipierter Schlusspunkt, als dass man allen drei tonalen Zentren des Werks (e, des und c) wiederbegegnet – dem Des-Dur des 2. Satzes vor allem in einem lyrischen Seitengedanken, aber speziell e und c tragen untereinander im Laufe des Satzes ein veritables Gefecht aus. Eigentlich ist von Beginn an unklar, welches der definitive Grundton ist, denn schon das C-Dur des Beginns moduliert sehr schnell nach E-Dur, und ähnlich geht es weiter. Faktisch wird überhaupt erst mit dem Schlussakkord C-Dur als tonales Zentrum etabliert!
Zum anderen kristallisiert sich im Laufe des Satzes ein rhythmisches Dreitonmotiv heraus (eine fallende große Terz), das immer wieder insistierend ins Geschehen eingreift und den spätromantischen Rahmen durchaus ein wenig sprengt; man könnte hier fast etwas an Schostakowitsch denken, wobei natürlich nicht klar ist (und auch keine wesentliche Rolle spielt), ob Klussmann den jungen sowjetischen Komponisten zu diesem Zeitpunkt überhaupt kannte. Ähnliches tritt übrigens bereits im 1. Satz auf, wo sich aus der Exposition heraus ebenfalls eine dezidiert rhythmische Figur entwickelt, die die Musik vorantreibt.
Insgesamt erlebt man in diesem Werk zwar noch nicht den reifen Klussmann, und man könnte es mit einigem Recht für etwas überladen halten (weniger in der zeitlichen Ausdehnung von knapp 35 Minuten als eher in der stetigen Forcierung des Ausdrucks und seinem massiven Satz). Nichtsdestoweniger kann man Sigmund von Hauseggers Lob anlässlich der Uraufführung, als er insbesondere die „selbstständige, geistvolle Art, in der hier seine recht musikantischen, eigenwüchsigen Einfälle ineinanderfügt“, hervorhob, ausdrücklich zustimmen: ein Werk, das viel Interessantes und Verheißungsvolles enthält.
Entstanden in den Jahren 1928 bis 1930, ist das Streichquartett Nr. 1 op. 7 prinzipiell nur wenig jünger als das Klavierquintett. Und doch begegnet man in diesem Werk einem wesentlich veränderten Klangbild, einer viel raueren, herberen, lakonischeren, schlicht „moderneren“ Tonsprache, in mancher Hinsicht nicht untypisch für deutsche Musik der 1920er Jahre, wiederum allerdings ohne sich einem konkreten Vorbild anzuschließen. Gleich das Duett zwischen 1. Violine und Cello am Beginn lässt aufhorchen: Doppelgriffe im Bass, oftmals in Form paralleler Quinten, darüber in der Violine eine melodische Bewegung, die wie ein Fragment aus einer Gesangslinie anmutet, vielleicht sogar einem Chanson, einem Schlager, aber verfremdet und gleichsam aus der Distanz betrachtet. Hier und da wird cis-moll als Haupttonart des Quartetts angegeben; dies ist aber eher approximativ zu verstehen: es gibt nur wenige Passagen, in denen diese Tonart wirklich in aller Klarheit das Geschehen bestimmt, nicht einmal am Beginn. Mindestens frei- und teilweise polytonal ist das Quartett eigentlich durchgehend, stellenweise eigentlich fast schon atonal.
Sowohl für expressive Steigerungen als auch (sehr nachdrücklich, wie übrigens sein gesamtes Schaffen hindurch) für Kontrapunktik interessiert sich Klussmann nach wie vor, nun aber bewusster disponiert. So kommt es im Laufe des 1. Satzes (der zur Gänze im Adagio-Tempo gehalten ist) zwar zu beinahe gewaltsamen, scharf dissonanten Zuspitzungen, aber ebenso typisch ist das ruhige Brüten, in das die Musik immer wieder zurückfällt, und ebenso sehr wie dichte Polyphonie findet man hier auch karge, lediglich zweistimmige Passagen. Und wiederum leitet Klussmann aus dem Gesangsmelos des Beginns ein rhythmisches Motiv ab, aus dem Spannungen gewonnen werden und das die Musik formt.
Das Allegro an zweiter Stelle ist knapp gehalten, Musik erfüllt von flüchtiger Unruhe mit leicht groteskem Einschlag, geprägt von federnder, raschelnder Rhythmik, die in einen ambivalent-bitonalen Schlussakkord mündet. Dass der Marsch an dritter Stelle im 7/4-Takt gehalten ist und somit schon per definitionem „hinkt“, merkt bereits das Beiheft an. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, denn selbst der 7/4-Takt wird eigentlich stets verunklart (etwa durch die Cellobegleitung, die passagenweise doch wieder einen Trochäus suggeriert), sodass man hier zwar allerhand Marschgesten begegnet, aber nie einem Metrum, das wirklich Fuß fasst, und die schneidig-punktierte Rhythmik eine Aura der Unklarheit umgibt. Der mit Fantasia überschriebene vierte Satz ist weniger langsamer Satz als in seinen Eckteilen Monolog, Rezitativ der Viola, im Mittelteil manifestieren sich Erinnerungen an den Marsch, und am Ende mündet die Musik in einen leicht verfremdeten, von einem Moment der Trauer erfüllten b-moll-Akkord.
Freundlicher dann das Finale: hier scheint es, als sei hinter den polyphonen Strukturen eine Art Volksweise verborgen, die allerdings niemals in aller Deutlichkeit in Erscheinung tritt, sondern eher als Idee im Hintergrund präsent ist, immer wieder anklingt, aber doch im Ungefähren bleibt. Was schließlich sehr explizit in Erinnerung gerufen wird, ist der 1. Satz (und ich würde davon ausgehen, dass man bei näherer Betrachtung noch mehr Binnenbezüge im ganzen Quartett finden wird), und ganz am Schluss steht wiederum affirmatives C-Dur – also die gleiche Tonart wie am Ende des Klavierquintetts, zwar auf ganz unterschiedlichem Wege erreicht, aber bei näherer Betrachtung dann doch wieder mit gewissen Parallelen. Ein starkes, nachhaltig in Erinnerung bleibendes Quartett, aus dem ich noch einmal ganz besonders den Kopfsatz hervorheben möchte.
Klussmann galt übrigens insbesondere als Bewunderer der Musik Gustav Mahlers, dem er später zu Beginn seiner 1950 komponierten Sinfonie Nr. 5 cis-moll op. 30 denn auch eine ziemlich unmittelbare Referenz erwiesen hat. Mit Mahlers Schaffen hat sich Klussmann bereits in den 1920er Jahren auseinandergesetzt, und insofern ist interessant, dass beide Werke auf dieser CD eigentlich nicht zwingend an Mahler denken lassen. Erst auf den zweiten Blick erkennt man gewisse Parallelen (in der expressiven Glut etwa des 1. Satzes des Quartetts, in der Ironie mancher Passagen, das Beiheft weist zudem auf das ausdrucksorientierte Wesen der Polyphonie in Anlehnung an Klussmanns eigene Schriften hin).
Wenn die aktuelle Version des Wikipedia-Artikels zu Klussmann insbesondere seine Verwurzelung in der Spätromantik betont, dann ist dies jedenfalls ein wenig zu relativieren. Für die genannte Sinfonie Nr. 5 trifft dies sicherlich weitgehend zu; wie sie sich in Klussmanns übriges Schaffen aus jener Zeit einfügt, ist aber bereits eine offene Frage: schon das Quartett spricht ja eine andere Sprache, die Xenien für Klavier von 1948 antizipieren die Sinfonie wohl ebenfalls kaum; mehr Werke aus diesen Jahren sind mir leider nicht bekannt. Im Laufe der 1950er Jahre hat sich Klussmann dann intensiv mit der Zwölftontechnik befasst, und hört man Stücke wie die Sechste Sinfonie, Herodias für Alt und Orchester oder die späte, strenge Spiegelfuge (und Choral „Nun bitten wir den Heil’gen Geist“) für Orgel, dann ist dies zwar Musik eines Autors, der seine spätromantischen Wurzeln nicht verleugnet, das Klangbild aber ist doch wesentlich harscher und dissonanter, und man wird ohne Probleme in etwa gleichaltrige deutsche Komponisten jener Zeit finden, deren Musik wesentlich unmittelbarer der Tradition verpflichtet ist (ohne dass dies irgendein Werturteil implizieren würde).
Sehr erfreulich geraten sind die Interpretationen selbst. Mit dem Kuss-Quartett und dem Pianisten Péter Nagy haben sich Musiker zusammengefunden, die Klussmanns Musik mit großem Engagement und Sinn für die expressiven Spannungsfelder und -bögen dieser Musik darbieten. Gerade das Streichquartett ist darüber hinaus auch ein gutes Stück weit eine (allerdings kohärente!) Folge von Charakterbildern, und die Zeichnung all dieser Stimmungen mit all ihren Ambivalenzen, Subtilitäten und Grotesken gelingt dem Kuss-Quartett in vorbildlicher Manier.
Das Beiheft formuliert ein beherztes Plädoyer für Klussmann, wobei ein substantieller Teil auf die Diskussion seiner Rolle im Nationalsozialismus und das anschließende Entnazifizierungsverfahren entfällt. Leider werden die beiden Werke selbst dann eher knapp besprochen: hier gäbe es dem mit dieser Musik natürlich nicht vertrauten Hörer einiges mehr an die Hand zu geben, erst recht, weil das zentrale Argument für die Beschäftigung mit Klussmanns Musik nun einmal die Musik selbst ist. Am Rande notiert sei auch die etwas kuriose Volte im Grußwort des aktuellen Rektors der Hochschule für Musik und Theater Hamburg Jan Philipp Sprick, der es nicht versäumen mag, auch in einem kurzen Text zu Klussmann auf die „Herausforderungen der digitalen Welt“ zu sprechen zu kommen.
Dies, wohlgemerkt, nur ganz am Rande, denn unter dem Strich ist dieses Album nur zu empfehlen. Man darf froh sein, Klussmanns Musik nun endlich auch auf Tonträger erleben zu können, und dies in solch gelungenen Einspielungen. Vielleicht entwickelt sich daraus ja mehr – zu wünschen wäre es.
[Holger Sambale, August 2025]
