In Fortsetzung unseres ersten Beitrags über das diesjährige Festival „Raritäten der Klaviermusik“ im Schloss vor Husum bespricht unser Rezensent die drei Konzerte vom 18.–20. August 2025:
Der schwedische Pianist Roland Pöntinen – schon mehrfach Gast des Husumer Festivals –konzentrierte sich in seinem Klavierabend am 18. 8. auf selten zu hörende Werke der 1890er Jahre. Otilie Suková (1878–1905) war eine Tochter Antonín Dvořáks und spätere Ehefrau seines Meisterschülers Josef Suk. Die Trauer über ihren frühen Tod verarbeitete dieser in seiner berühmten Asrael-Symphonie. Ihre einzigen eigenen Kompositionen, 4 kleine Klavierstücke, hatte Suk notiert; drei davon erschienen 1909 als Zeitschriftenbeilage, das wohl dem Vater gewidmete „Dem teuren Papa“ erst 2018 bei Bärenreiter. Bei Sukovás Humoreske wirkte Pöntinen noch etwas steif, trug dafür die drei übrigen, einfallsreicheren Stücke durchaus mit Feingefühl vor.
Wilhelm Stenhammar (1871–1927) war selbst ein exzellenter Pianist mit einer riesigen „Pranke“ wie Brahms, was man nicht nur seinem 2. Klavierkonzert anmerkt, welches zuletzt wieder gerne von Herbert Blomstedt zur Diskussion gestellt wurde. Die Sonate g-Moll (1890) ist hingegen noch ein Frühwerk, das stark an Brahms (Scherzo) und, unverkennbar im Finale, konkret an Schumanns Sonate in derselben Tonart anknüpft. Nur die Romanza verströmt bereits ansatzweise typisch nordische Melancholie. Pöntinen gestaltete im gesamten Stück die Tempi flexibel, hätte stellenweise aber rhythmisch noch prägnanter sein können. Er brachte die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Themen auf den Punkt, überzeugte gerade bei den lyrischeren Momenten. Nur den vierten Satz begann er deutlich zu laut. Nach Noten spielte er danach drei der späten 18 Klavierstücke op. 72 Peter Tschaikowskys und hinterließ hier einen eher zwiespältigen Eindruck. Sehr geschmackvoll gelang die Berceuse (Nr. 2), über erstaunlich eisernem Rhythmus; allerdings pfuschte Pöntinen schon hier bei schnellen Wechseln in die hohe Lage – manches wirkte zu unpräzise. Der Rhythmus von Tendres reproches (Nr. 3) erschien leicht missverstanden, und bei Scherzo-Fantaisie (Nr. 10) – nach Skizzen zur abgebrochenen 7. Symphonie entstanden und zugegebenermaßen im korrekt gewählten Tempo fast unspielbar schwer – ließ der Pianist manches unter den Tisch fallen, so dass das Stück tatsächlich wie ein vom Komponisten aus einer Orchesterpartitur improvisierter Auszug erklang.
Im zweiten Teil vermochte Pöntinen zum Glück, sich mächtig zu steigern. Richtig gut war schon die Auswahl von je drei Préludes (aus opp. 15 und 16) und Etüden (aus op. 8) Alexander Skrjabins, berückend schön Cécile Chaminades „Les Sylvains“ op. 60. Ihre Faune – in gekonntem, effektiven und harmonisch reichen Klaviersatz – schienen allerdings an diesem Abend eher mit nordischen Trollen Griegs verwandt als in mediterranen Gefilden angesiedelt. Drei der 6 Études op. 111 von Camille Saint-Saëns (Nr. 1; Nr. 4 mit durchdachten Glocken-Illusionen, Nr. 6 über Material aus dem Finale seines 5. Klavierkonzerts) beeindruckten ebenfalls. Zum Höhepunkt wurde jedoch zuvor ein makelloser, bis ins letzte Detail ausgeloteter Vortrag von Claude Debussys frühen Images oubliées: Anschlag, Pedalisierung und Nutzung des Resonanzraumes unter perfekter Kontrolle. Dieses Niveau wurde nochmals mit der ersten Zugabe, Ravels Pavane pour une infante defunté, bestätigt. Pöntinen entließ das Publikum mit seiner Bearbeitung von Vladimir Cosmas leitmotivischem Thema Sentimental Walk (frei nach Satie) aus der Filmmusik zu Jean-Jacques Beineix‘ „Diva“ (1981).
Am 19. August war der einzige heutzutage wirklich „exotische“ Programmpunkt die letzte der sechs Klaviersonaten (g-Moll op. 39, 1806) des Wiener Komponisten Anton Eberl (1765–1807), der anscheinend Schüler W. A. Mozarts war und noch nach dessen Tod der Familie verbunden blieb. Sein auch pianistisch recht anspruchsvolles, dreisätziges Stück nimmt sich bereits mehr Beethoven als seinen Lehrer zum Vorbild und erreicht im ausladenden langsamen Satz fast gleiches Niveau. Das Thema des Finales im 2/4-Takt scheint gar dem Hauptmotiv aus dessen „Sturm-Sonate“ op. 31,2 teils „abgekupfert“ zu sein. Herbert Schuch näherte sich dem tiefsinnigen Werk mit der gebotenen Gelassenheit und enormer klanglicher Sensibilität: Während des gesamten Konzerts wagte er das Risiko, ein Pianissimo bis an die Grenze dessen anzubieten, wo ein Steinway-D überhaupt noch reagiert: faszinierend. Bei der Wiederholung der Exposition des Kopfsatzes baute er ein paar stilistisch korrekte Verzierungen ein und nahm sich auch die Freiheit für ganz kleine formale Eingriffe an Eberls manchmal zu „quadratischer“ Periodenbildung. Dies alles vermochte das Publikum zu begeistern.
Ferruccio Busonis (1866–1924) späte Toccata (Preludio – Fantasia – Ciaccona) von 1922 gilt trotz ihrer relativen Kürze von gut 10 Minuten zu Recht als eines seiner Hauptwerke für Soloklavier: pianistisch vertrackt, harmonisch schon recht kompromisslos und von einer den Hörer geradezu erschlagenden Ausdrucksintensität – eigentlich. Der Komponist gibt zwar keine Metronomzahlen vor, dennoch verfehlte Schuch zum einen in allen Teilen die hier erwartbaren Tempi etwas nach unten und vereitelte so in den schnellen Abschnitten das in Lisztschem Sinne angestrebte Transzendieren kompositorischer und instrumentaler Virtuosität. Zum anderen müsste man sich klarmachen, welche Rollen verschiedene Motive nur wenig später in Busonis Opus summum, der nicht mehr ganz vollendeten Oper Doktor Faust spielen. Das Staccatissimo des Beginns geriet zu weich, das zugleich geforderte Arditamente oder das con calore aufblühende Thema in der Fantasia zu unterkühlt etc. Damit konnten Busoni-Kenner nicht wirklich zufrieden sein.
Ganz hervorragend dann wieder Busonis phänomenale Bearbeitung des Trauermarschs aus Richard Wagners „Götterdämmerung“. Erneut zahlte sich Schuchs Mut zu extrem leisem Spiel bei der Gestaltung einer dynamischen, quasi plastischen Illusion des hier weitgehend düsteren Klangbilds eines riesigen Orchesterapparats aus, wodurch klar modellierte (Leit-)Motive durch flächige Elemente sinnhaft unterfüttert erschienen.
Julius Reubkes (1834–1858) Orgelsonate „Der 94. Psalm“ sowie seine von Umfang und Schwierigkeit her dem Vorbild seines Lehrers Liszt kaum nachstehende Klaviersonate b-Moll entstanden kurz hintereinander Anfang 1857, als sich bereits die damals unheilbare „Schwindsucht“ abzeichnete, die ein Jahr später zum Tod des jungen Komponisten führte. Während die Orgelsonate sich, heute unbestritten, schnell als eine der großartigsten Orgelwerke des gesamten 19. Jahrhunderts herumsprach, geriet die Klaviersonate – da lange nicht mehr in Druck – bald in Vergessenheit und erweckte erst ab den 1980ern wieder das Interesse der Pianisten. Sie gehört aber längst noch nicht zum Standardrepertoire, stand dafür in Husum schon mehrfach auf dem Programm. Leider gelang es Herbert Schuch nicht, an das Niveau der besten Darbietungen des Werkes heranzukommen. Die drei miteinander verbundenen Sätze bilden eine Liszts h-Moll-Sonate vergleichbare bogenförmige Großform mit überbordender Energie. Schon beim Hauptthema des Kopfsatzes nahm Schuch dessen Wucht zu früh heraus, phrasierte die einzelnen Perioden zu deutlich ab. Ähnlich relativierte der Pianist andere Stellen, etwa nur wenig später das più forte e stringendo kurz vor dem quasi recitativo. Natürlich war Schuch den technischen Anforderungen des Werks gewachsen und beeindruckte wieder durch klanglich hervorragende Gestaltung der lyrischeren Momente, so beim choralartigen Seitenthema und durchgängig im Andante sostenuto. Leider folgte er nicht nur im ersten Satz Reubkes vorgeschlagenem Strich, sondern nahm auch im Finale, in dem der Komponist sich fraglos ein wenig wiederholt, einige kleine Kürzungen vor, die in diesem Fall unverzeihlich erschienen. Der Hauptkritikpunkt hier richtet sich jedoch an die Kleinteiligkeit von Schuchs Vortrag, die über größere Strecken laufende Entwicklungen für den Hörer nicht nachvollziehbar machte. Offenkundig unterschätzte der Pianist die Dramatik der gesamten Sonate mit ihrem bis zur Manie gesteigerten Zur-Schau-Stellen noch vorhandenen Überlebenswillens, wo hingegen in der wenig späteren Orgelsonate am Schluss bereits jedwede Hoffnung – die zumindest noch im ansonsten äußerst brutalen Psalmtext steckt – musikalisch negiert wird. So verkaufte er das Stück spürbar unter Wert, was dann selbst die wirkungsvollen Zugaben nicht mehr wettmachen konnten.
Eine wiederum andere Künstlerpersönlichkeit betrat am 20. 8. das Husumer Podium: Aline Piboule. Rein pianistisch mit konventioneller, grundsolider Technik und ohne irgendwelche Allüren, durch Extravaganzen aufzufallen, stellte sie sich ganz in den Dienst der von ihr vortrefflich präsentierten, wirklich weit jenseits des Mainstreams angesiedelten Klavier-Preziosen. Vom ersten Augenblick an erwies sich die Französin als wahre Poetin am Flügel, die es verstand, das Publikum unmittelbar zu fesseln. Cyril Scott (1879–1970) folgte als junger Komponist den französischen Impressionisten, bis hin zur Reanimation barocker Formen wie in der viersätzigen Pastoral Suite. Gerade der Rigaudon mochte manchen Hörer vielleicht an den entsprechenden Satz aus Ravels Le Tombeau de Couperin „erinnern“; tatsächlich ist Scotts Zyklus der ältere. Die für den Briten typischen, zahlreichen Taktwechsel erschweren manchmal, größere Zusammenhänge zu erkennen, was Piboule jedoch geschickt löste. Auffallend ihr hierbei äußerst sparsames Pedal, als wollte sie die Harmonik keinesfalls zusätzlich aufweichen. Schon beim liebenswerten Konzertwalzer Ernst von Dohnányis über ein Thema aus Leo Delibes Ballett Coppelia zeigte sie, dass sie natürlich Pedalisierung optimal einsetzen kann; ein durchaus virtuoses Stück, dafür ohne die Überdrehtheit ähnlicher Bearbeitungen etwa Godowskys oder Schulz-Evlers.
Frank Bridge (1897–1941) kennt man eher als Lehrer Benjamin Brittens als durch seine eigene Musik: wohl der immer noch meistunterschätzte britische Komponist des 20. Jahrhunderts. Dabei ist insbesondere die Kammermusik sensationell (Klavierquintett, 2. Klaviertrio, 4. Streichquartett) und wird über die Jahre immer moderner. Die Three Sketches von 1906 sind noch ganz tonal und absolut romantisch. Piboule erfasste deren Tiefgang perfekt und brachte sämtliche Feinheiten unprätentiös zum Tragen. Mel Bonis‘ (1858–1937) Kammermusik fand zuletzt zunehmend Beachtung auf dem Tonträgermarkt. Dass ihre Klavierwerke genauso anspruchsvoll, zugleich dankbar sind, bewies Aline Piboule mit zwei Beispielen aus einer ganzen Reihe von Stücken, die mythologische bzw. literarische Frauengestalten porträtieren. Ophélia – nachdenklich, mit tollen Klavierfarben, lediglich etwas zu lang – und Desdémona hinterließen einen starken Eindruck.
Der Rezensent hatte immer schon gewisse Probleme mit dem Spätwerk Gabriel Faurés. So begeisterte am Mittwoch allenfalls dessen Barcarolle Nr. 3 von 1885, während die späten Stücke – die 13. und damit jeweils letzten seiner Barcarolles bzw. Nocturnes (1921) – mal wieder langweilten. Keinesfalls die Schuld der Pianistin, die sich mit ein wenig übertriebener Dynamik leider vergebens bemühte, mehr Leben in diese Musik zu bringen. Das Beste kam an diesem Abend zum Schluss, mit Musik der beiden bretonischen Komponisten Guy Ropartz (1864–1955), dessen tolle Symphonien man unbedingt kennen sollte, und einem – wie Albert Roussel – seefahrenden Komponisten: Jean Cras (1879–1932). Dieser brachte es bis zum Konteradmiral und führte immer ein Klavier mit an Bord. In Deutschland noch nahezu unbekannt, sind seine Werke auf dem CD-Label timpani mittlerweile gut dokumentiert. Sehr interessant bei Ropartz‘ Nocturnes Nr. 1 & 3 ist z. B. deren rhythmische Binnenstruktur. So finden sich in beiden Stücken 7er-Rhythmen: In Nr. 1 im 7/4 bzw. 21/8-Takt (=7×3); Nr. 3 steht durchgehend im 21/16-Takt (=3×7) – auch sonst großartige Musik. Cras‘ Deux Paysages spielen mit Exotismen (I) bzw. einer von Tempo und Agogik ungemein flexibel behandelten, eingängig schlichten Melodie (II). Für diese Werke ist sicherlich noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten. Piboule traf mit ihren exzellenten Darbietungen beim Husumer Publikum damit schon mal voll ins Schwarze.
(Zum dritten und abschließenden Teil siehe hier!)
[Martin Blaumeiser, 22. August 2025]


 Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke)
Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke)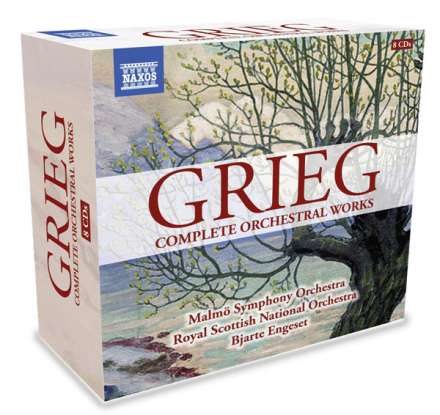 Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen
Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen
Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen