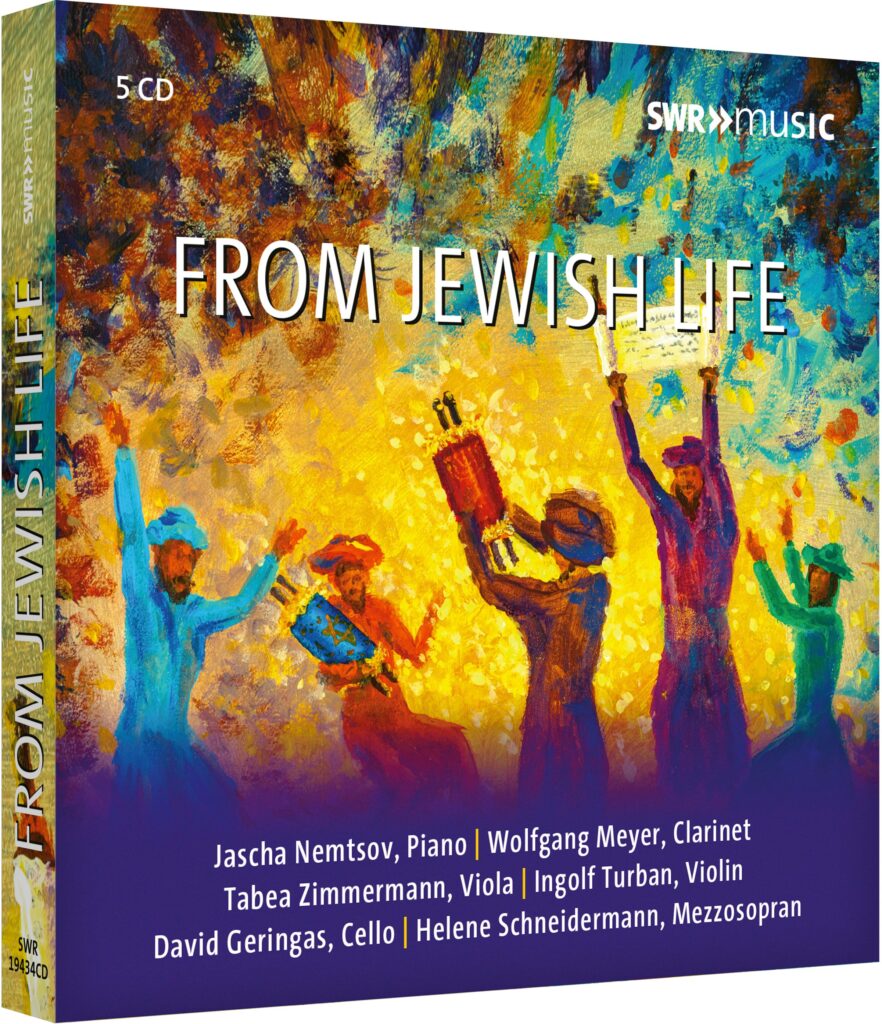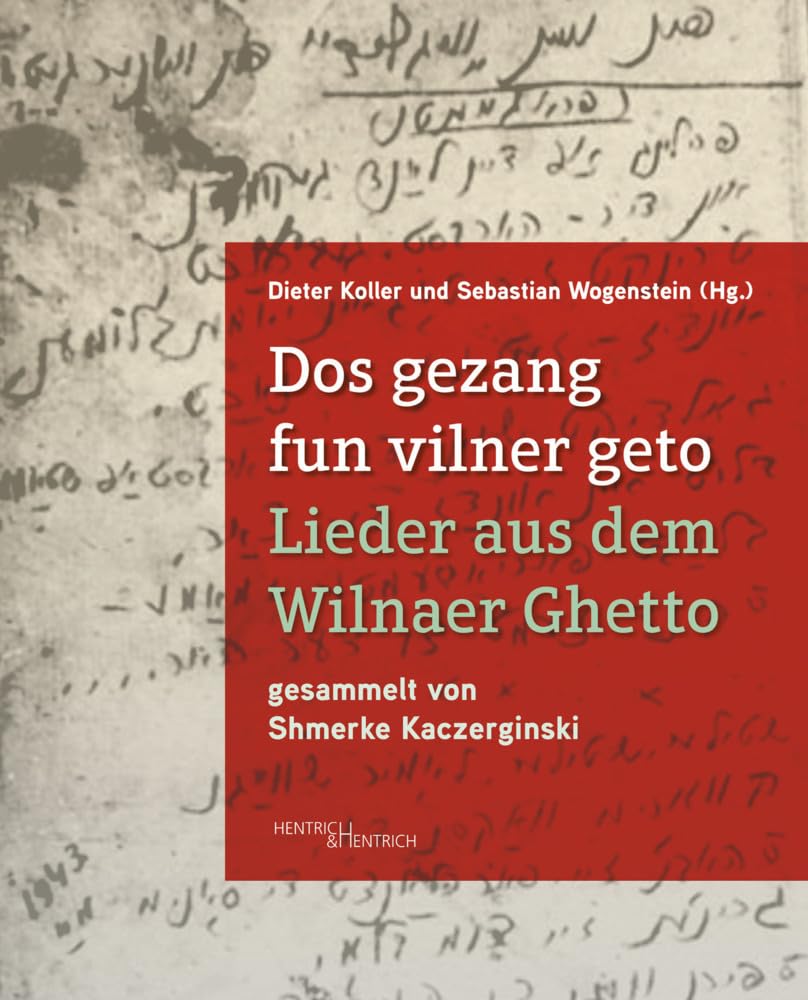Alle Jahre wieder kann man sich aufs neue davon überzeugen, dass die Adventskonzerte des Würzburger Monteverdichors in der Neubaukirche etwas Besonderes sind. Beständig erarbeitet der Chor unter seinem Dirigenten Matthias Beckert neue Werke, sodass kein Konzert dem anderen gleicht. Somit stehen auch jährlich am 2. Advent bzw. dessen Vorabend andere Stücke auf dem Programm. Die diesjährigen Adventskonzerte am 6. und 7. Dezember, die, wie nun schon seit Jahren Brauch, in Zusammenarbeit mit der Jenaer Philharmonie durchgeführt wurden, machten mit Werken dreier Komponisten bekannt, die in der jüngeren Geschichte Würzburgs eine herausragende Rolle spielten bzw. immer noch spielen: Bertold Hummel (1925–2002), Zsolt Gárdonyi (*1946) und Christoph Wünsch (*1955). Die Kompositionen Wünschs und Gárdonyis waren speziell für diese Aufführungen komponiert bzw. in Neufassung gebracht worden.
Zu Beginn des Konzerts ergriff Matthias Beckert das Wort und wandte sich ans Publikum. Damit begann eine kleine Gesangsstunde, denn das einleitende Stück des Abends, Bertold Hummels Kantate Dem König der Ewigkeit verlangt im vorletzten ihrer vier kurzen Sätze Gemeindegesang, der mit dem Chor alterniert. Da die Noten des zu singenden Chorals (Wohlauf, mein Seel, sag hohen Preis dem Herren) im Programmheft abgedruckt waren, konnte das Publikum, das in beiden Konzerten zahlreich erschienen war, leicht mitwirken und stimmte kräftig ein. Ein paar Mal wurde der Wechselgesang mit dem Chor geübt, dann konnte die Aufführung beginnen.
Der in Freiburg aufgewachsene Bertold Hummel war seit 1963 Kompositionslehrer am Bayerischen Staatskonservatorium Würzburg, der heutigen Würzburger Hochschule für Musik, wo er auch das Studio für Neue Musik leitete. Von 1979 bis 1988 amtierte er als Präsident der Hochschule, danach als ihr Ehrenpräsident. Es ist also nicht zu viel gesagt, wenn man ihn als die herausragende Persönlichkeit des Würzburger Musiklebens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Da zudem die geistliche Musik in seinem Schaffen einen bedeutenden Platz einnimmt, erschien es schlüssig, im Jahre seines 100. Geburtstags den Großteil eines Adventskonzerts seinen Werken zu widmen. Hummel hat, stets offen für Anregungen, sich im Laufe seines Lebens mit verschiedenen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten beschäftigt und auch die Auseinandersetzung mit avantgardistischen Tendenzen nicht gescheut. Die drei Werke Hummels, die hier zur Aufführung gelangten, entstanden zwischen 1950 und 1958, entstammen also der frühen Schaffensphase des Komponisten und verraten seine stilistischen Ausgangspunkte. Als Sohn eines Kirchenmusikers frühzeitig in die Praxis der geistlichen Musik hineingewachsen, ist Hummel von Anfang an dem Kontrapunkt zugeneigt. Er selbst hat bekannt, nachdrücklich durch den Umgang mit dem gregorianischen Choral geprägt zu sein, was man seiner modal eingefärbten Melodik durchaus anhört. Seine Harmonik zeigt deutlich den Einfluss Hindemiths, der ihm offenbar durch seinen Lehrer Harald Genzmer vermittelt wurde. Während für die ruhigen Abschnitte der Musik der Choral die Inspirationsquelle gewesen zu sein scheint, gehen in den rhythmisch belebten Teilen die Synkopen des Mittelalters mit denen des Swing eine Synthese ein. Die Fanfaren, mit denen Hummel Dem König der Ewigkeit eröffnet und schließt, zeigen beispielhaft die Verschmelzung von archaisierenden und modern-populären Elementen. Der große Kontrapunktiker spricht aus jedem Takt dieses Werkes, doch lässt er den Chor meist in markanter, wirkungsvoller Schlichtheit agieren. Verkündigung ist das Ziel, nicht Künstelei. Die polyphone Auffächerung des Satzes spart sich Hummel für Momente auf, die er damit besonders hervorheben möchte. So krönt er die Choralvariationen des dritten Satzes durch den bereits erwähnten Responsorialgesang mit der Gemeinde, wobei die Gemeinde den Choral einstimmig singt, während der Chor auf jede Zeile mit sechsstimmigen Melismen antwortet. Zur Begleitung der Singstimmen verwendet Hummel nur sieben Bläser und die Orgel, doch erzeugt er gerade durch diese Beschränkung ein scharf konturiertes, kontrastreiches Klangbild.
Als ebenfalls sehr hörenswert erwies sich die etwas ältere Kantate Offenbarung neuen Lebens op. 8, die für volles Orchester, Chor und Alt-Solo geschrieben ist und als größtbesetztes Werk des Abends das Konzert beschloss. Sie ist nahezu symmetrisch aufgebaut: Zwei knappe Antiphonen zwischen Chor und Alt umrahmen zwei chorische Choralbearbeitungen, die wiederum eine als Passacaglia gestaltete Psalmodie des Chores umfassen. Am Ende steht eine dritte Choralbearbeitung, ein Kanon über Wachet auf, ruft uns die Stimme. Dieser Satz ist kunstvoll gestaltet, doch besitzt er keine so starke Schlusswirkung wie das Finale der späteren Kantate Hummels. Überhaupt erschien das frühere Werk durch die Nachbarschaft des späteren etwas überschattet.
In der Programmmitte stand mit Hummels Weihnachtlicher Suite op. 13b ein reines Instrumentalwerk, das sich als köstlicher Beitrag zur Literatur für Kammerorchester entpuppte. Die fünf knappen, prägnant formulierten und kontrapunktisch flüssig gestalteten Sätze basieren auf eigenen Themen Hummels, doch werden in den Verlauf eines jeden beliebte Weihnachtslieder eingearbeitet. So begegnen im einleitenden Siciliano In dulci jubilo und Vom Himmel hoch, da komm ich her in kontrapunktischer Verschlingung. Der scherzoartige, in seinem Marschduktus Hindemith sehr nahe zweite Satz, in dem Trompetensignale und Violinsoli auffallen, wartet im Mittelteil mit Es ist ein Ros‘ entsprungen auf. Die zentrale Pastorale basiert auf einem Wechsel zwischen einer anmutigen, kontrapunktischen Holzbläsermusik und dem durch seine Harmonisierung impressionistisch anmutenden Susani-Lied in den Streichern. Der vierte Satz erinnert in seiner Lebhaftigkeit an den zweiten, ist aber lustiger und weniger forsch. Wie dort wechseln sich die einzelnen Instrumentengruppen in rascher Folge ab. Ein mehrfach flink dazwischen rufendes Signalmotiv basiert auf Morgen kommt der Weihnachtsmann. Die abschließende Passacaglia gipfelt in Vom Himmel hoch, da komm ich her, womit der Bogen zum Kopfsatz geschlagen wird.
Die Vortragsfolge des Programms war gut durchdacht: Die Werke Hummels bildeten Anfang, Mitte und Schluss, wobei die Offenbarung neuen Lebens ans Ende gerückt wurde, da in diesem Stück zum einzigen Mal sämtliche Mitwirkende zusammen agieren. Die übrigen Stücke waren alle unterschiedlich besetzt und präsentierten jeweils nur einen Teil der Singstimmen und/oder Instrumente. Zwischen den Kompositionen Hummels erklangen Werke zweier Komponisten der folgenden Generation, die beide sowohl mit Würzburg, als auch mit Bertold Hummel eng verbunden sind. Zsolt Gárdonyi wurde 1946 in Ungarn geboren und emigrierte in jungen Jahren nach Deutschland. 1980 wurde er von Hummel als Professor für Musiktheorie nach Würzburg berufen. Christoph Wünsch, 1955 geboren, war in Würzburg Schüler Hummels und Gárdonyis, unterrichtete bis 2021 als Professor an der Hochschule Musiktheorie und steht ihr seit 2017 als Präsident vor. Gárdonyi und Wünsch haben jeweils die sieben O-Antiphonen vertont, die in den sieben letzten Tagen vor Weihnachten in den Vespern des katholischen Stundengebets gesungen werden. Ihren Namen tragen diese Gebetsgesänge daher, dass sie alle mit einem „O“ als Anrufung Christi beginnen. Jeder der sieben Teile spricht anschließend Christus mit einem anderen Ehrentitel an.
Zsolt Gárdonyi vertonte die O-Antiphonen in deutscher Übersetzung. Das Werk entstand 2012 ursprünglich für Frauenchor, Oboe und Orgel. Die Fassung mit einer um Streichorchester und Harfe erweiterten Begleitung, die im Würzburger Adventskonzert zu hören war, entstand eigens zu diesem Anlass und erklang folglich hier zum ersten Mal. In Gárdonyis Werk entspricht jeder Antiphon ein kurzer, in sich geschlossener Satz, wobei zwischen den einzelnen Teilen motivische Beziehungen spürbar sind. Anklänge an Vom Himmel Hoch, o Engel kommt, die sich gelegentlich vernehmen lassen, sind kein Zufall, denn die erste Strophe dieses Liedes erklingt als Coda des Gesamtwerkes. Jeder Antiphon geht stets der gleiche Wechselgesang zwischen Alt-Solo und Chor auf die Worte „Seht, unser Gott wird kommen, uns zu erlösen“ voraus – von der Altistin Melanie Eisentraut freundlich einladend angestimmt. Mit diesem schlicht harmonisierten Refrain führt der Komponist gewissermaßen immer zu den einfachen tonalen Grundlagen seiner Musik zurück. In den Antiphonen selbst entfaltet er davon ausgehend ein reiches Spektrum zauberhafter Mischklänge. Es ist faszinierend, wie Gárdonyi die Stimmen zu dissonanten Klanggebilden verknüpft, der Charakter des Ganzen aber durchaus zart bleibt. Er vermeidet gleichermaßen grobe Effekte wie auch jene raffinierte Süßlichkeit, von der manch anderes zeitgenössisches Chorwerk kündet. Gárdonyi überlässt nichts dem Zufall: Jeder Klang sitzt am rechten Platz, die Dissonanzen sind alle wohlüberlegt gestaltet und auf der Grundlage einfacher tonaler Zusammenhänge errichtet, weswegen diese Musik auch nie statisch oder ziellos erscheint. In der Ausdeutung des Textes erreicht Gárdonyi große Wirkungen durch schlichte Mittel wie Klangfarbenwechsel – gleich Bertold Hummel ist er ein Meister des sparsam eingesetzten Instrumentariums – und abrupte harmonische Kontraste, etwa wenn er dem in lichten Farben erklingenden „Morgenstern“ in der fünften Antiphon den „Schatten des Todes“ mittels eines tiefen, dissonanten Akkords gegenüberstellt.
Christoph Wünschs Vertonung der Antiphonen entstand ausdrücklich für das Adventskonzert des Monteverdichors, somit wohnten die Zuhörer einer Uraufführung bei. Die Gefahr einer zu großen Ähnlichkeit zweier Stücke nach dem gleichen Text erwies sich als unbegründet, denn Wünsch hat einen ganz anderen Zugang zu den O-Antiphonen gewählt als Gárdonyi. Das beginnt bei der Besetzung: Wünsch wählt für sein Werk einen gemischten Chor mit großem Orchester und verzichtet auf eine Sologesangsstimme. Den Text vertont er im lateinischen Original. Auch ist sein Werk weniger als Zyklus kurzer Sätze anzusprechen, sondern als ein einzelner Satz, der sich in mehrere Abschnitte untergliedert, wobei Antiphon V deutlich als Reprise des Anfangs zu erkennen ist. Das Werk beginnt mit einer instrumentalen Einleitung, in der auf dissonant sich auffächernde Blechbläsertöne eine einstimmige Linie von Streichern und Marimba antwortet, deren gezackte Melodik und synkopische Rhythmen an Messiaen erinnern. Symbolhaft kehrt diese Musik im weiteren Verlauf noch zweimal wieder und beschließt auch das Stück. Der Chor wird auf eine Weise behandelt, die an gregorianischen Choralgesang gemahnt, wobei Wünsch den vollen Chorklang bevorzugt und den Satz nur vorübergehend auf einzelne Stimmen ausdünnt. Harmonisch bewegt er sich durchweg außerhalb der klassischen Funktionsharmonik, verzichtet also im Gegensatz zu Gárdonyi darauf, das Komplizierte hörbar aus dem Einfachen herzuleiten. Aber auch in seiner Musik sind die tonalen Kräfte spannungsvoll wirksam. Die Anlehnung an Choral-Topoi verleiht dem Stück einen kernigen Charakter, der durch die harten Dissonanzen und die Wahl gleißender Orchesterfarben noch unterstrichen wird.
Alle Beteiligten haben bei der Wiedergabe der Stücke Vortreffliches geleistet. Die Werke waren mustergültig einstudiert worden und wurden mit jener Hingabe vorgetragen, die nur bei sorgfältiger Auseinandersetzung mit der Musik zu erreichen ist. In Hummels Orchestersuite stellte Matthias Beckert unter Beweis, dass er mit rein instrumentalen Kräften nicht minder feinfühlig zu Werke geht wie mit vokalen. Wie so häufig bei doppelten Konzerten gelangen die Leistungen des zweiten Abends gegenüber denen des ersten noch um einen Grad gelöster und selbstverständlicher. Anstelle einer Pause veranstaltete der Dirigent kurze Interviews mit Martin Hummel, einem Sohn Bertold Hummels, der als Gesangspädagoge an der Würzburger Hochschule lehrt, sowie den beiden anwesenden Komponisten. So erfuhr man interessante Fakten über Bertold Hummel als Mensch und Künstler. Beispielsweise schilderte Martin Hummel, dass sein Vater zum Komponieren regelmäßig den Keller, als den ruhigsten Ort des kinderreichen Hauses, aufsuchte. Christoph Wünsch erzählte, wie Hummel ihm zwecks Konzentration zu Beginn des Kompositionsunterrichts die Aufgabe stellte, eine Sonate für Oboe allein zu schreiben, und umgehend nach Fertigstellung des Stücks einen Oboisten holte, um den Schüler dessen eigenes Werk hören zu lassen. Zsolt Gárdonyi gab darüber hinaus auch Einblicke in sein eigenes künstlerisches Selbstverständnis. Auf sein Komponieren angesprochen, sagte er: „Ich suche die Musik, die ich gern gehört hätte. Also habe ich sie selbst geschrieben.“ Worte eines echten Künstlers, der nicht nach der Mode geht, sondern seinem Herzen folgt! Dem Klangeindruck sämtlicher in diesem Adventsprogramm zu hörender Werke nach, erscheint es mir nicht falsch, auch die anderen beiden Komponisten zu diesen Künstlern zu rechnen. So nimmt man denn als Lehre aus diesen Konzerten mit, dass es Bertold Hummel als Verdienst anzurechnen ist, in Würzburg eine Atmosphäre geschaffen zu haben, in der kompositorische Begabungen reifen und sich in ihrer Eigenart optimal entfalten können, sodass bis heute dort großartige Musik entsteht.
[Norbert Florian Schuck, Dezember 2025]