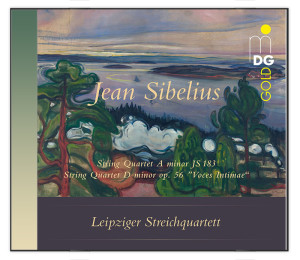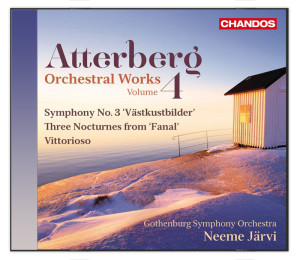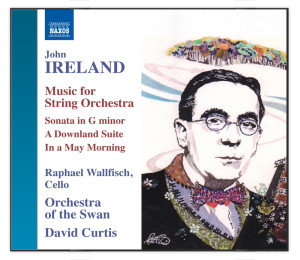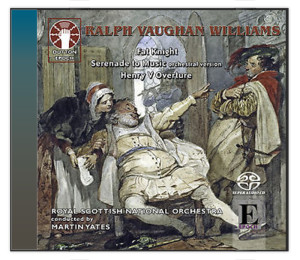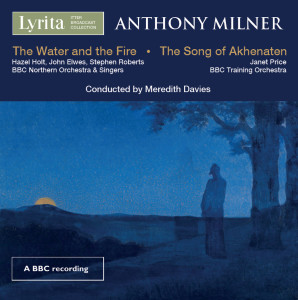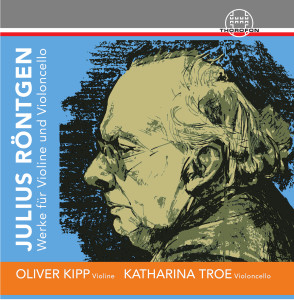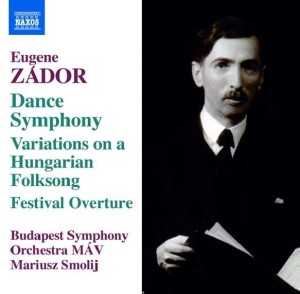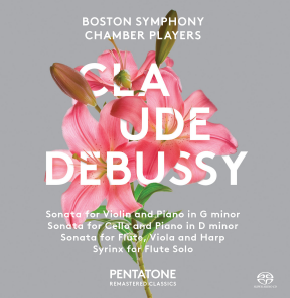László Lajtha
Orchestral Works 1
(Suite pour orchestre, Op. 19; In memoriam, Op. 35; Symphonie Nr. 1, Op. 24)
Pécs Symphony Orchestra
Nicolás Pasquet
Naxos 8.573643; EAN: 747313364374
Bei Naxos erscheinen gerade Aufnahmen der Orchestermusik des Ungarn László Lajtha in Wiederveröffentlichungen einer Edition, die Mitte der 1990er-Jahre bei Marco Polo erst-erschienen war. Klangqualität und Interpretation sind auch für heutige Begriffe noch exzellent. Die Musik Lajthas stellt einen interessanten Sonderfall der osteuropäischen Musik des 20. Jahrhunderts dar.
Wie schon in früheren Jahren zu beobachten, kommen auch 2016 wieder einige Aufnahmen via Naxos auf den Markt, die in früheren Jahren beim Label Marco Polo erst-erschienen waren. Dazu zählen u.a. einige Spohr-Sinfonien, aber (interessanter vielleicht, weil viele Jahre vergriffen und noch immer außerhalb von Naxos/Marco Polo weitgehend unbeackertes Terrain) Orchesterwerke des Ungarn László Lajtha.
Da kann man mal wieder sehen, wie die Zeiten sich ändern: Als diese Aufnahmen 1996 zum ersten Mal beim Marco Polo-Label erschienen, kannten nur wenige Eingeweihte den Namen des Dirigenten Nicolás Pasquet. Heute hingegen – nach verschiedenen erfolgreich verbrachten und viel beachteten Chefdirigenten-Posten sowie einer Professorenstelle in Weimar – ist Pasquet zumindest im Ostteil Deutschlands eine durchaus prominente Figur. Heute ist allerdings kaum noch bekannt, dass er einst auch das Sinfonieorchester der südungarischen Stadt Pécs leitete (heute als Pannon Philharmonic Orchestra firmierend). Und was dieses Orchester damals für ein verblüffend exzellenter Klangkörper war, das zeigen diese spannenden Aufnahmen der Musik László Lajthas.
Lajtha ist ein Komponist gewesen, dessen Stil man unkonventionell nennen kann. Seine Lebensgeschichte verrät viel über die Musik, die wir hier hören können. Einerseits gehörte Lajtha zur Gruppe der Volksliedsammler um Kodály und Bartók, die die ungarische Folklore als Inspirationsquelle für ihre Kompositionen nutzten, andererseits kam Lajtha schon früh in Kontakt mit dem französischen Impressionismus und dem Expressionismus ebenso.
Zu Lebzeiten war er (wohl auch wegen politischer Belange) kaum als Komponist geläufig, sondern eher als Gelehrter, Professor, zeitweise auch als Rundfunkredakteur. Lajthas neun Symphonien sind aber ein bis zum heutigen Tage seltenes Beispiel für einen produktiven ungarischen Sinfoniker. Ungarn ist ja ein Land, das spätestens seit Liszts Proklamierung des Konzepts der Symphonischen Dichtung (vielleicht verständlicherweise) nur sehr wenige Symphonien im eigentlichen Sinne des Wortes und der Form hervorgebracht hat.
Lajtha ist, das zeigte die damalige Marco Polo-Reihe ganz deutlich, ein spannender, ein hörenswerter Komponist. Man kann ihn sicher nicht als einen der großen Meister einstufen, aber als einen wirklich hörenswerten, guten Komponisten. Und gerade seine Symphonien verraten neben einer unverkennbaren eigenen Tonsprache auch den einen oder anderen Blick in andere Länder des damaligen „Ostblocks“, denn es gibt zumindest vom Höreindruck her manche Parallelen zum sinfonischen Werk von z.B. Prokofjew, Martinů oder Myaskovsky. Erinnerungen kommen zudem an andere ungarische Musik auf: So blitzt in dem auf diesem Album eingespielten Opus 19 der Stil Kodálys auf oder auch der Weiners.
Im Opus 35 und in der ersten Sinfonie Op. 24 ist der Zugriff moderner, kantiger, mit einem spürbaren Willen zur Expression. Die Symphonie Nr. 1 erscheint dann auch in mancher Hinsicht „gewollt“ (aber auch gekonnt, wie ich hinzufügen möchte), wie überhaupt Lajthas Musik nicht den Eindruck eines gelassen, entspannt Komponierenden vermittelt, sondern stets (auch in ruhigeren, lyrischeren am französischen Impressionismus orientierten) Stücken oder Werkteilen eine gewisse Unruhe und innere Zerrissenheit in sich trägt.
Ist dies vielleicht auch mit ein Grund dafür, warum Lajthas Orchestermusik in der gesamten Tonträgergeschichte bislang nur durch das einstige ungarische Staatslabel Hungaroton und durch die Marco Polo-Edition, die hier bei Naxos nach Jahren wiedererscheint, dokumentiert ist? Man kann nur vermuten. Das Hören dieser Musik lohnt sich jedenfalls, und in der auch für heutige Maßstäbe noch exzellenten Klangqualität und Darbietung dieser Aufnahmen Nicolás Pasquets aus Pécs erst Recht! Schön, dass diese Raritäten nach Jahren endlich wieder erhältlich sind.
[Grete Catus, August 2016]