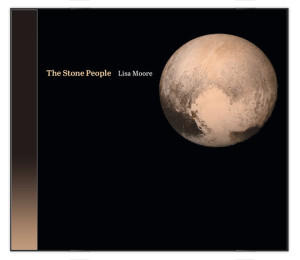Am Montag, den 9. April spielte die italienische Pianistin Ottavia Maceratini in der ‚série jeunes’ des Tonhalle-Orchesters Zürich ihr Debütkonzert im Kammermusiksaal der Zürcher Tonhalle. Nach der ersten Hälfte mit Schumanns Arabesque, Mozarts Rondo in a-moll und Schumanns Fantasie folgten Ravels Sonatine, zwei ‚Essays in the Modes’ von John Foulds, Kaikhosru Shapurji Sorabjis Pastiche über das Lied des Hindu-Händlers aus Rimsky-Korsakovs Oper ‚Sadko’ und die Uraufführung der großen, hochvirtuosen Fantasie ‚Guerrero Andino’ des peruanischen Meisterpianisten Juan José Chuquisengo.
Die ‚série jeunes’ des Zürcher Tonhalle-Orchesters ist eine Beobachtungsstätte für aufstrebende junge Künstler und wird von einem entsprechend fachkundigen, hochinteressierten, natürlich auch kritischen Publikum besucht. Und der Zuspruch zu diesen Konzerten ist ausgezeichnet, wie auch an diesem Abend zu spüren, der durchaus furios und denkwürdig war. Ottavia Maria Maceratini ist eine Musikerin, die nicht um jeden Preis Karriere machen möchte. Es geht ihr um die Musik und um die Begegnung mit dem Publikum, und eben nicht um den demonstrativen Ego-Trip, was ihrem Spiel anzumerken ist. Eine phänomenale Technik ist natürlich die Voraussetzung, um ‚ganz oben’ mitzuspielen, und ein kultivierter Klang und Stilbewusstsein sollten dazugehören, sind aber keine Selbstverständlichkeit. Bei ihr ist das alles in schönster Weise gegeben. Vor einem Jahr gab sie ihr Debüt mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin in der deutschen Erstaufführung von John Foulds’ einzigem, großartigem Klavierkonzert ‚Dynamic Triptych’, davor war sie unter anderem mehrfach mit Lavard Skou Larsen, einem der feinsten Dirigenten unserer Zeit, aufgetreten, hatte mit Gidon Kremer und der Kremerata Baltica beim Schleswig Holstein Musik Festival debütiert, mit dem Nowosibirsk Philharmonic und dem Münchener Kammerorchester konzertiert, und vieles weitere. Nun also ihr erster Zürcher Auftritt, der von großem Erfolg beim Publikum bekrönt wurde.
Sie begann mit Robert Schumanns Arabeske op. 18, vielleicht etwas flüchtig im Entwurf, dabei mit bezauberndem Feinsinn dargeboten. Es ist nicht einfach, über die zwei lyrisch kontrastierenden Zwischenspiele hinweg den großen Bogen entstehen zu lassen, doch die erwärmende Intimität des Ausdrucks nahm sofort gefangen. Es folgte Mozarts Rondo in a-moll, in der organischen Entfaltung über die weite Strecke und den vertrackten dynamischen Vorschriften durchaus ein besonders anspruchsvolles Werk von 1787, und es waren außergewöhnliche Klarheit und feinnervige Phrasierungskunst zu bestaunen. Ottavia Maria Maceratini ist hier schon einen weiten Weg der Bewusstwerdung gegangen, sehr ungewöhnlich in der die Strukturen auffächernden Ernsthaftigkeit für einen jungen Menschen. Auch klanglich fesselt ihr perlendes, niemals verwaschenes Spiel, das der Spur einer kontinuierlichen Durchdringung folgt, die keine nichtssagenden Formelhaftigkeiten kennt. Es ist sehr nahe dran an einem idealen Mozart, auch hinsichtlich des graziös gemessenen Tempos. Was noch fehlt, ist in entscheidenden Momenten eine gewisse Ruhe, das Auskosten des atmenden Gesangs. Und zugleich ist so erfreulich, dass bei ihr nicht die geringste Gefahr sentimentalen, sich selbst zelebrierenden Stillstands besteht. Diese Musik bewegt sich fortwährend auf einem schmalen Grat, und wir dürfen hoffen, dass es ihr gelingt, einen vollendeten Ausgleich zwischen Vorwärtsdrängen und subtilem Innehalten im Dienste der Gesamtform zu finden. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht, und dem sich die wenigsten Musiker stellen.
Gleiches gilt auch für Robert Schumanns gewaltige dreisätzige Fantasie C-Dur op. 17 von 1835-36. Hier ist vorauszuschicken, dass Frau Maceratini eine Darbietung gelang, die nicht nur zum Besten gehört, was heute in Sachen Schumann zu vernehmen ist, sondern auch, dass sie dieses komplexe und gefürchtete, so viel gespielte Meisterwerk mit einer technischen Vollendung spielte, wie das kaum je geschieht. Auch die extremsten Schwierigkeiten gelangen ihr, ohne Verzerrungen des Tempos, mit phänomenaler Leichtigkeit. Nie knallt ihr äußerst kraftvolles Forte, alles ist klar und rund, legt die Polyphonie offen, folgt den harmonischen Impulsen, lässt die Musik mit unwiderstehlichem Charakter sprechen. Da fehlt nicht viel! Einzig möchte ich anmerken, dass der Mittelteil des Kopfsatzes zwischendurch zu sehr beschleunigt, dass auch im Mittelsatz einige Male in der Hitze des Gefechts das Tempo etwas davonzulaufen tendiert, dass im Finale die letzte Beruhigung etwas spät kommt. So ist auch hier der einzige kardinale Kritikpunkt, mehr Raum für die Ruhe zu lassen, die natürlich nichts mit Ermattung zu tun hat, sondern mit Innigkeit, die potentiell ohnehin da ist, jedoch noch nicht wirklich zu ihrem Recht kommt.
Ravels Sonatine erklang mit der pantomimischen Zerbrechlichkeit, die so bezeichnend für diese Musik ist, wunderbar stilisiert und natürlich zugleich in den Details – auch den formbildenden Tempokontrasten, und dort, wo es angesagt ist, den Blick in die Abgründe offenbarend. Auch hier: gelegentlich noch mehr Ausatmen lassen, der lyrischen Gegenwelt mehr Raum geben, und die schnelleren Tempi nicht davoneilen lassen.
Zwei der sieben 1926 in Paris komponierten ‚Essays in the Modes’ op. 78 von John Foulds (1880-1939) schlossen sich an, was programmatisch passender nicht hätte gewählt werden können: das Passacaglia-artig lyrisch kontrapunktierende ‚Ingenuous’ und das herrlich verinnerlichte, in vier ‚Strophen’ auf archaischen Pfaden feierlich dahinschreitende ‚Strophic’. Es ist unglaublich, welchen Reichtum Foulds einer niemals modulierenden Musik in jeweils einem einzigen Modus entlockt. In solchen Werken erweist er sich als der substantiellste und transzendenteste englische Komponist seiner Zeit, durchaus mit Ravel und Bartók auf Augenhöhe, und hier kann sich die lyrisch-introvertierte, klangsensitive Begabung der Pianistin wunderbar entfalten.
Dann Sorabji, mit seinem ‚Pastiche on the Hindu Merchant’s Song from Sadko by Rimsky-Korsakov’ – wie eine Edelstein-glitzernde Episode aus Tausendundein Nächten, von der Pianistin herrlich abschattiert in der immer vernehmlichen, reich ornamentierend umkleideten einfachen Gesangsmelodie.
Mit Spannung wurde die abschließende Uraufführung des Peruaners Juan José Chuquisengo erwartet. Er schrieb nicht den ursprünglich angekündigten Tango, sondern eine Gedächtnismusik für einen verstorbenen Freund aus den Anden, dessen Andenken das Werk gewidmet ist: ‚Guerrero Andino’. Diese große Fantasie ist nicht nur eine zugleich höchst dankbare gigantische pianistische Herausforderung, sondern besticht bei ihrem immensen harmonischen Reichtum, ihrer melodischen Schönheit, abwechslungsreichen rhythmischen Vitalität und unkonventionellen kontrapunktischen Eleganz vor allem dadurch, dass die eigentlich rhapsodische Anlage auf organisch kunstreichste Weise ineinander verwoben ist. Es ist keine ‚moderne Musik’ in dem Sinne, in welchem sie in unserer subventionierten Kulturlandschaft nach wie vor hartnäckig verstanden wird, dafür ist sie nicht nur viel zu schön, sondern auch in der Subtilität viel zu neuartig. Eine unglaublich kraft- und prachtvolle, farbenreiche, lebendige, innerlich reiche Musik, die endlos scheinende Räume eröffnet und das Gefühl einer unerschöpflichen Freiheit atmet. Es kann gut sein und ist zu wünschen, dass dieses Werk ein Klassiker der Soloklaviermusik in unserer Zeit wird. Juan José Chuquisengo beweist darin auch sozusagen ganz nebenbei, dass er nicht nur einer der feinsten Pianisten unserer Tage ist, sondern auch ein wahrhaft großartiger Komponist (am 22. April wird im Freien Musikzentrum in München seine symphonisch angelegte Piazzolla-Hommage ‚Tango-Metamorphosen’ für Streichquintett uraufgeführt, die bald darauf in Augsburg durch die Bayerische Kammerphilharmonie auch in der Streichorchesterfassung erstmals erklingen wird). Ottavia Maria Maceratini hat mit ‚Guerrero Andino’ ein gewaltiges Werk an den Schluss ihres Programms gesetzt, das ihrer Ausnahmebegabung in schönster Weise entspricht und das Publikum in Begeisterung versetzt. Sie dankt für den Applaus mit einer so wundervollen wie hochoriginellen Zugabe, dem ‚Persian Love Song’ von John Foulds, in verfeinertster Wiedergabe. Möge sie bald wieder in Zürich zu hören sein.
[Lucien-Efflam Queyras de Flonzaley, April 2016]