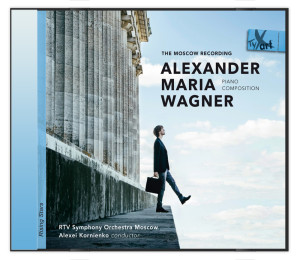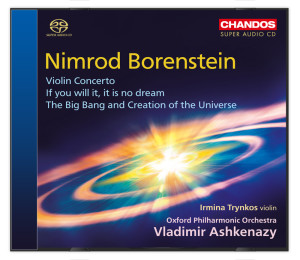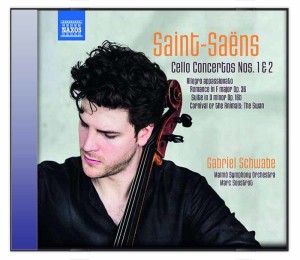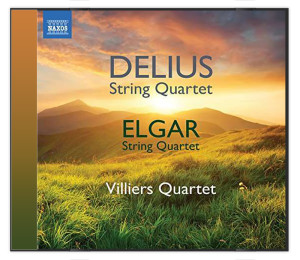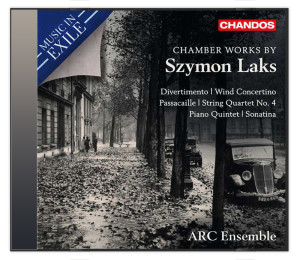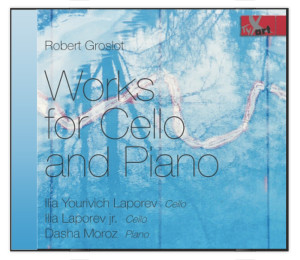TYX Art, TXA17096; EAN: 4 250702 800965
Der 1995 geborene Pianist Alexander Maria Wagner spielt für TYX Art das Erste Klavierkonzert b-Moll Op. 23 von Peter Ilyich Tschaikowsky ein, sekundiert vom RTV Symphony Orchestra Moscow unter Alexei Kornienko. Im Anschluss spielt das Orchester noch die Zweite Symphonie Alexander Maria Wagners, die nach einem Gedicht von Johanna Kapelari konzipiert wurde, welches inmitten der Symphonie auch von Bettina Schönenberg rezitiert wird.
Es ist ein Bild, das unsere heutigen Vorstellungen und Ansprüche an die „klassische Musik“ genauestens widerspiegelt. Ein Virtuose, Wunderkind, rauscht durch eines der gewaltigen und halsbrecherisch schwierigen Konzerte der romantischen Epoche, fingerfertig und brillant, ohne nur eine der Hürden schwierig oder widerhakig erscheinen zu lassen. Hiernach präsentiert sich der Pianist auch noch als Komponist und legt der Öffentlichkeit mit zweiundzwanzig Jahren bereits seine zweite Symphonie vor, auch ein Gigant wie Schostakowitsch war nicht früher dran mit der Komposition seines zweiten symphonischen Werks. Und am Ende bleibt das Publikum begeistert zurück angesichts solch eines jungen Talents.
Die Aufnahme präsentiert uns alles, was heute von einem Genie erwartet wird, eine glänzende Fassade. Und tatsächlich zeigt Alexander Maria Wagner brillante Fingermechanik, aufregende Emotionen und virtuose Fähigkeiten, die vielleicht erstaunen mögen. Doch leider bleibt es zum Großteil bei eben dieser Fassade, dahinter verbirgt sich sehr wenig, das auf musikalische Substanz hinweisen würde. Der Anschlag ist hart und rau, birgt weder Feinsinn noch Hintergründigkeit, ist auf bloßes Brillieren aus; die Lyrik wird nicht erspürt, sondern einfach konventionell ausgeführt; und die herrlichen Harmonien bleiben ziellos aneinandergereihte Akkordgebilde, die eben mehrere Finger zeitgleich erfordern. Dies ist bedauerlich gerade angesichts dessen, dass doch unverkennbar spürbar wird, dass ein Talent in dem jungen Pianisten steckt. Dieses sollte auf musikalischer Ebene gefördert werden und nicht noch weiter auf die Schiene eines rein oberflächlich agierenden „Notenfressers“ gebracht werden, der höchst komplexe Werke spielen, aber nicht verstehen kann.
Die Symphonie steht ganz im Zeichen der heute in Fachkreisen als alleingültig reklamierten Avantgarde, wilde Geräusche und durcheinandergeworfene Töne dominieren das Bild. Harsche Brüche und Kontraste legen manchen interessanten Moment frei, schneiden sich zugleich stets vom vorherigen ab. Doch der Avantgarde-gewohnte Hörer wird nicht mehr geschockt von derartigen Klängen, die seit nunmehr beinahe hundert Jahren in ähnlich brüsker und oft viel schrofferer Form existieren. Eine erneute Suche nach Struktur und Zusammenhang, nach musikalischem Sinn, wäre in jeder Hinsicht viel wertvoller. Und gerade dies ist in Wagners Zweiter Symphonie nicht einmal ansatzweise aufzuspüren, die einzelnen Ebenen überlagern und unterbrechen sich willkürlich, jeder eventuelle Aufbau einer vielversprechenden Entwicklung wird sogleich unterbrochen. Es gibt auch wenig Eigenes in dieser Musik, sie folgt vorhandenen Trends und sucht Halt in vertrauten Topoi unserer Zeit. Doch macht nicht gerade das „Eigene“ eine Symphonie aus? Man denke nur an Sibelius, an Schostakowitsch, Eliasson, Sæverud, Nørgård, Nordgren, Enescu, Lyatoshinsky oder auch den Tiroler Zeitgenossen Michael Franz Peter Huber, sie alle (und viele andere auch) haben sich in jeder Symphonie neu erfunden, haben Originäres geschaffen, sich von Strömungen nicht vereinnahmen lassen und nicht zuletzt die gesamte Form als bezwingenden Zusammenhang zu artikulieren verstanden. Das geräuschhafte, avantgardistische, findet bei den meisten der genannten Komponisten seinen festen Platz und wird doch schlüssig in den großen Kontext integriert.
Bei meinen Ausführungen geht es keineswegs darum, ein junges Talent an seinem Weg zu hindern, ihm einen Stein in den Weg zu legen oder es plump zu attackieren. Mein Anliegen ist vielmehr, Bewusstsein zu schaffen dafür, eigenständig in der Musik zu forschen und das Wissen um prinzipielle Zusammenhänge zu vertiefen – als Ausführender wie als schaffender Musiker. Wir haben reichlich hochbegabte Virtuosen, aber wir haben nicht genügend wirkliche „Musiker“, denen die Musik mehr bedeutet als der äußere Erfolg. Musik ist etwas so Unergründliches, jeder Zusammenhang ist einmalig, jede Konstellation unwiederholbar – wir sollten sie nicht als gegeben hinnehmen, sondern von Grund auf stetig neu zu erfahren suchen. Ich bin überzeugt, Alexander Maria Wagner hätte die Fähigkeit dazu, ein „Musiker“ zu werden, sofern er denn einen eigenen Weg gehen will und sich nicht leichtfertig der Oberflächlichkeit des Business und seiner Erwartungen unterwirft. So hoffe ich bei diesem Text vielleicht noch mehr als bei anderen, dass er von den richtigen Stellen gelesen und beachtet, nicht in kurzsichtigem Karrierewahn einfach nur als „negative Kritik“ beiseite gelegt wird.
[Oliver Fraenzke, November 2017]