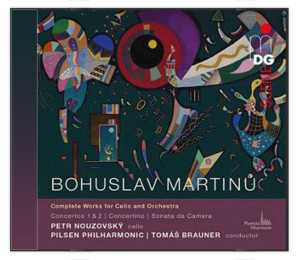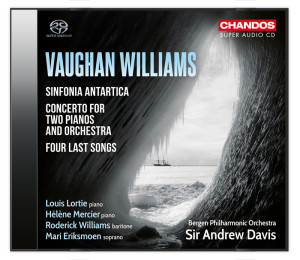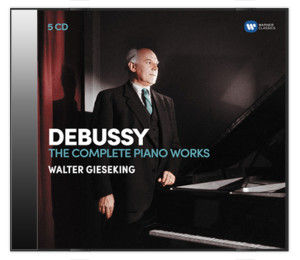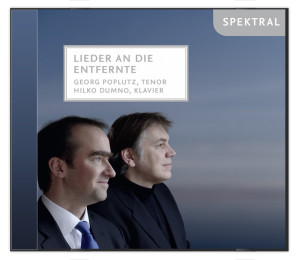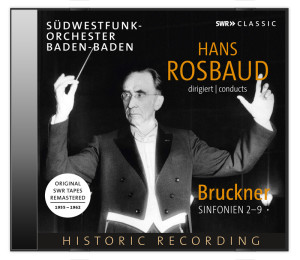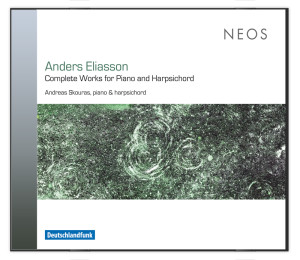Bohuslav Martinů (1890-1959): Complete Works for Cello and Orchestra
Petr Nouzovský, Cello; Pilsen Philharmonic; Tomas Brauner, Dirigent
Musikproduktion Dabringhaus & Grimm, MDG 601 2041-2 (2 CDs); EAN: 7 60623 20412 3
Wer, wie Bohuslav Martinů , die ersten Jahre nach seiner Geburt in luftiger Höhe in einer Türmerwohnung verbracht hat, dem ist wohl ein ganz besonderes Weltbild – auch akustisch – zu eigen geworden. Das ist sicher auch ein herausragendes Merkmal seiner Kompositionen, von denen sämtliche für Cello und Orchester auf dieser Doppel-CD versammelt sind. Was beim ersten Anhören sofort auffällt, ist der ungeheure melodische und rhythmische Reichtum dieser Musik. Bisher war mir Martinů zwar dem Namen nach wohlbekannt, seine Musik aber nur am Rande. Was sich ab sofort ändern wird und bereits geändert hat.
Das erste Cellokonzert hat er im Sommer 1930 noch in seiner Geburtsstadt Policka begonnen, es wurde vollendet in Paris und 1931 von Gaspar Cassadó in Berlin uraufgeführt. Allerdings arbeitete es Martinů bis zur endgültigen Fassung noch mehrmals um. Es wirkt in der letzten und hier vorliegenden Fassung vollkommen abgerundet, was sicher auch von der Zusammenarbeit mit Pierre Fournier profitierte. Der Tonalität verpflichtet, nimmt es trotzdem viele zeitgemäße Anregungen auf, enthält eine große Anzahl verschiedenster Elemente, ruhig bis vital, kein Wunder, dass es bald Eingang in das Repertoire der Cellisten gefunden hat.
Martinů musste, wie so viele Künstler, emigrieren, hatte allerdings in Amerika von Anfang an Erfolg und konnte von seiner Musik und seiner Lehrtätigkeit gut leben. In allen Lagen und allen tonlichen Dimensionen ist das Cello eingebettet im Orchester, kann aber immer seine Klanglichkeit mühelos behaupten, in allen drei Sätzen.
Im zweiten Stück, der Sonata da camera von 1940, komponiert unter schwierigen Bedingungen beim Warten auf das Ausreisevisum, führt das Soloinstrument zusammen mit dem kleinen Orchester-Ensemble alles nur Erdenkliche an rhythmischen, elegischen und melodischen Finessen vor, was dem Stück eine überzeugende Wirkung verleiht. Es ist eine äußerst reizvolle Komposition, die dem Cellisten Henri Honegger gewidmet ist, einem Gönner in diesen schwierigen Zeiten. Martinůs Klangsprache ist seltsam vertraut, fast möchte ich das seltene Wort „schön“ gebrauchen, sie nimmt mich sofort gefangen und ist voller Wohlklang, gesanglich melodisch und überraschend instrumentiert.
Die zweite CD wartet auf mit einem zweiten Cello-Konzert, das Martinů nach seiner Emigration 1944 in New York komponierte. Er selbst sagte, man könne es fast eine „Pastorale“ nennen. Und so kommt es auch daher, äußerst melodisch, ein wenig an die Pastroral-Musik seines Landsmannes Ryba erinnernd in seiner Melodien-Seligkeit. Dem Instrument wie auf den Leib geschrieben, schwelgt besonders der zweite Satz förmlich in Wohlklang und Liedthemen. Auch hier finden sich wieder allerdings sehr rhythmisch bewegte Abschnitte, es ist wieder einmal alles aufgeboten, was die Musik dieses Komponisten hörenswert macht.
Das früheste Stück lässt den Einfluss der Jazz-Musik und des Aufbruchs seiner Jugendjahre deutlich hören und spüren, es ist durchaus wild und jazzig an vielen Stellen, aber immer vital und anregend, Martinůs erste konzertante Komposition, und entstand 1924 in Paris.
An die 30 Solokonzerte hat Martinů für die verschiedensten Instrumente komponiert. Diese Doppel-CD ist ein großartiger Beitrag und ein gelungener Beweis, wie „schön“ moderne Musik sich anhören kann.
Noch dazu, wenn es von solchen Könnern wie dem Cellisten Petr Nouzovsky und der Pilsener Philharmonie unter Tomas Brauner zum Klingen gebracht wird. Dem Label Dabringhaus und Grimm ist da eine vorzügliche Produktion gelungen.
[ULRICH HERMANN, Januar 2018]