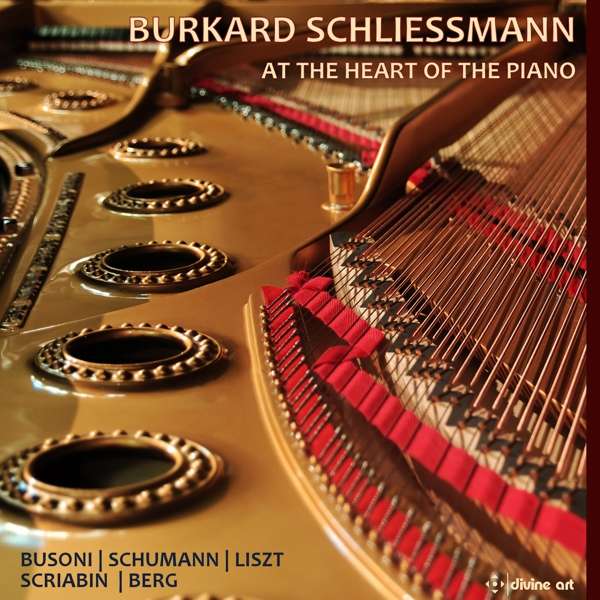Abschließend die Besprechung der letzten drei Konzerte des diesjährigen Festivals „Raritäten der Klaviermusik“ im Schloss vor Husum: Klavierabende von Mark Viner (21.8.), Illia Ovcharenko (22.8.) und Chiyan Wong (23.8.).
Wann immer der noch fast jugendlich wirkende Mark Viner in Husum auftritt, liegen die Erwartungen besonders hoch, weil er wie nur ganz wenige Künstler in geradezu idealer Weise das virtuose Kernrepertoire des Raritätenfestivals vertritt, vor allem mit Komponisten wie Leopold Godowsky oder Charles-Valentin Alkan. Viner ist zudem seit über 10 Jahren Vorsitzender der Alkan Society und arbeitet erfolgreich an der ersten Gesamtaufnahme von dessen Klavierwerk. Beide Hälften seines Konzerts am 21. 8. begann er jedoch mit Transkriptionen berühmter Melodien Charles Gounods durch Franz Liszt. Die klangliche und pianistische Souveränität des Pianisten erinnert sofort an Marc-André Hamelin, allerdings auch über weite Strecken an dessen gewisses – hier britisches – Understatement. Viners Darbietung von Les Adieux S 409 über ein Motiv aus „Roméo et Juliette“ erschien durchaus gehaltvoll; noch besser gelang die glitzernd klare Hymne à Sainte Cécile S 491 mit konsequent aufgebauter Steigerung. Dennoch vermisste man in seinem Klavierspiel echten Tiefgang: Emotional offensichtlich selbst absolut unbeteiligt, gehört er eben nicht zu den musikalischen „Deutern“, überlässt dies ganz seiner Hörerschaft. Ignaz Paderewskis Nocturne op. 16,4 erwies sich als gefällige Petitesse. Als Rarität interessanter das diesem 1926 gewidmete Nocturne „Ragusa“ (historischer Name Dubrovniks) seines amerikanischen Schülers Ernest Schelling, das über einem Barkarolen-Rhythmus zumeist hemiolische Melodik entwickelt, mit exquisiter Harmonik und atmosphärischem Klaviersatz.
Vom nach wie vor unterbelichteten Klavierschaffen Cécile Chaminades präsentierte Viner drei Stücke, die sich ebenfalls See-Motiven widmeten: Marine op. 38, nicht sonderlich charakteristisch; L’Ondine, mögliches Vorbild für Ravels gleichnamiges Stück, beides schlicht zu laut vorgetragen; schließlich die dankbaren Pêcheurs de nuit aus den Poèmes provençaux. Die großen pianistischen Herausforderungen des Abends waren erwartungsgemäß zum einen zwei perfekt beleuchtete „Phonoramas“ aus Godowskys Java-Suite: Wayang-Purwa und The Bromo Volcano – mit großartiger Durchsichtigkeit des komplexen, feinsinnigen musikalischen Geflechts und eindringlicher Bildhaftigkeit der vorjährigen Aufführung des kompletten Zyklus durch Patrick Hemmerlé nach einhelligem Bekunden des Publikums weit überlegen. Zum anderen überzeugten Alkans nettes Nocturne Nr. 4 „Le grillon“, Posement aus den 12 Dur-Etüden op. 35, wo Viner aus den dicken Akkorden gekonnt die Mittelstimmen herausarbeitete, und schließlich die Trois petites fantaisies op. 41: Zwar geriet ihm das Alla-breve von Nr. 2 etwas zu langsam und man erkannte nie, dass dessen Thema stets auftaktig beginnt, dafür gelang die typisch Alkansche, absolut verrückte Presto-Orgie von Nr. 3 – primitiv, aber gut – wirklich hinreißend. Was Alkan angeht, ist Viner momentan eindeutig der Platzhirsch. Die Bravos für diese Leistung waren redlich verdient. Trotzdem wäre wohl zumindest ein Werk mit gewichtigerer musikalischer Substanz für ein solches Programm wünschenswert.
Warum man sich vom Ukrainer Illia Ovcharenko, in diesem Jahr der jüngste Pianist in Husum, ausgerechnet Robert Schumanns erst 1976 veröffentlichte Exercises WoO 31 – über das Allegretto-Thema aus Beethovens Siebter – gewünscht hatte, blieb schleierhaft. Das eh‘ sehr unreife Werk erklang im Rittersaal bereits 2007 (Piers Lane), und Ovcharenko hatte sich für den 22. 8. aus den in drei Quellen überlieferten 15 Variationen eine dramaturgisch völlig misslungene Mischfassung zurechtgebastelt. Die rein technischen Schwierigkeiten meisterte er ordentlich, spielte aber durchwegs viel zu laut, was im Schloss vor Husum sofort Missfallen beim anspruchsvollen Publikum hervorrief. Ferruccio Busonis Elegie Nr. 3 „Meine Seele bangt und hofft zu dir“ gehört trotz enormer technischer Anforderungen zu den introvertiertesten Werken des Deutsch-Italieners. Leider agierte Ovcharenko auch hier zu massiv, kaum geheimnisvoll; die erzitternde Zartheit einer im Innersten verunsicherten Seele wurde so nicht deutlich.
Vieles am übrigen Programm – Werke von in der heutigen Ukraine gebürtigen Komponisten – gefiel dem Rezensenten dann sehr wohl. Für die rückwärtsgewandte, jedoch beim Raritätenfestival immer beliebte Salonmusik Sergej Bortkiewiczs traf Ovcharenko genau den richtigen Tonfall, etwa beim schönen Nocturne „Diana“ op. 24,1. Zwei Stücke Paderewskis erhielten von ihm die nötige Eleganz, ohne perfekt zu sein. Als Frühwerk Levko Revutskys (1889–1977) lehnt sich die Sonate h-Moll op. 1 recht uneigenständig an Liszt und Rachmaninow an, wirkte unter Ovcharenkos Händen allzu bombastisch: Selbst mit Gewalt lässt sich daraus kein Meisterwerk machen. Dies nivellierte die ausgezeichneten Wiedergaben von dessen Préludes zuvor. Insbesondere die beiden unkonventionellen Stücke op. 7 – das zweite haarsträubend brillant die gesamte Tastatur in Besitz nehmend – machten Eindruck. Noch faszinierender gelangen am Schluss die nicht nur harmonisch bemerkenswerten Cinq Préludes op. 44 seines Landsmanns Boris Ljatoschinsky, dessen fabelhafte Symphonien endlich mal in deutschen Konzertsälen erklingen sollten.
Das letzte Konzert am 23. 8. spielte der mittlerweile in Berlin lebende Hongkonger Chiyan Wong. Die in Details miteinander verflochtenen sechs Sätze der 1902 entstandenen Suite des von Kind an musikalisch gut vernetzten Gustave Samazeuilh (1877–1967) analysierte Wong geradezu in all ihren Feinheiten. Melodische Oberstimmen knallte er jedoch unverhältnismäßig spitz heraus: auf Dauer nervig. Dies störte bei den Variations sur «Auprès de ma blonde» des berühmten Pariser Organisten Naji Hakim (*1955) – an der Église de la Saint-Trinité Nachfolger Olivier Messiaens – weniger, da schon das Thema sehr staccato-mäßig daherkommt. Das ganz traditionell strukturierte Variationswerk mit unverhohlener Nähe zur französischen Unterhaltungsmusik endete mit einem ansprechenden Finale. Was Wong von seinem Kompositionslehrer Hakim wirklich mitgenommen hat, ließ sich allerdings anhand seines eigenen ganz kurzen Klavierstücks ‚tch‘ kaum festmachen. Etwas sinnlicher erklang immerhin Sergej Prokofjews Amoroso-Finale op. 102,6 aus der Cinderella-Suite.
Nach der Pause versuchte der in England ausgebildete Pianist den Zuhörern Busonis „Konzertfassung“ der Bachschen Goldberg-Variationen nahezubringen, die er vor 6 Jahren beeindruckend eingespielt hat. In Husum übertrieb er dabei freilich gnadenlos: Busoni empfahl den Wegfall sämtlicher Wiederholungen und den Verzicht auf neun der 30 Variationen, erstellte dafür eine klanglich wirkungsvolle Version der letzten Variationen – gerade hier schwächelte Wong kurz – und der Wiederholung der Aria ohne Verzierungen. Wong nahm die romantisierenden Vortragsangaben Busonis allzu ernst, überbetonte zudem die Entwicklung der Basslinie auf verstörend manierierte Art und Weise inklusive unmotivierter Tempomodifikationen. Schließlich entkleidete er die abschließende Aria nicht nur bis auf die Knochen, sondern ließ von ihr quasi überhaupt nichts mehr übrig – ein intellektuelles Experiment sehr zur Verärgerung des Publikums, das mehrheitlich keine Zugabe einforderte. So kam Ferruccio Busoni dieses Jahr in Husum insgesamt nicht gut weg. Neben selbst für den als Vielhörer berüchtigten Rezensenten inspirierenden Neuentdeckungen waren hingegen vor allem die Abende von Aline Piboule und Daniel Grimwood unvergessliche Höhepunkte der durchgehend erstklassigen Raritäten der Klaviermusik 2025.
[Martin Blaumeiser, 27. August 2025]
Hier geht es zu den beiden ersten Teilen des Berichts: