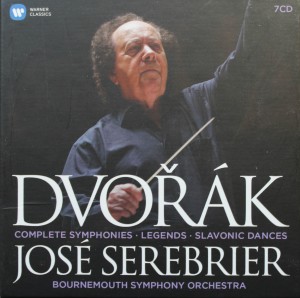audite 92.651, 92. 579, 92.669, 92.670, 92.671
EAN: 4 022143 926517, 4 022143 925794, 4 022143 926692, 4 022143 926708, 4 022143 926715

Für audite spielt Eivind Aadland mit dem WDR Sinfonieorchester Köln das gesamte symphonische Werk des großen norwegischen Nationalkomponisten Edvard Hagerup Grieg ein. Auf 5 CDs finden sich die Symphonischen Tänze Op. 64, die Peer Gynt-Suiten Op. 46 und 55, der Trauermarsch für Richard Nordraak, Zwei Elegische Melodien Op. 34, Aus Holbergs Zeit Op. 40, Zwei Melodien Op. 53 für Streichorchester, Zwei Nordische Melodien Op. 63, die Konzertouvertüre Im Herbst Op. 11, die Lyrische Suite Op. 54, Klokkeklang Op. 54 No. 6 (nicht in die viersätzige Suite aufgenommen), Altnorwegische Romanze mit Variationen Op. 51, Drei Orchesterstücke aus „Sigurd Jorsalfar“ Op. 56, die frühe Symphonie c-Moll, das Klavierkonzert a-Moll Op. 16, Musik zu Henrik Ibsens Peer Gynt Op. 23, sechs Orchesterlieder, zwei Lyrische Stücke, Der Einsame (Den Bergtekne) Op. 32 und die von Hans Sitt orchestrierten Norwegische Tänze Op. 35 (von Grieg autorisiert). Nicht dabei sind die symphonischen Werke mit Chorbesetzung wie Landerkennung und Olav Trygvason sowie die Bühnenmusik zu Peer Gynt in ihrer vollständigen Form.
Kaum ein anderer Komponist mag uns heute so unmittelbar zu verzaubern wie der große Norweger Edvard Hagerup Grieg. Er trifft genau den Nerv unserer Zeit. Seine Schlichtheit, seine Natürlichkeit und seine Naturverbundenheit, unzertrennlich mit dem Gefühl von Freiheit und Sehnsucht geeint, sprechen den heutigen Hörer direkt an, und so gehören nicht zu Unrecht die Peer Gynt Suiten (vor allem die erste), das Klavierkonzert oder die Lyrischen Stücke für Klavier zu den meistgespielten Stücken überhaupt. Zwar gab es eine Zeit, in der Grieg nur wenig rezipiert wurde, und es schrieb beispielsweise Klaus Wolters 1967 in seinem Handbuch der Klavierliteratur, Grieg sei von der alten Generation noch geliebt worden und nun als „Eintagsfliege“ verschwunden, da seine Musik schlicht nicht mehr anspreche, doch: er kehrte wieder und das mit aller Macht. Immer mehr neue Einspielungen gibt es von seinem breiten Œuvre, Gesamtaufnahmen von Klavier-, Kammermusik-, Lied- oder Orchesterwerk, und in den Konzertsälen sind manche Werke absolute Dauerbrenner – und das, obwohl Grieg von sich selber sagte, er werde in 100 Jahren vollkommen vergessen sein.
Doch gibt es noch immer Vorurteile, die Grieg falsch interpretieren. So stellt man sich den Norweger heute meist nur als alten Mann mit Schnauzer und Hirtenstock vor, wie er glücklich auf seinem Fjord sitzt und so schöne wie harmlose Miniaturen verfasst. Wahr ist an diesem Bild eigentlich nur der Schnauzbart, und der Komponist war ein Leben lang von schwerer Krankheit gezeichnet – früh schon verlor er einen Lungenflügel und hatte bis zu seinem Tod ständige Atemnöte -, war geprägt von familiären Krisen (das lange Verbot der Eltern einer Heirat mit seiner Cousine Nina Hagerup, der Tod seiner Tochter Alexandra, kurz darauf der Tod beider Eltern, Probleme mit Nina und Gerüchte um Ehebruch von beiden Seiten aus bis hin zu einer längeren Trennung des Paares, der Suizid seines Bruders etc.) und kämpfte mit ständigen Selbstzweifeln und einem geradezu destruktiven Perfektionismus. Seine Werke überarbeitete er teils unzählige Male, im Falle der Orchestration seines Klavierkonzerts sogar bis zu seinem Tod immer wieder aufs Neue, seine Symphonie zog er vor der Uraufführung als Gesamtwerk zurück und verbot jegliche Aufführung, zu welcher es erst 1980 in Russland durch einen klassischen „Kulturraub“ kam. Und auch das Klischee eines Kleinmeisters ist letztlich nicht ausreichend, denn obgleich Grieg unzählige Klavierminiaturen und eine mit Schubert zu vergleichende Anzahl an Liedern schuf, gingen auch viele große und bedeutende Werke aus seiner Feder hervor: Fünf grandiose Sonaten schuf er, besonders die drei für Violine und Klavier sind bemerkenswert, eine Ballade, die denen von Chopin in nichts nachsteht und diese gar hinsichtlich innerer Bezüge, Länge, pianistischer Schwierigkeiten, Gesamtwirkung und Stringenz zu überbieten versucht, die hier vorliegende Symphonie und das Klavierkonzert sowie ein überwältigendes Streichquartett in g-Moll, quasi Schwesterwerk zur Ballade, um nur einige dieser Werke zu nennen. Nicht zuletzt wird Grieg vorgeworfen, zu abhängig den Traditionen verbunden geblieben zu sein ohne Sinn für Moderne und Fortschritt. Grieg war tatsächlich einigen Neuerern abgeneigt und sagte gar nach einer Aufführung von Strauss‘ Salome, er habe zu lange gelebt und die Musik habe ihn überholt, doch als Reaktionär kann er deshalb keinesfalls bezeichnet werden. Ganz im Gegenteil, gerade in Bezug auf die Harmonik war er fortschrittlicher als die meisten wissen, so beginnt beispielsweise die „Illusion“ mit einem übermäßigen Dreiklang-Akkord und in der Ballade wird ein Durseptakkord in zweiter Umkehrung gegen alle Regeln zehn Mal chromatisch nach oben gerückt, ähnliches findet sich in der Flucht vor den Trollen in der Schauspielmusik zu Peer Gynt. So mag es nicht verwundern, dass Debussy immer wieder Griegbezüge aufweist (teils ganz deutliche wie zu Beginn seines Doktor Gradus Ad Parnassum, wo er unverkennbar auf den Beginn der Holberg-Suite anspielt) und Ravel gar sagte, in jedem seiner Werke stecke der Einfluss von Grieg.
Eivind Aadland geht dem Orchesterwerk dieses grandiosen Komponisten auf den Grund, gemeinsam mit dem WDR-Sinfonieorchester Köln spielte er es auf fünf CDs für audite ein. Das Orchester spielt klar und durchhörbar, der Dirigent verzichtet auf alle unnötigen Romantizismen und überdehnte Tempi rubati. Man fasziniert mit äußerst wandelhaften Charakteren, so agiert man in der Barockgesten aufgreifenden und diese romantisierenden Suite Aus Holbergs Zeit Op. 40 recht nachdrücklich und mit angenehm bleibender Härte, wogegen beispielsweise die Symphonischen Tänzen durchaus lyrisch und weich gestaltet sind. Es entstehen vielfarbige Schattierungen und das Ganze wird nicht wie viel zu häufig zu hören in einem einzigen monochromen „Grieg-Klang“ verschmolzen. Bemerkenswert ist die Lebendigkeit aller Stimmen, also auch derer, die nicht im Vordergrund stehen, was besonders bei den Klavierstücktranskriptionen von Vorteil ist, aber auch in Symphonie und Klavierkonzert eine ungewöhnliche Plastizität und Vielschichtigkeit erwirkt. Alles in Allem entsteht so eine gewisse Sachlichkeit, die jedoch nicht ins Sterile abgleitet, sondern nur die Reflexion und das Bewusstsein über das Werk zeigt anstelle von Überrumpelung durch klischeehafte Gefühlsausbrüche. Auch wird die Dynamik zu keiner Zeit kopflos ausgereizt in übermäßig krachendes Fortissimo oder unhörbares Pianissimo, wodurch das Zuhören sich sehr angenehm gestaltet und nicht in ständiges Lautstärke-Nachpegeln ausartet. Die Aufnahmen sind von höchster Qualität und können den ganzen Farbenreichtum Griegs dem Hörer authentisch vermitteln.
Herbert Schuch ist Solist im Klavierkonzert a-Moll, dem einzigen fertiggestellten Solokonzert Griegs, der zumindest noch drei weitere für Geige, Cello und erneut für Klavier geplant hatte. Ebenso objektiv wie das Orchester versteht er seinen Solopart und passt sich auf natürliche Weise in den Orchesterklang ein. Er spielt feingliedrig und lyrisch ohne Hektik oder Überstürzung, präsentiert gediegene Sanftheit gleichermaßen wie anspringende Scherzhaftigkeit. Außergewöhnlich ist sein Gefühl für große Crescendi und Decrescendi, die in einer kaum erreichten Kontinuität anwachsen beziehungsweise ausblenden.
Eine der wohl schönsten Inspirationen darf Camilla Tilling mit ihrer vielseitigen Sopranstimme vortragen: Solveigs Lied – und fünf weitere Orchesterlieder. Gerade in diesem Lied umfängt sie mit zwei offenkundig divergierenden Seiten ihrer Stimme, einer betrübt zurückgehaltenen im Textteil und einer hell strahlenden im Vokalisenteil. Und auch in den weiteren Liedern gelingt ihr die ganze Bandbreite vom großen Operngesang bis hin zur schubertischen Verinnerlichung. Ihr Vibrato ist durchaus vielseitig, dabei recht kontinuierlich eingesetzt, und nimmt verschiedenste Färbungen ein, so dass auch hier einige Abwechslung entsteht. Auch sie setzt auf innere Gelassenheit und wohltuende Reflexion des Inhalts. Ebenso eine farbenreiche Stimme hat Ton Erik Lie, wenngleich er teilweise etwas im Orchester verloren zu sein scheint. Im Op. 32 vermittelt er ein starkes und glaubhaftes Gefühl von Einsamkeit. Das Vibrato ist ein wenig statisch, doch gleicht er dies durch dynamische Vielfalt aus.
Ohne jeden Zweifel liegt hier eine wahrlich hörenswerte Gesamteinspielung des symphonischen Werkes von Edvard Grieg vor. Aadlands Ökonomie der Gestaltung merkt man die lange Beschäftigung mit dem Komponisten an, er weiß, worauf es ankommt in Griegs Musik. Jedem, der nur die „Hits“ wie die Peer Gynt-Suiten, Holberg-Suite oder das Klavierkonzert kennt und mag, sei wärmstens empfohlen, sich auch mit dem restlichen Orchesterwerk auseinanderzusetzen. Hier (wie auch im Klavier- und Kammermusikbereich) warten bei Grieg phantastische Schätze, wahre Perlen des Nordens!
[Oliver Fraenzke, März 2016]