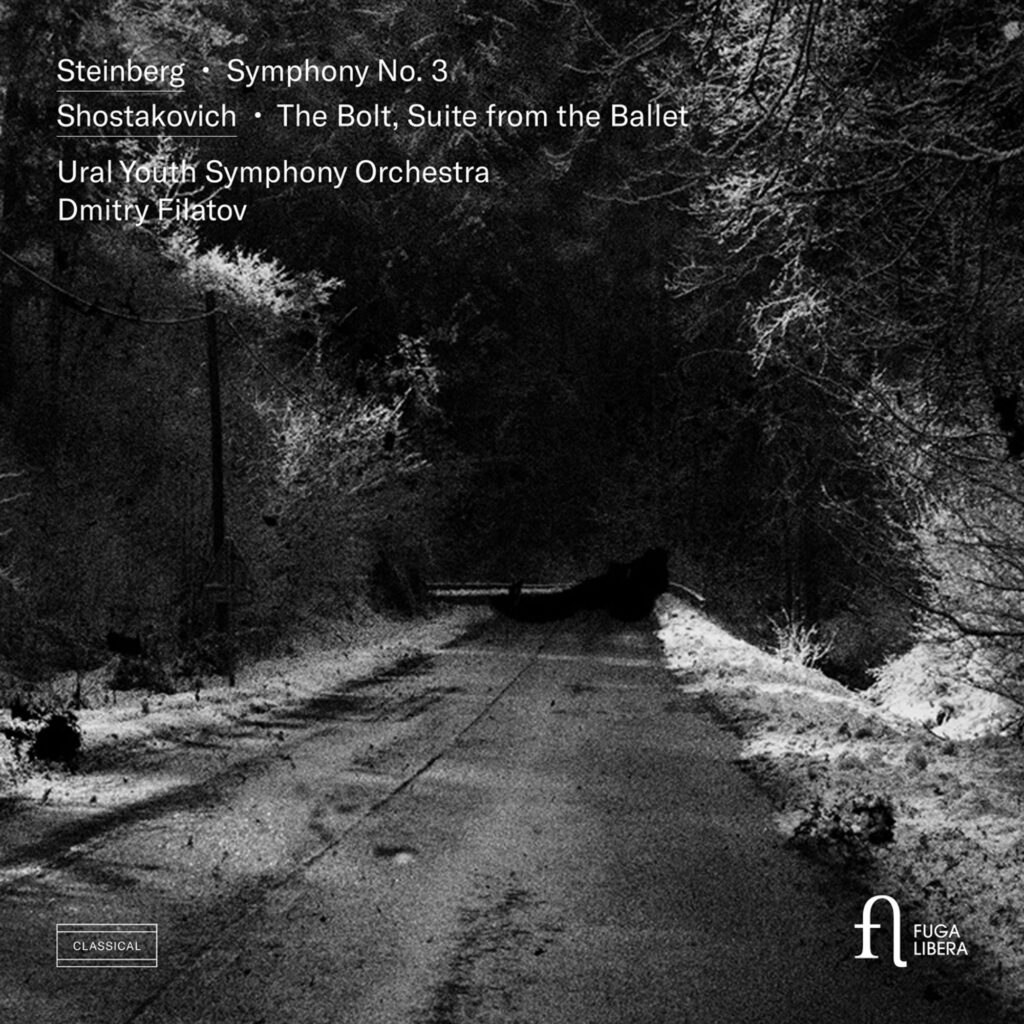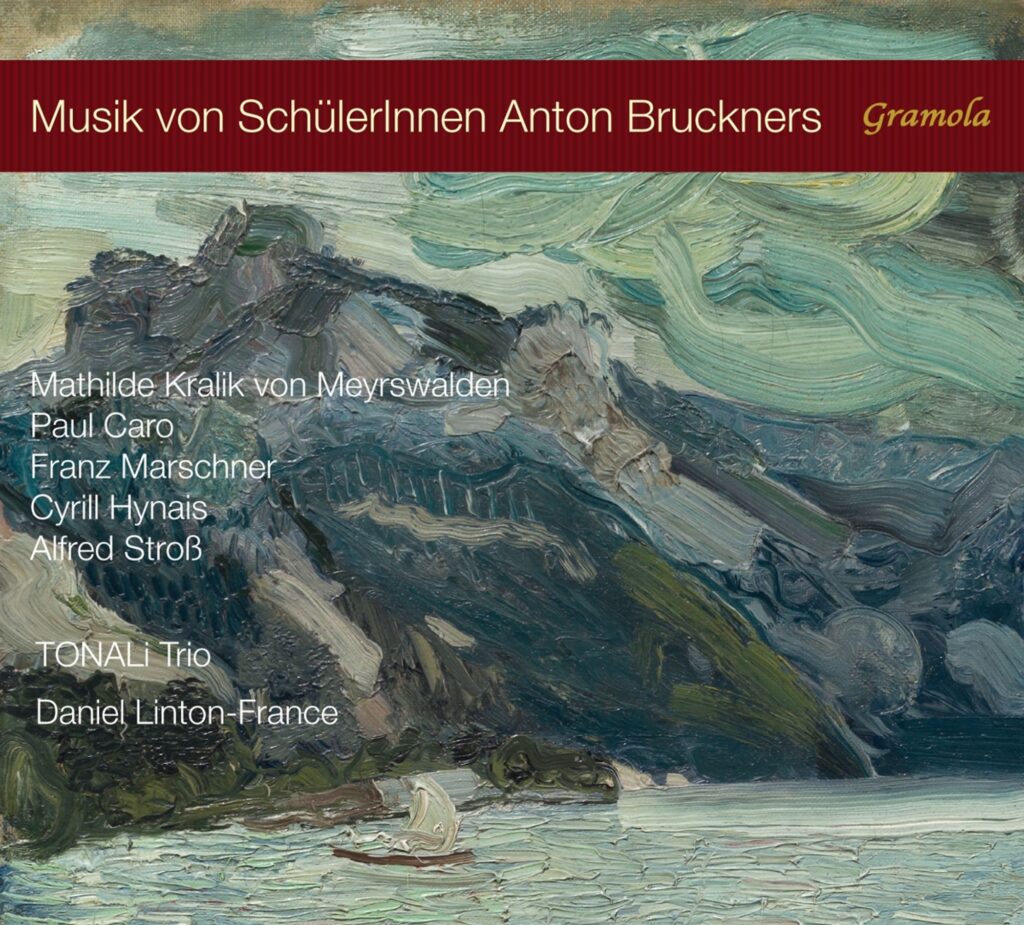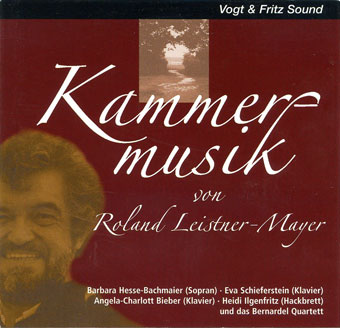Als sich am 2. Februar 1900 in der Pariser Opéra-Comique erstmals der Vorhang für seine Oper Louise hob, hatte sich der 39-jährige Gustave Charpentier in seiner Heimat bereits mit einer Reihe von Werken einen Namen als Komponist gemacht. Mit dieser Oper sollte ihm nun ein Welterfolg gelingen. Von Anfang an als ein Meilenstein der französischen Operngeschichte bewertet, gelangte Louise sehr bald über die Grenzen Frankreichs hinaus: Bereits im Jahr der Uraufführung hörte man sie an der Metropolitan Opera in New York, 1902 wurde sie in Frankfurt am Main, Hamburg und Köln gegeben, 1903 in Berlin und in Wien, wo Gustav Mahler sie an der Hofoper vorstellte; 1908 dirigierte Toscanini das Werk an der Mailänder Scala, im nächsten Jahr wurde sie erstmals am Royal Opera House in London gegeben. Berühmte Sängerinnen wie Mary Garden, Geraldine Farrar, Emmy Destinn, Marie Gutheil-Schoder und Grace Moore glänzten in der Titelrolle. Am 17. Januar 1921 sah man Louise an der Opera-Comique zum 500. Mal.
Gustave Charpentier, Rompreisträger von 1887, war durch Louise endgültig zu einer festen Größe des französischen Musiklebens geworden, der man öffentlich Ehre erwies: Im Jahr der Uraufführung ernannte man ihn zum Ritter der Ehrenlegion, 1912 wurde er in die Académie des Beaux-Arts aufgenommen. Ein akademischer Künstler ist Charpentier freilich zu keinem Zeitpunkt seines Lebens gewesen. Man schaue sich nur die Untertitel seiner Kompositionen an: Er nannte seine Symphonie La Vie du poète ein „Drama“, seine erste Oper Louise einen „musikalischen Roman“ und seine zweite Oper Julien, die zum großen Teil eine erweiterte Neufassung des erwähnten Symphonie-Dramas ist, ein „lyrisches Gedicht“. Hier zeigt sich ein Künstler, der darauf pocht, seinen Gedanken einen ihrer Individualität entsprechenden Ausdruck zu verleihen und der sich nicht bereit findet, gängigen Gattungskonventionen Tribut zu erstatten. Wenn es eine Tradition gibt, in die sich Gustave Charpentier problemlos einreihen lässt, dann ist es die spezifisch französische Tradition der Gattungsmischung, wie sie von Hector Berlioz, namentlich in Werken wie Roméo et Juliette oder La damnation du Faust, begründet wurde. Wie Berlioz stellt Charpentier die Musik stets in den Dienst einer poetischen Idee. Nicht ohne Grund taucht in seinem Schaffen wiederholt der Dichter als Identifikationsfigur auf – und zwar in einer ganz konkreten Gestalt: als Bohèmien aus dem Milieu des Montmartre, des Pariser Künstlerviertels, dem sich Charpentier zeitlebens eng verbunden fühlte.
Gustave Charpentier kam am 25. Juni 1860 im lothringischen Dieuze als Sohn eines Bäckers zur Welt. Ersten Musikunterricht erhielt er von seinem Vater, der als Amateur mehrere Instrumente spielte. Als er zehn Jahre alt war, floh die Familie in Folge des Deutsch-Französischen Krieges nach Tourcoing nahe der Grenze zu Belgien. Hier erhielt Gustave erstmals Violinstunden von einem professionellen Geiger, woraufhin er schon bald im lokalen Orchester mitspielen konnte. Die knappen Einkünfte seiner Eltern zwangen den Fünfzehnjährigen jedoch, einem Broterwerb in einer Spinnerei nachzugehen, wo er sich nach einiger Zeit vom Weber zum Buchhalter hocharbeiten konnte. Als Dank für erteilte Violinstunden ermöglichte ihm sein Arbeitgeber den Besuch des Konservatoriums in Lille und verhalf ihm schließlich zu einem Stipendium der Stadt Tourcoing, das ihm ermöglichte, seine Studien am Pariser Konservatorium fortzusetzen. So siedelte Charpentier 1881 nach Paris über und bezog auf dem Montmartre Quartier. Zwar scheiterte er mit seinem Plan, eine Laufbahn als Violinist einzuschlagen, doch erkannte Jules Massenet seine eigentliche Begabung und nahm ihn 1885 in seine Kompositionsklasse auf. Bereits zwei Jahre später trat Charpentier beim Wettbewerb um den Rompreis an, den er mit der Kantate Didon für sich entscheiden konnte. Didon ist, wie bei Rompreis-Kantaten üblich, auf einen vorgegebenen Text komponiert, also nicht, wie die späteren Hauptwerke des Komponisten, aus seinem eigenen Erleben geboren, doch zeugt das Werk bereits eindrucksvoll von seinem dramatischen Talent und seiner vollkommenen Beherrschung der Orchesterfarben. Eigentlich handelt es sich um eine einaktige Oper für den Konzertsaal.
Mit der Übersiedelung nach Rom, wo er ab Januar 1888 zweieinhalb Jahre als Stipendiat in der Villa Medici wohnte, beginnt die große Zeit des Komponisten Charpentier. Weit entfernt von Paris und dem geliebten Montmartre, findet er endgültig zu sich selbst und gelangt zur Klarheit über seine künstlerische Mission. Seine wichtigsten Werke entstehen hier oder werden zumindest hier begonnen: Im ersten Jahr seines Aufenthalts komponiert er die Symphonie La Vie du poète, im folgenden die Orchestersuite Impressions d’Italie; auch das Konzept von Louise reicht in diese Zeit zurück, doch entstand der Großteil der Oper erst nach Charpentiers Rückkehr in Paris.

La Vie du poète ist eine der originellsten Vokalsymphonien, die es gibt. Die vier Sätze des Werkes entsprechen annähernd den vier Sätzen einer klassischen Symphonie. Zugleich sind sie als Stationen der Handlung eines Dramas gedacht. Entsprechend bezeichnet Charpentier sie als „Akte“, wobei der dritte Akt in zwei Bilder, den dritten und den vierten Satz, gegliedert ist. Auch findet sich in der Partitur des ausdrücklich „Symphonie-Drame“ genannten Werkes ein Verzeichnis der handelnden Personen und der Handlungsorte. Letztere sind freilich als „vollkommen imaginär“ zu verstehen. Jeder der vier Sätze steht unter einem bestimmten Motto: „Enthusiasmus“, „Zweifel“, „Ohnmacht“ und „Rausch“. Es sind die Zustände, die der Held des Stückes, der nur „der Dichter“ genannt wird, im Laufe der Handlung durchlebt. Der erste Satz hebt mit feurigem Schwung an. Der Chor tritt erst mit dem lyrischen Seitenthema ein, wo er die „inneren Stimmen“ des Dichters verkörpert, die ein Gebet an das „reine Licht“ senden. Der Dichter fühlt sich von Visionen ergriffen, und der Satz endet orgiastisch mit einem Lobpreis der „immensen Flamme“ schöpferischer Kraft. Im zweiten Satz finden wir den Dichter von den „Stimmen der Nacht“ umgeben, die zärtlich zu ihm sprechen, aber die Selbstzweifel nicht zerstreuen können, die ihn in der Dunkelheit und Stille überkommen. Da erfasst ihn im dritten Satz die „Ohnmacht“, verdeutlicht durch ein brodelndes Orchesterstück voller Chromatik, das wild herum moduliert, kurze Motive hin und her hetzt, Melodien mit langem Atem auszuspinnen versucht, aber immer wieder daran scheitert, Steigerungen in Gang zu bringen… Wann wurde je eine Schreibblockade unterhaltsamer in Musik gesetzt? Der vokale zweite Teil des Satzes ist langsamer und bringt in musikalischer Hinsicht Beruhigung, schwingt sich aber mehrfach zu gotteslästerlichen Flüchen auf, die den Ärger des Dichters zum Ausdruck bringen. Schließlich findet der Dichter im letzten Satz den inspirierenden Rausch durch ein Fest auf dem Montmartre, wo er ein Mädchen trifft, das für ihn tanzt, juchzt und Vokalisen trällert – und das, „schurkisch lachend“ (!), den Betrunkenen schließlich zurücklässt, woraufhin die inneren Stimmen mit drei leisen „Ah“ das Drama beenden. Kein glücklicher, aber auch kein eigentlich tragischer Ausgang! Der Dichter, unschwer als Alter Ego Charpentiers zu erkennen, hat jetzt jedenfalls die Erfahrungen gesammelt, die er braucht, um sein Werk zu schaffen, das nichts anderes ist als eben das Symphonie-Drama La Vie du poète…
Charpentier hat später bekannt, dass er kein Werk schreiben könne, das er nicht selbst zuvor durchlebt habe. Verarbeitete er in La Vie du poète eigene Erlebnisse als junger Künstler im Montmarte-Milieu, so sind die Impressions d’Italie das Produkt seiner Reisen durch Italien während seiner Zeit als Rompreis-Stipendiat. In der Suite, ursprünglich als „Symphonie sentimentale et pittoresque“ bezeichnet, fehlt bezeichnenderweise das historische Italien völlig. Anders als wenige Jahre zuvor Richard Strauss in seiner Symphonischen Fantasie Aus Italien hat Charpentier „Roms Ruinen“ keinen Satz gewidmet und sich ausschließlich von Landschaftsbildern und Szenen aus dem Volksleben inspirieren lassen. Das Werk erwächst aus der Ruhe: Ganze zwei Minuten lang sind nur die Violoncelli zu hören, die eine einfache, leicht beschwingte Melodie spielen. Mit geringstem Aufwand gelingt dem Komponisten die Schilderung einer gelösten Grundstimmung: Der Italienreisende entspannt sich und genießt, was an sein Ohr gelangt. Mit feinem Gespür für atmosphärische Wirkungen überträgt Charpentier akustische Phänomene des Alltags aufs Orchester: die Gitarrenklänge der Serenade, die Schellen der Maultiere, die Glocken, die man vom Gipfel des Berges aus dem Tal empor klingen hört… Diese Musik spielt sich durchweg unter freiem Himmel ab und bietet prachtvolle Panoramablicke. Befand man sich in den ersten vier Sätzen im ländlichen Italien, so schildert der letzte und weitaus umfangreichste Satz die Großstadt Neapel. Ähnlich wie im Finale von La Vie du poète, wo man Blaskapellen aus verschiedenen Straßen zu hören meint, entlockt Charpentier dem Orchester eine Vielzahl räumlicher Effekte, um den großstädtischen Trubel adäquat umzusetzen. Die Themen basieren teils auf originalen Lied- und Tanzmelodien, die der Komponist in Neapel und Umgebung notierte. Der Satz beginnt mit einer Tarantella. Im weiteren Verlauf tritt ein Liedthema, das im ersten Teil nur kurz anklang, immer dominanter auf: zunächst als serenadenhaftes Cellosolo, schließlich als schmetternde Trompetenmelodie. Im Schlussteil – möglicherweise die Darstellung des anbrechenden Morgens nach der Nachtmusik des Mittelteils – werden alle zuvor präsentierten Elemente durcheinander gewirbelt. Aus den Themen abgeleitete Bläsersignale scheinen von Straße zu Straße, von Haus zu Haus fort zu klingen, bis die ganze Stadt in grellem Sonnenschein pulsiert.
Aus Italien zurückgekehrt, widmete sich Charpentier jenem Werk, das sein berühmtestes werden sollte: der Oper Louise. Sein in den beiden symphonischen Werken bewiesenes Talent zur feinen Wiedergabe menschlicher Seelenzustände wie zur naturalistischen Milieuschilderung stellte er hier in den Dienst eines mitten aus dem Leben gegriffenen Stoffes. In Louise treffen zwei Welten aufeinander, die Charpentier aus eigenem Erleben kannte: die der Arbeiter und die der Künstler. Vor dem Hintergrund des Montmartre-Viertels schildert die Handlung die Liebe der Näherin Louise zu dem Dichter Julien und den sich sich dadurch ergebenden Konflikt mit ihren Eltern. Charpentier hatte wahrlich nicht vor, eine konventionelle Oper zu schreiben. Schon die Bezeichnung des Werkes als „Roman musical“ deutet an, dass sich das Stück radikal von der stark formalisierten französischen Operntradition abhebt. Tatsächlich haben wir weniger ein Drama als eine erzählerisch angelegte Bilderfolge vor uns. So wird der Gegensatz zwischen Kleinbürgern und Bohèmiens nicht zum Ausgangspunkt eines tragischen Konflikts, sondern zum Anlass ausführlicher Schilderung. Das Stück endet dort, wo ein klassischer Dramatiker es vielleicht hätte beginnen lassen. Es ist auch gar nicht schlimm, dass man nicht erfährt, ob Louise mit Julien glücklich wird oder sich mit ihren Eltern wieder versöhnt. Sie verschwindet am Ende in den Straßen des Montmartre und gibt damit zu verstehen, dass die eigentliche Hauptperson des Stückes jenes Paris ist, das ihr Vater in den letzten Worten der Oper verflucht. Ähnlich wie La Vie du poète in einer Art Katerstimmung schließt, kommt auch Louise ohne eine echte Lösung aus, da die Handlung weniger ins Gewicht fällt als die Darstellung. Mit viel Liebe hat Charpentier die „kleinen Leute“ gezeichnet: als sein eigener Librettist in der Verwendung dialektal eingefärbter Sprache, als Komponist, indem er die Atmosphäre der Großstadt Paris eingefangen hat wie kaum ein anderer. Besonders stechen die Volksszenen der beiden mittleren Akte heraus, die in der Krönung Louises zur Muse des Montmarte durch die Bohèmiens gipfeln – bezeichnenderweise baute Charpentier an dieser Stelle sein bereits zuvor separat komponiertes „Cantate-ballet“ Le Couronnement de la muse ein, ein ausdrücklich als Freiluftmusik für Massenveranstaltungen konzipiertes Werk.
Kurze Zeit nach der Uraufführung von Louise war Gustave Charpentier weltberühmt. Er gehörte nun zu jenen Künstlern, die damit rechnen konnten, dass jedes neue Werk von ihnen im internationalen Musikleben auf großes Interesse stoßen würde. Allerdings blieben diese neuen Werke weitgehend aus. Erst 1913 trat er wieder mit einer umfangreichen Arbeit hervor: der Oper Julien ou La vie du poète. Wie im Untertitel des Werkes bereits angedeutet, handelt es sich um eine Neufassung von La Vie du poète. Hält man die Noten der Symphonie und der Oper nebeneinander, so zeigt sich, dass die Musik des älteren Werkes über weite Strecken nahezu unverändert übernommen wurde, freilich ergänzt um zahlreiche neue Episoden, um die Abschnitte der Symphoniesätze zu ausgewachsenen Opernszenen zu erweitern. Julien ist als Fortsetzung von Louise gedacht. Beide Hauptfiguren der ersten Oper treten hier wieder auf, wobei Louise im Verlauf der Handlung stirbt und anschließend nur noch als Traumbild Juliens in verschiedenen Gestalten präsent ist. Das Publikum nahm die Oper, deren musikalische Qualität außer Zweifel steht, freundlich auf, zeigte sich aber von der kaum zu entwirrenden Verschmelzung von Traum und Wirklichkeit irritiert. So erreichte Charpentier mit diesem Versuch, die Handlung seiner Symphonie, die sich zum großen Teil in der Phantasie des Helden abspielt, auf die Opernbühne zu übertragen, nur noch einen Achtungserfolg, und konnte nicht an die Triumphe seiner Louise anknüpfen.
In der Literatur liest man noch von einigen weiteren Projekten: so von einer Oper L’amour au faubourg, oder von einer Symphonischen Dichtung Munich, die als erstes Stück einer neuen Reihe orchestraler Reisebilder gedacht gewesen sein soll. Wann genau der Tondichter Gustave Charpentier verstummte, lässt sich nicht genau sagen, doch steht fest, dass er nach Julien kein neues Werk mehr veröffentlichte. Er musste alles selbst erlebt haben, was er in Musik setzte. Nachdem er dem Montmartre mit Louise das Hohelied gesungen und dem Dichterleben der Bohèmiens in Symphonie und Oper Denkmäler errichtet hatte, scheint er zu dem Schluss gekommen zu sein, dass er als schöpferischer Künstler seinen Kreis durchschritten hatte. Zum hauptsächlichen Lebensinhalt wurde ihm nun die pädagogische Tätigkeit, wobei er auch hier persönliche Akzente setzte: Dem einfachen Volk stets eng verbunden, gründete er 1902 das Conservatoire Populaire Mimi Pinson. Benannt nach einer literarischen Figur, die im allgemeinen Sprachgebrauch zur typischen Verkörperung der Pariser Arbeiterin wurde, setzte sich dieses Konservatorium zum Ziel, Arbeiterinnen zu höherer musikalischer Bildung zu verhelfen. Charpentier konnte eine Reihe angesehener Musiker dazu gewinnen, dort unentgeltlich Unterricht zu erteilen. Die Erfolge seines Bildungswerks präsentierte er in regelmäßigen Wohltätigkeitskonzerten, die er mit seinen Schülerinnen in Paris wie in der französischen Provinz veranstaltete. So wurde das musikerzieherische Wirken im Dienste der einfachen Frauen zum eigentlichen Spätwerk Gustave Charpentiers, das er bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs fortführte. Daneben verfolgte er aufmerksam die Entwicklung moderner Medien, erstellte Kurzfassungen von Impressions d’Italie, La Vie du poète und Louise für die Schallplatte und nahm einige seiner Werke als Dirigent selbst auf. 1939 betreute er die Verfilmung von Louise durch den Regisseur Abel Gance. Zu seiner besonderen Freude konnte er erleben, wie die Opéra-Comique 1950 den 50. Jahrestag der Premiere seines Erfolgsstücks mit einer festlichen Jubiläumsveranstaltung beging. Vor 70 Jahren, am 18. Februar 1956, starb Gustave Charpentier im 96. Lebensjahr.
[Norbert Florian Schuck, Februar 2026]