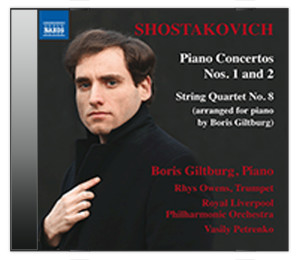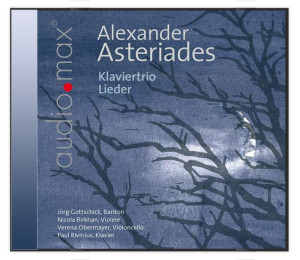Im Freien Musikzentrum München spielen Violeta Barrena und Ottavia Maria Maceratini am 19. Februar Werke von Schubert, Ravel, Chopin, Weinberg und Monti sowie Zugaben von Piazzolla und Chuquisengo.
Das Freie Musikzentrum München ist einem kleinen Hörerkreis schon lange als Wohnzimmer für erstklassige Klassikkonzerte bekannt, und gerade auch der heutige Abend sollte keine Ausnahme bilden. Schon des Öfteren spielte die italienische Pianistin Ottavia Maria Maceratini in diesem kleinen Saal, in dem auch heute wieder alle Zuhörer konzentriert und beinahe ins Geschehen involviert wirken; und für die in England lebende katalanisch-schweizerische Violinistin Violeta Barrena ist dies heute ihre Premiere im FMZ. Vor allem aber ist es die gemeinsame Premiere der beiden exzellenten Musikerinnen als Duo.
Das Programm beginnt mit Schuberts a-Moll-Sonatine D. 385, ein hinreißendes Werk, erfüllt von harmonischen Finessen und subtiler Gestaltung. Das Werk ist bekannt als beschauliches Stück Hausmusik, das nicht allzu tiefgreifend scheint. Aber weit gefehlt bei der heutigen Darbietung, unter den Fingern von Barrena und Maceratini entfaltet die viersätzige Sonatine ihr gewaltiges symphonisches Potential in aller Farbenpracht. Brausend begehrt der Kopfsatz auf, nach welchem im Andante tiefe Abgründe aufgerissen werden; In tänzerischer Beschwingtheit – nicht ohne Doppelbödigkeit – gibt sich das Scherzo-hafte Menuetto und auf eine zwiespältige Weise versöhnend schließt das Allegro-Finale. Es folgt die einsätzige postume Violinsonate Ravels, ein Werk aus Studienzeiten, das der Komponist anscheinend nicht für bedeutend genug für eine Veröffentlichung ansah: Ein grobes Fehlurteil. In diesem Frühwerk ist schon der unverkennbare Personalstil Ravels manifestiert, ein zwischen Traum und Realität changierender Fluss innigster Leidenschaft. In allen Farben schillert das Stück wie auch die Darbietung der beiden jungen Musikerinnen, die sich voll auf diese eigenartige Gefühlwelt einlassen. Ungehört griffig erklingt die Sonate, beide lassen sich nicht einfach treiben, sondern holen bewusst zentrale Elemente hervor und legen so die Struktur inmitten dieses feingliedrigen Geflechts frei.
Als Solistin darf Ottavia Maria Maceratini nach der Pause mit Chopins Polonaise Fantasie op. 61 glänzen, einem kolossalen Spätwerk in erstaunlicher Konzentration. Bereits die ersten Noten können bei Maceratini verzaubern, so himmlisch transzendental erheben sich die eröffnenden Linien. Die Pianistin legt ihre vollste Energie und emotionale Bandbreite in die einzelnen Passagen, erreicht kühne Höhepunkte, lässt sich als Ausgleich in träumerische Gefilde fallen. Anders als bei den restlichen Werken des Abends ist kein großer Bogen von der ersten bis zur letzten Note zu verspüren, viel eher verlagert sich Maceratini auf interne Höhepunkte und die Auskostung eines jeden Aufbaus. Expressive Töne, nun wieder von beiden Musikerinnen, sind in der Sonatine von Mieczysław Weinberg zu hören, die mit einem jüdisch-östlichen Flair und einer gewissen Robustheit versehen ist. Wie auch Schubert ist dies eigentlich keine übliche Sonatine, sondern enthält die gesamte Innenwelt eines großen Konzertwerks und ebenso erklingt sie auch. Das Finale bildet der unverwüstliche Csárdás von Vittorio Monti, bei welchem sich die Violinistin voll austoben darf und in spielerischer Freude über die Saiten huscht, dabei allerdings auch nicht die zarte Ausgestaltung der einzelnen Linien vernachlässigt. Als Zugabe gibt es noch zwei Werke aus Lateinamerika, Piazzollas Oblivion, der selten so introvertiert-mitreißend erklingt, und Juan José Chuquisengos Arrangement von Mariano Mores’ populärer Milonga ‚Taquito militar’ für Violine und Klavier, ein so belebter wie unentrinnbar mitreißender Tanz.
Den ganzen Abend herrscht eine ganz besondere Energie, die jeden Zuhörer im Raum gefangen nimmt und innerlich involviert. Kaum zu glauben, dass die beiden Musikerinnen heute das erste Mal gemeinsam aufgetreten sind, solch eine intensiv innige Bindung ist zwischen ihnen zu spüren und bis ins kleinste Atmen ist alles wunderbar aufeinander abgestimmt. Es ist eine Natürlichkeit der Bühnenpräsenz, fernab der allgegenwärtigen Trennung von Musikern und Publikum, die alles so intim werden lässt und die Musik noch unmittelbarer zur Entfaltung bringt.
[Oliver Fraenzke, Februar 2017]